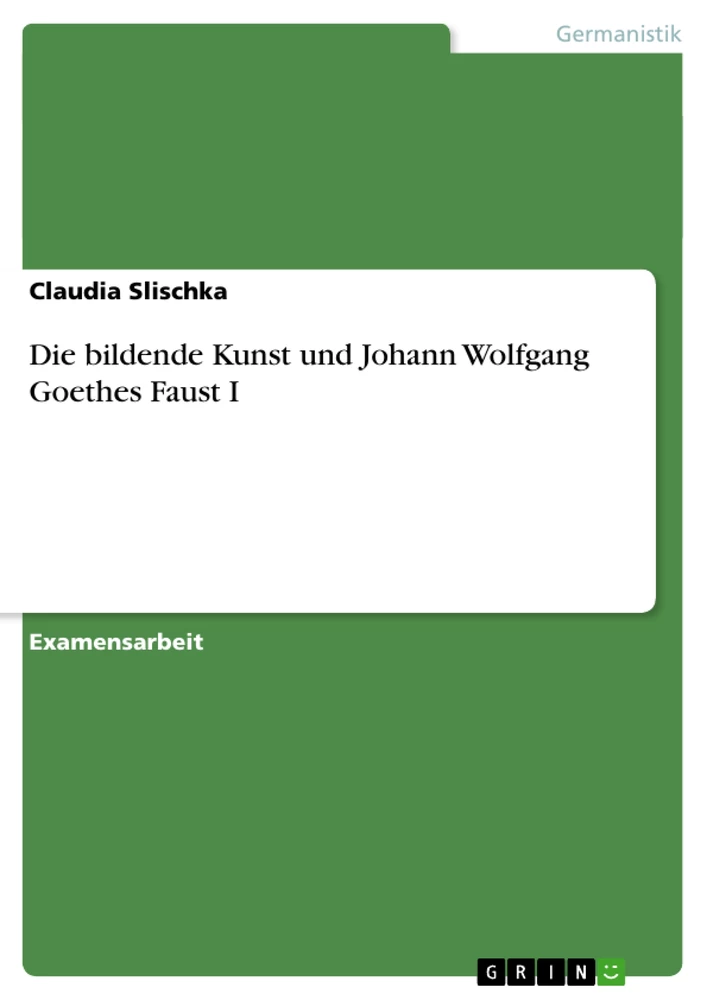»Gehört nicht Alles, was die Vor- und Mitwelt geleistet, dem Dichter von Rechtswegen an? [...] Nur durch Aneignung fremder Schätze entsteht ein Großes.
2. Dezember 2000, eine Menschenansammlung und jemand ruft, »Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, und manche liebe Schatten steigen auf; [...]«; ich befinde mich im Vorraum der Arena und diese Tatsache zusammen mit dem Wissen, soeben ein Theaterticket mit dem Aufdruck: Peter Stein inszeniert ‚Faust’ von Johann Wolfgang Goethe eingelöst zu haben, machen mir bewusst, mich in einem Theaterstück zu befinden. Verdränge ich den geschilderten Kontext, bin ich Teil dieser ‚Welt’ und fühle mich direkt angesprochen, denn neben der Widmungsqualität, die Goethes Zueignung innewohnt, wird hier auch die theatralische Illusion aufgehoben indem erst das Folgende als dichterische Hervorbringung, als Spiel poetischer Imagination deklariert wird. Diese Intention Goethes setzt Stein dramaturgisch brillant um; nach der Zueignung bittet ‚er’ ins Theater. So betrete ich erst jetzt das ‚Theaterhaus’ und habe noch Zeit, mir über meine mitgebrachten Bilder Gedanken zu machen.
Einst - an der Polytechnischen Oberschule - hatte ich Goethes Schlussmonolog in Faust II zu meiner Abschlussprüfung rezitieren und interpretieren müssen; eine der Aufgabenstellungen lautete: ‚Ordnen Sie Goethes Faust in das sozialistische Kulturerbe der DDR ein!’. Ziemlich fassungslos, weil sich die ‚Welt’ des Goetheschen Faust für mich nicht mit jenem sozialistischen Kulturerbe in Einklang bringen ließ, gelang es mir doch, jene Vision Fausts: Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn, entsprechend der sozialistisch-nationalen Lesart zu kommentieren. Jenes verzerrte Bild einer positiven tatkräftigen Faust-Figur als einer nationalen Vorreiterfigur des Sozialismus wurde mir damals eingeimpft, und eben jenes Bild kam mir nun ob seiner Paradoxie wieder in den Sinn.
Und dies jenem Goethe, der sich Tore und Straßen nach allen Enden der Welt wünschte und auf eine allgemeine Weltliteratur hoffte, die einen allgemeineuropäischen bzw. gar weltweiten Wechseltausch des Nehmens und Gebens bedeuteten sollte. Dabei ist gerade die Faust-Dichtung beispielgebend für solchen Wechseltausch, der Goethe im Faust wichtiger scheint als eine innere Stringenz...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Goethes Faust - Bild der Welt
- I. Das moderne System der „schönen Künste“
- 1. Medienästhetische Ansätze: Du Bos - Batteux - Diderot
- 2. Mediendifferenz zwischen Dichtung und darstellender Kunst: Lessings Laokoon
- 3. Goethes dynamische Kunstanschauung
- II. Goethe, die bildende Kunst und „Faust I“
- 1. Goethe und die bildende Kunst: Begegnung. Exkurs: Metamorphose der Kunst. Exkurs: Bildbeschreibung
- 2. Die bildende Kunst und „Faust I“. Natur gesehen durch Kunst, Kunst gesehen durch „Faust I“. „Das schönste Bild von einem Weibe“. Phantastische Bilder
- III. „Faust I“ und seine Bilder
- 1. Illustrationen
- 2. Theater
- 3. Film
- Nachwort: Dichtung als Bild
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die Beziehung zwischen Goethes „Faust I“ und der bildenden Kunst. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Goethes dynamische Kunstanschauung zu beleuchten und deren Einfluss auf seine Dichtung aufzuzeigen. Sie analysiert, wie die bildende Kunst in „Faust I“ präsent ist und wie Goethe selbst die bildende Kunst in seinem Leben und Werk rezipierte.
- Goethes Kunstanschauung und ihre Entwicklung
- Die Rezeption der bildenden Kunst in „Faust I“
- Der Einfluss der Medienästhetik auf Goethes Werk
- Die Beziehung zwischen Literatur und darstellender Kunst bei Goethe
- „Faust I“ als Spiegel seiner Zeit und der Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Goethes „Faust“ - Bild der Welt: Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen Goethes „Faust“ und der bildenden Kunst her, indem sie die vielfältigen Bezüge aufzeigt. Sie beginnt mit einer persönlichen Anekdote der Autorin, die ihre Auseinandersetzung mit dem Werk im Kontext ihrer sozialistischen Erziehung beschreibt und diese mit Goethes eigener Vielschichtigkeit und dem Austausch von Ideen verbindet. Die Einleitung betont den dynamischen, vielschichtigen Charakter von Goethes „Faust“ und dessen offenen Charakter im Sinne eines ständigen Austauschs und Weiterentwicklung.
I. Das moderne System der „schönen Künste“: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des modernen Kunstverständnisses im 18. Jahrhundert, beginnend mit den medienästhetischen Ansätzen von Du Bos, Batteux und Diderot. Es analysiert die Mediendifferenz zwischen Dichtung und darstellender Kunst im Kontext von Lessings „Laokoon“ und legt den Fokus auf die dynamische und vielseitige Kunstanschauung Goethes im Kontext der damaligen Diskussionen. Der Abschnitt arbeitet heraus, wie die Auseinandersetzung mit den Theorien der Zeit Goethes eigene ästhetische Position beeinflusste und wie diese Position für das Verständnis seines Werkes entscheidend ist.
II. Goethe, die bildende Kunst und „Faust I“: Dieses Kapitel analysiert Goethes persönliche Begegnungen mit der bildenden Kunst und deren Einfluss auf „Faust I“. Es untersucht, wie Goethes eigene Kunstauffassung in der Dichtung zum Ausdruck kommt. Die Exkurse zu Metamorphose der Kunst und Bildbeschreibung bieten zusätzliche Einblicke in die Methodik der Analyse und erweitern das Verständnis für Goethes Werk. Der Abschnitt untersucht die Darstellung verschiedener Aspekte der bildenden Kunst im „Faust I“ und die Bedeutung der Bildlichkeit für das Gesamtverständnis des Werks.
III. „Faust I“ und seine Bilder: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen visuellen Adaptionen von „Faust I“, von Illustrationen über Theaterinszenierungen bis hin zu Filmversionen. Es zeigt auf, wie die verschiedenen Medien die Geschichte interpretieren und visuell umsetzen, und wie diese Interpretationen das Verständnis des Textes beeinflussen. Der Abschnitt beleuchtet die transformative Kraft der bildlichen Darstellung und wie sich das Werk über die Jahrhunderte durch verschiedene visuelle Medien weiterentwickelt hat.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust I, Bildende Kunst, Medienästhetik, Lessing, Laokoon, Kunstanschauung, Literatur, Theater, Film, Illustrationen, Dynamik, Vielschichtigkeit, Interpretation.
Goethes Faust I und die Bildende Kunst: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Examensarbeit?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Goethes "Faust I" und der bildenden Kunst. Sie beleuchtet Goethes dynamische Kunstanschauung und deren Einfluss auf seine Dichtung. Analysiert wird, wie die bildende Kunst in "Faust I" präsent ist und wie Goethe die bildende Kunst in seinem Leben und Werk rezipierte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Goethes Kunstanschauung und deren Entwicklung, die Rezeption der bildenden Kunst in "Faust I", den Einfluss der Medienästhetik auf Goethes Werk, die Beziehung zwischen Literatur und darstellender Kunst bei Goethe und "Faust I" als Spiegel seiner Zeit und der Kunstgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Nachwort. Die Einleitung stellt die Verbindung zwischen "Faust" und der bildenden Kunst her. Kapitel I behandelt das moderne System der "schönen Künste" im 18. Jahrhundert, Kapitel II analysiert Goethes persönliche Begegnungen mit der bildenden Kunst und deren Einfluss auf "Faust I", und Kapitel III befasst sich mit verschiedenen visuellen Adaptionen von "Faust I" (Illustrationen, Theater, Film).
Wie wird Goethes Kunstanschauung dargestellt?
Die Arbeit betont Goethes dynamische und vielschichtige Kunstanschauung. Sie analysiert, wie sich diese Anschauung im Laufe seines Lebens entwickelte und wie sie sich in "Faust I" niederschlägt. Dabei werden die Einflüsse von Medienästhetikern wie Du Bos, Batteux und Diderot sowie Lessings "Laokoon" berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Medienästhetik?
Die Medienästhetik spielt eine wichtige Rolle, indem sie den Kontext für Goethes Kunstanschauung liefert. Die Arbeit untersucht, wie die Auseinandersetzung mit den medienästhetischen Ansätzen des 18. Jahrhunderts Goethes eigene ästhetische Position beeinflusste.
Wie wird die Beziehung zwischen Literatur und darstellender Kunst dargestellt?
Die Arbeit analysiert die enge Beziehung zwischen Literatur und darstellender Kunst bei Goethe. Sie untersucht, wie die bildende Kunst in "Faust I" präsent ist und wie verschiedene visuelle Adaptionen (Illustrationen, Theater, Film) das Verständnis des Textes beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Goethe, Faust I, Bildende Kunst, Medienästhetik, Lessing, Laokoon, Kunstanschauung, Literatur, Theater, Film, Illustrationen, Dynamik, Vielschichtigkeit und Interpretation.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Analyse von Goethes Werk und seiner Rezeption der bildenden Kunst. Es werden Exkurse zu Themen wie der Metamorphose der Kunst und der Bildbeschreibung verwendet, um das Verständnis für Goethes Werk zu vertiefen.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beginnt mit einer persönlichen Anekdote der Autorin, die ihre Auseinandersetzung mit dem Werk im Kontext ihrer sozialistischen Erziehung beschreibt und diese mit Goethes eigener Vielschichtigkeit und dem Austausch von Ideen verbindet. Sie betont den dynamischen, vielschichtigen Charakter von Goethes „Faust“ und dessen offenen Charakter im Sinne eines ständigen Austauschs und Weiterentwicklung.
- Quote paper
- Claudia Slischka (Author), 2002, Die bildende Kunst und Johann Wolfgang Goethes Faust I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27842