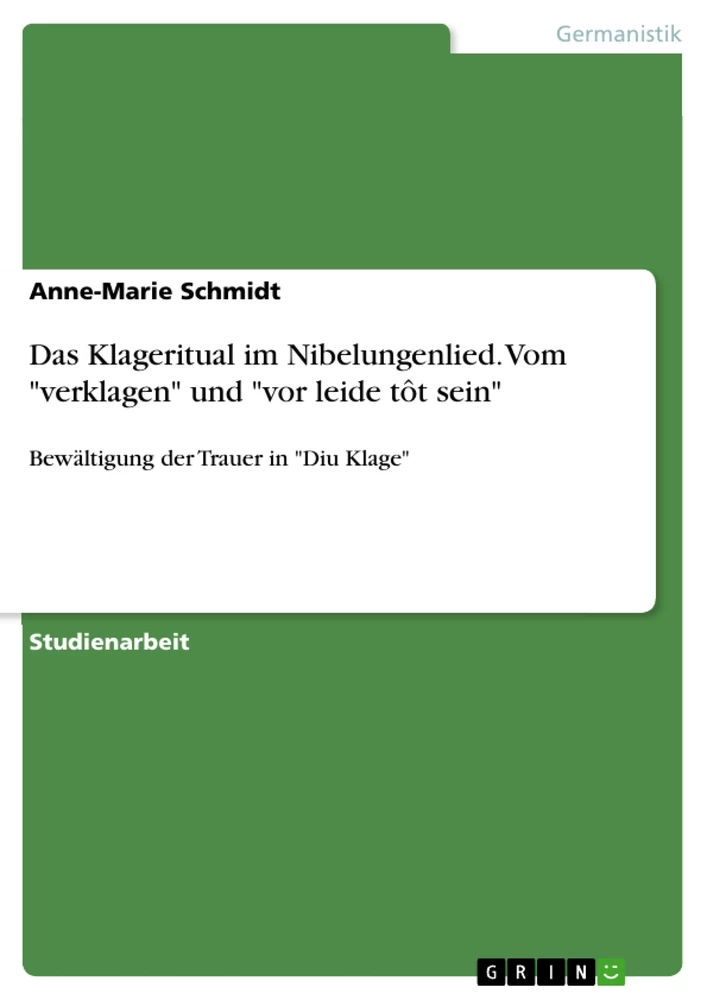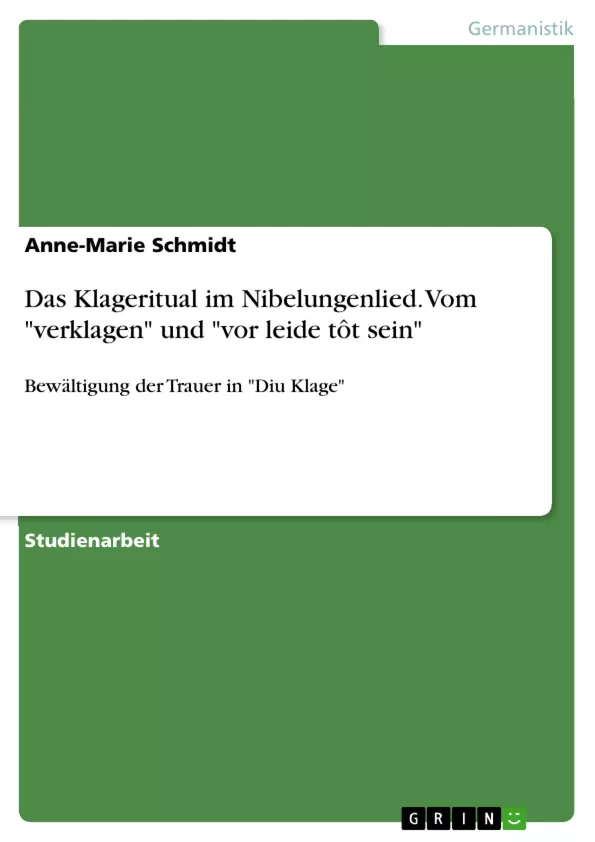Diese Arbeit liefert eine Analyse des Klagerituals in der zum Nibelungenlied gehörenden Klage. In der Analyse folgt zunächst eine komprimierte Einführung in die Entwicklungsgeschichte der Totenklage, in welcher auch der Begriff des Rituals nach Hans-Georg Soeffner erschlossen wird. Nach der Darstellung des Totenrituals in der Klage und der Analyse der drei Hauptfiguren, Etzel, Dietrich und Hildebrant, werden ausgewählte Figuren mit Hilfe von Sigmuns Freuds Terminologien von Trauer und Melancholie in zwei unterschiedliche Klageformen eingeteilt. Dabei soll die Frage nach der Produktivität und Funktionalität dieser beiden Klageformen geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Problemstellung und Zielsetzung
- Die Totenklage
- Natürliche Affektabfuhr oder höfische Kultur
- Das Klageritual in der Klage
- Die drei Hauptfiguren Etzel, Dietrich und Hildebrant
- Das verklagen
- Trauer und Melancholie
- Dietrich und Dietlind
- vor leide tôt sein - Endstation Melancholie
- König Etzel
- Das kollektive Klagen
- Zusammenfassung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Totenklage in der mittelalterlichen Dichtung „Diu Klage“ und untersucht, wie Trauer und Melancholie in diesem Text verarbeitet werden. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Klageformen, die Rolle des Rituals in der Totenklage und die Auswirkungen des Verlustes auf die Hauptfiguren.
- Die Totenklage als Ausdruck von Trauer und Melancholie
- Die Rolle des Rituals in der Totenklage
- Die Auswirkungen des Verlustes auf die Hauptfiguren
- Die verschiedenen Klageformen in „Diu Klage“
- Die Produktivität und Funktionalität von Trauer und Melancholie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar. Sie führt in die Thematik der Totenklage in mittelalterlichen Texten ein und erläutert die Bedeutung der Klage als literarisches Genre.
Das Kapitel „Die Totenklage“ befasst sich mit den Wurzeln und Merkmalen der Totenklage in epischen Texten. Es diskutiert, ob die Totenklage höfischen Normen folgt oder Ausdruck einer natürlichen Affektabfuhr ist. Die Arbeit analysiert die Thesen von Richard Leicher und Max Wehrli, die sich mit der Frage der rituellen und emotionalen Dimension der Totenklage auseinandersetzen.
Das Kapitel „Das verklagen“ untersucht die Trauer und Melancholie als zentrale Elemente der Totenklage. Es analysiert die Figuren Dietrich und Dietlind und ihre unterschiedlichen Klageformen. Die Arbeit greift auf die Terminologien von Sigmund Freud zurück, um die psychologischen Prozesse der Trauer und Melancholie zu beleuchten.
Das Kapitel „vor leide tôt sein - Endstation Melancholie“ befasst sich mit der Endphase der Trauer und Melancholie in der Klage. Es analysiert die Figur des Königs Etzel und die Auswirkungen des Verlustes auf ihn. Die Arbeit untersucht auch das kollektive Klagen und die Bedeutung der Trauergemeinschaft in der Totenklage.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Totenklage, Trauer, Melancholie, Ritual, höfische Kultur, „Diu Klage“, Dietrich, Etzel, Hildebrant, Sigmund Freud, Hans-Georg Soeffner, Max Wehrli, Richard Leicher, mittelalterliche Literatur.
- Quote paper
- B.A. Anne-Marie Schmidt (Author), 2013, Das Klageritual im Nibelungenlied. Vom "verklagen" und "vor leide tôt sein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278554