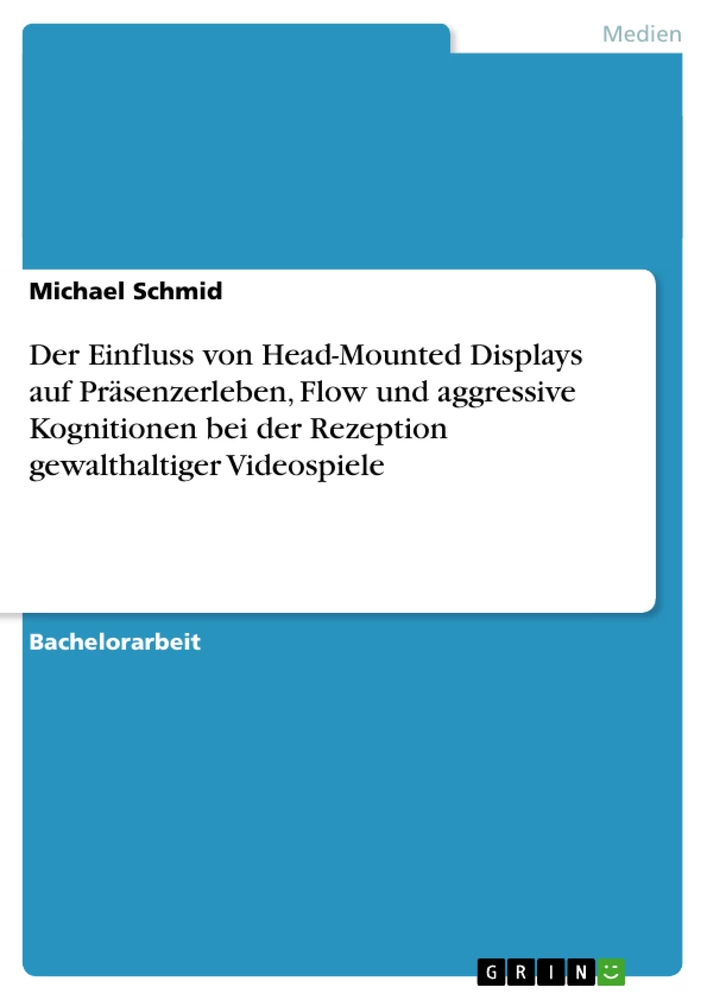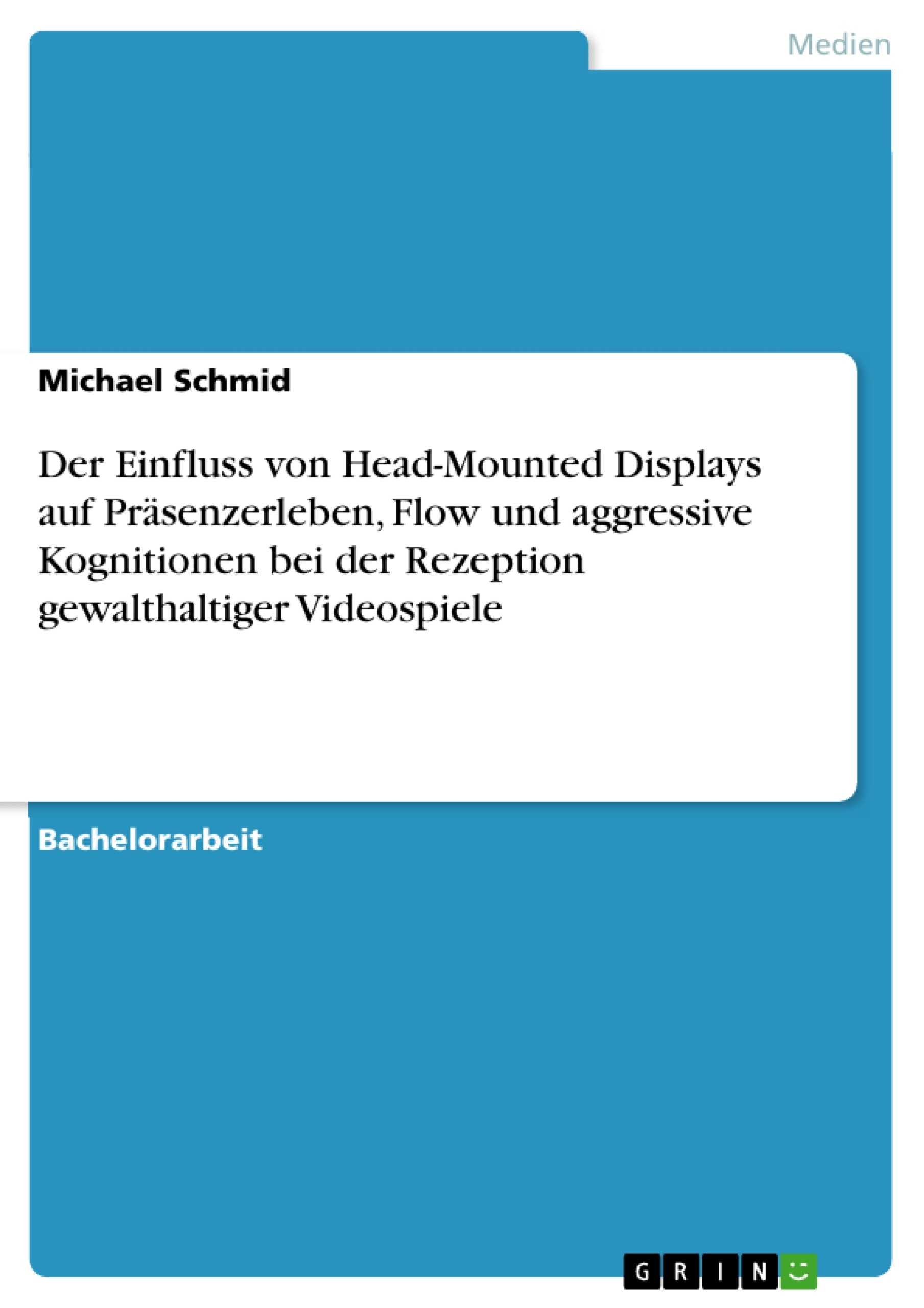Wurden Videospiele vor einigen Jahren sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich noch belächelt, haben sie ihr Nischendasein mittlerweile hinter sich gelassen. Die Umsätze stellen heute sogar die Filmindustrie in den Schatten (Lynch, 2013, o.S.; Kain, 2013, o.S.) und allein in Deutschland spielen rund 23 Millionen Menschen regelmäßig digitale Spiele, unabhängig von Alter, Bildung oder sozialer Schicht (BIU, 2011, S. 1). Die gespielten Titel unterscheiden sich dabei nicht nur hinsichtlich ihrer Genrezugehörigkeit und der Thematik, sondern auch erheblich in Aspekten wie Grafik, Spielmechanik und Steuerung. Trotz dieser Unterschiede lässt sich, zumindest bei erfolgreichen Spielen, eine grundlegende Gemeinsamkeit identifizieren: das Potenzial eine eigene virtuelle Welt zu kreieren und die Spielenden in diese Welt hineinzuziehen (Jennett et al., 2008, S. 4). Das komplette (mentale) Eintauchen in eine virtuelle Welt, wird als Immersion bezeichnet (Murray, 1997, S. 98f.) und kann durch Präsenzerleben (das Ge-fühl physisch im Spiel anwesend zu sein) und Flow-Erleben (das Gefühl, wenn eine Tätigkeit absolut glatt läuft und man alles um sich herum vergisst) erklärt werden. Da die Immersion im Allgemeinen eines der Hauptmotive für das Spielen von Videospielen ist (Yee, 2006, S. 344f.), versucht die Branche selbige fortwährend durch neue Technologien zu verbessern. An der Basis stehen dabei sogenannte Head-Mounted Displays (HMD). Diese brillenartigen Geräte ermöglichen es dem Spieler z.B. sich in der virtuellen Umgebung mit natürlichen Kopfbewegungen umzusehen, während alle anderen visuellen Reize der realen Welt ausgeblendet werden. Das Ergebnis ist ein Spielerlebnis, das von der Fachpresse gerne als revolutionär bezeichnet wird (Long, 2014, o.S.). Für die vorliegende Arbeit resultiert daraus zunächst die Frage, ob sich Präsenz- und Flow-Erleben bei Videospielen tatsächlich durch ein HMD beeinflussen bzw. im Vergleich zu einem herkömmlichen Computerbildschirm verstärken lassen.
Was aus Sicht der Spieler sicherlich zu begrüßen wäre, könnte allerdings auch Gefahren in sich bergen. Zwar werden Videospiele auch bei therapeutischen und medizinischen Behandlungen eingesetzt (Anderson & Warburton, 2012, S. 57f.), am Massenmarkt sind aber hauptsächlich gewalthaltige Spiele erfolgreich. So wird die Liste der weltweit meistverkauften Videospiele seit mehreren Jahren von Kriegs- und Gangstersimulationen angeführt (VGChartz, 2012, 2013, 2014, o.S.). Gleich ...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung.
- 2 Head-Mounted Displays.
- 2.1 Technische Aspekte.
- 2.2 Simulatorkrankheit.
- 3 Räumliches Präsenzerleben.
- 3.1 Theoretische Einordnung des räumlichen Präsenzerlebens.
- 3.2 Das Zwei-Ebenen-Modell zur Entstehung räumlichen Präsenzerlebens.
- 3.3 Faktoren mit Einfluss auf das Präsenzerleben
- 3.3.1 Die Lebendigkeit eines Mediums.
- 3.3.2 Die Interaktivität eines Mediums.
- 4 Flow-Erleben.
- 4.1 Theoretische Einordnung des Flow-Erlebens.
- 4.2 Der Flow-Kanal und das Experience Fluctuation Model.
- 4.3 Komponenten des Flow-Erlebens.
- 5 Gewalt in Videospielen.
- 5.1 Definitionen.
- 5.2 Virtuelle Gewalt in Videospielen aus wissenschaftlicher Perspektive.
- 5.3 Das General Aggression Model.
- 5.3.1 Videospielspezifische Faktoren und ihr Einfluss auf die Gewaltverarbeitung.
- 5.3.2 Auswirkungen des technischen Fortschritts.
- 6 Zusammenfassung und Ableitung der Hypothesen.
- 7 Methodische Umsetzung.
- 7.1 Erhebungsinstrument und Untersuchungsdesign.
- 7.2 Operationalisierung der unabhängigen Variablen.
- 7.2.1 Beschreibung der Versuchsbedingungen.
- 7.2.2 Beschreibung der technisches Equipments.
- 7.2.3 Auswahl und Beschreibung des Stimulusmaterials.
- 7.3 Operationalisierung der abhängigen Variablen und Entwicklung des Fragebogens.
- 7.4 Stichprobenauswahl und Durchführung des Experiments.
- 8 Auswertung und Ergebnisse.
- 8.1 Beschreibung der Stichprobe und Verteilung der Versuchsbedingungen.
- 8.2 Reliabilität der Skalen.
- 8.3 Überprüfung der Forschungshypothesen.
- 8.4 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse.
- 8.5 Kritische Diskussion methodischer Schwächen.
- 9 Fazit.
- Literaturverzeichnis.
- Anhang I: Fragebogen.
- Anhang II: Aufbau des Experiments.
- Anhang III: Ergebnis-Tabellen.
Abbildungsverzeichnis
- Abb. 1: Der Flow-Kanal.
- Abb. 2: Vereinfachte Darstellung des Experience Fluctuation Models.
- Abb. 3: Einfache Darstellung des General Aggression Models.
- Abb. 4: Die unabhängigen Variablen und ihre Ausprägungen.
- Abb. 5: Oculus Rift Development Kit 1 mit Kopfhörern.
- Abb. 6: Half Life 2.
- Abb. 7: Team Fortress 2.
Tabellenverzeichnis
- Tabelle 1: Darstellung der vier Versuchsbedingungen.
- Tabelle 2: Operationalisierung des räumlichen Präsenzerlebens.
- Tabelle 3: Operationalisierung des Flow-Erlebens.
- Tabelle 4: Zusammenstellung der aggressiven und doppeldeutigen Wörter für die Assoziationstests.
- Tabelle 5: Pearson-Korrelationen für Half Life 2.
- Tabelle 6: Pearson-Korrelation für Team Fortress 2.
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung AV abhängige Variable bzw. beziehungsweise df „degrees of freedom“, Freiheitsgrade (Statistik) ebd. ebenda ERF „,egocentric reference frame“, subjektiver Referenzrahmen et al. „,et alii“, und andere F Forschungsfrage GAM General Aggression Model H1 Hypothese 1 H2 Hypothese 2 H3 Hypothese 3 HMD Head-Mounted Display N Umfang der Stichprobe (Statistik) p p-Wert, Signifikanzniveau (Statistik) PERF „primary egocentric reference frame“, primärer subjektiver Refrenzrahmen S. Seite t T-Wert (Statistik) u.a. unter anderem usw. und so weiter UV unabhängige Variable vgl. vergleiche X Mittelwert (Statistik) z.B. zum Beispiel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Head-Mounted Displays (HMDs) auf das Präsenzerleben, Flow-Erleben und aggressive Kognitionen bei der Rezeption gewalthaltiger Videospiele. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser neuen Technologie auf die Spielerfahrung zu untersuchen und die Frage zu klären, ob HMDs das Präsenzerleben und Flow-Erleben verstärken und gleichzeitig aggressive Kognitionen fördern. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Studie, die die Auswirkungen von HMDs auf die genannten Variablen in verschiedenen Versuchsbedingungen untersucht.
- Räumliches Präsenzerleben und die Rolle von HMDs.
- Flow-Erleben und die Einflussfaktoren von HMDs.
- Aggressive Kognitionen und die potenziellen Auswirkungen von HMDs.
- Die Interaktion von Präsenzerleben, Flow-Erleben und aggressiven Kognitionen im Kontext von Videospielen.
- Die Bedeutung von HMDs für die Zukunft der Videospielindustrie.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Head-Mounted Displays (HMDs) im Kontext von Videospielen dar. Sie erläutert die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Funktionsweise von HMDs und die damit verbundenen technischen Aspekte. Es beleuchtet auch die Problematik der Simulatorkrankheit, die bei der Nutzung von HMDs auftreten kann.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept des räumlichen Präsenzerlebens. Es werden verschiedene theoretische Modelle zur Entstehung von Präsenzerleben vorgestellt, insbesondere das Zwei-Ebenen-Modell. Die Bedeutung von Faktoren wie Lebendigkeit und Interaktivität für das Präsenzerleben wird diskutiert.
Kapitel 4 widmet sich dem Flow-Erleben. Es werden die theoretischen Grundlagen des Flow-Erlebens erläutert, insbesondere das Konzept des Flow-Kanals und das Experience Fluctuation Model. Die Komponenten des Flow-Erlebens werden vorgestellt und ihre Bedeutung für die Spielerfahrung hervorgehoben.
Kapitel 5 behandelt das Thema Gewalt in Videospielen. Es werden verschiedene Definitionen von Gewalt vorgestellt und die wissenschaftliche Perspektive auf virtuelle Gewalt in Videospielen beleuchtet. Das General Aggression Model wird als theoretischer Rahmen für die Untersuchung der Auswirkungen von Videospielgewalt auf aggressive Kognitionen vorgestellt.
Kapitel 7 beschreibt die methodische Umsetzung der empirischen Studie. Es werden das Erhebungsinstrument, das Untersuchungsdesign, die Operationalisierung der Variablen und die Stichprobenauswahl erläutert. Die Versuchsbedingungen und das technische Equipment werden detailliert beschrieben.
Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie. Es werden die Stichprobe und die Verteilung der Versuchsbedingungen beschrieben. Die Reliabilität der Skalen wird geprüft und die Forschungshypothesen werden anhand der erhobenen Daten überprüft. Die Ergebnisse werden zusammengefasst und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Head-Mounted Displays (HMDs), Präsenzerleben, Flow-Erleben, aggressive Kognitionen, Videospiele, Gewalt, Simulatorkrankheit, Zwei-Ebenen-Modell, Experience Fluctuation Model, General Aggression Model, empirische Studie, Versuchsdesign, Operationalisierung, Stichprobenauswahl, Ergebnisse, Interpretation, methodische Schwächen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Head-Mounted Display (HMD)?
Ein HMD ist ein brillenartiges Gerät (VR-Brille), das visuelle Reize der realen Welt ausblendet und es Spielern ermöglicht, durch Kopfbewegungen in einer virtuellen Umgebung zu navigieren.
Wie beeinflussen HMDs das Präsenzerleben?
Durch die hohe Immersion und Interaktivität verstärken HMDs das Gefühl, physisch in der virtuellen Welt anwesend zu sein (räumliche Präsenz).
Was versteht man unter Flow-Erleben bei Videospielen?
Flow-Erleben beschreibt den Zustand, in dem ein Spieler völlig in einer Tätigkeit aufgeht, die Zeit vergisst und eine optimale Balance zwischen Herausforderung und Fähigkeit erlebt.
Fördert VR-Technologie aggressive Kognitionen?
Die Arbeit untersucht anhand des General Aggression Models (GAM), ob die gesteigerte Immersion durch HMDs bei gewalthaltigen Spielen zu einer stärkeren Aktivierung aggressiver Gedanken führt.
Was ist die Simulatorkrankheit?
Die Simulatorkrankheit (Motion Sickness) ist ein Übelkeitsgefühl, das entstehen kann, wenn die visuelle Wahrnehmung im HMD nicht mit den physischen Bewegungen des Körpers übereinstimmt.
- Citar trabajo
- Michael Schmid (Autor), 2014, Der Einfluss von Head-Mounted Displays auf Präsenzerleben, Flow und aggressive Kognitionen bei der Rezeption gewalthaltiger Videospiele, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278631