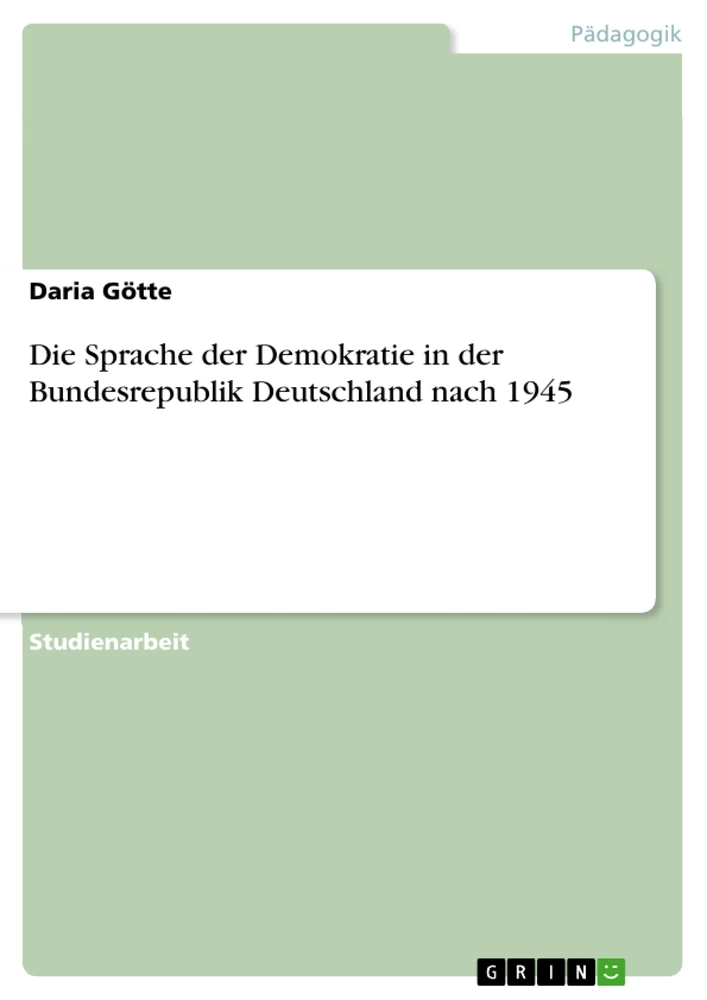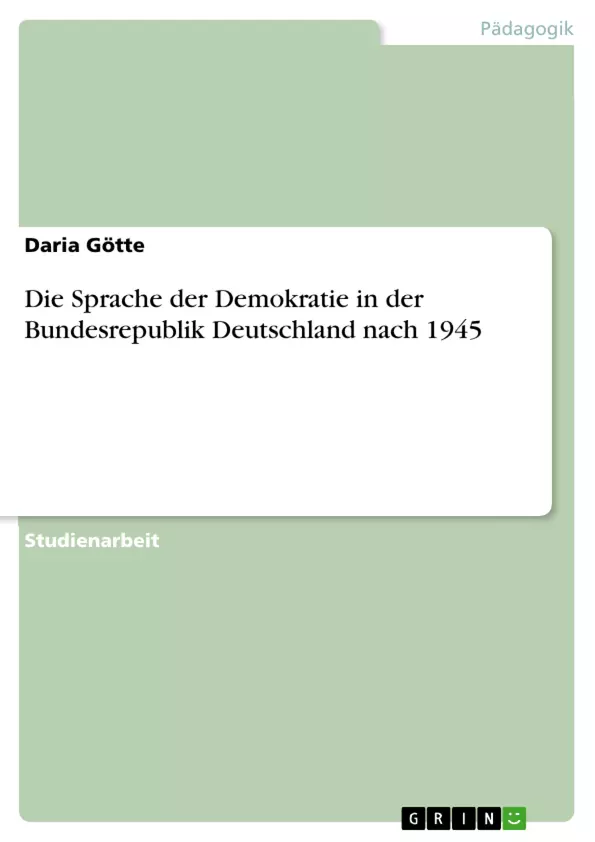Manch einer wird behaupten, dass mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine neue Ära begann: der Krieg war vorüber, es herrschte wieder Demokratie, die Menschen waren erneut alle gleich vor dem Gesetz. Dem könnte man entgegnen, dass es Demokratie schon im alten Athen gab und behaupten, dass die Demokratie lediglich wiederaufgenommen wurde. Genau mit diesem umstrittenen Thema befasst sich diese Hausarbeit: Demokratie zwischen Tradition und Neuanfang, unter einem besonderen Blickpunkt auf die Veränderungen in der Sprache. Das Verständnis des Begriffes Demokratie nach 1945 wird ebenfalls näher erläutert. Unter Demokratie versteht man Volksherrschaft, d.h. eine Regierungsform, in der das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat. Nach 1945 wird die Demokratie mehr als nur eine Regierungsform; „democracy is a way of life“ (Dewey 1939/1993: 229, zit. n. Geißner 2005: 59) – sie entwickelt sich zu einer Lebensform. Unter Berücksichtigung historischer, sprachlicher, politischer und gesellschaftlicher Aspekte beschäftigt sich folgende Ausarbeitung mit folgenden Fragen: Kann man die Demokratie in der Paulskirche mit unserer heutigen Regierungsform vergleichen? Inwiefern haben sich die sprachlichen Aspekte im Laufe der Jahrhunderte gewandelt? Wie hat sich die Politik hinsichtlich der Sprache verändert?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sprache der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
- Die Sprache der Politik
- Die Sprache der Medien
- Die Sprache der Gesellschaft
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Sprache der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Sie analysiert, wie sich die Sprache der Politik, der Medien und der Gesellschaft im Laufe der Zeit entwickelt hat und welche Rolle sie für die Stabilität und Entwicklung der Demokratie spielt.
- Die Entwicklung der politischen Sprache
- Die Rolle der Medien in der Demokratie
- Die Sprache der Bürgergesellschaft
- Die Herausforderungen der Demokratie in der heutigen Zeit
- Die Bedeutung der Sprache für die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Methodik dar. Das erste Kapitel analysiert die Sprache der Politik in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Es werden die wichtigsten politischen Akteure und ihre Sprachformen untersucht, sowie die Entwicklung der politischen Sprache im Laufe der Zeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rolle der Medien in der Demokratie. Es werden die verschiedenen Medienformen und ihre Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung untersucht, sowie die Herausforderungen, die sich aus der medialen Berichterstattung für die Demokratie ergeben. Das dritte Kapitel analysiert die Sprache der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Es werden die verschiedenen Sprachformen der Bürgergesellschaft untersucht, sowie die Rolle der Sprache für die soziale Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Sprache der Demokratie, die Bundesrepublik Deutschland, die politische Sprache, die Mediensprache, die Sprache der Gesellschaft, die Entwicklung der Demokratie, die Herausforderungen der Demokratie, die Bedeutung der Sprache für die Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Begriff „Demokratie“ nach 1945 gewandelt?
Nach 1945 wurde Demokratie in Deutschland nicht mehr nur als Regierungsform, sondern zunehmend als „way of life“ – also als umfassende Lebensform – verstanden, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt.
Welche Rolle spielt die Sprache für die Stabilität der Demokratie?
Die Sprache dient als Werkzeug der politischen Auseinandersetzung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Ein transparenter und inklusiver Sprachgebrauch ist essenziell für das Vertrauen der Bürger in demokratische Prozesse.
Inwiefern beeinflussen die Medien die Sprache der Demokratie?
Medien fungieren als Vermittler zwischen Politik und Gesellschaft. Ihre Sprachform prägt die öffentliche Meinungsbildung und kann entweder zur Aufklärung beitragen oder durch spezifische Framings politische Debatten beeinflussen.
Gibt es Unterschiede zwischen der Paulskirchen-Demokratie und der heutigen Form?
Die Arbeit untersucht die Traditionen und Neuanfänge. Während die Paulskirche wichtige Grundlagen legte, zeichnet sich die heutige Demokratie durch eine stärkere sprachliche und gesellschaftliche Einbindung der gesamten Bürgergesellschaft aus.
Was versteht man unter der „Sprache der Bürgergesellschaft“?
Es handelt sich um die Ausdrucksformen, mit denen Bürger ihre Interessen artikulieren und am politischen Diskurs teilnehmen. Diese Sprache hat sich nach 1945 hin zu mehr Partizipation und sozialer Integration entwickelt.
- Quote paper
- Daria Götte (Author), 2009, Die Sprache der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278636