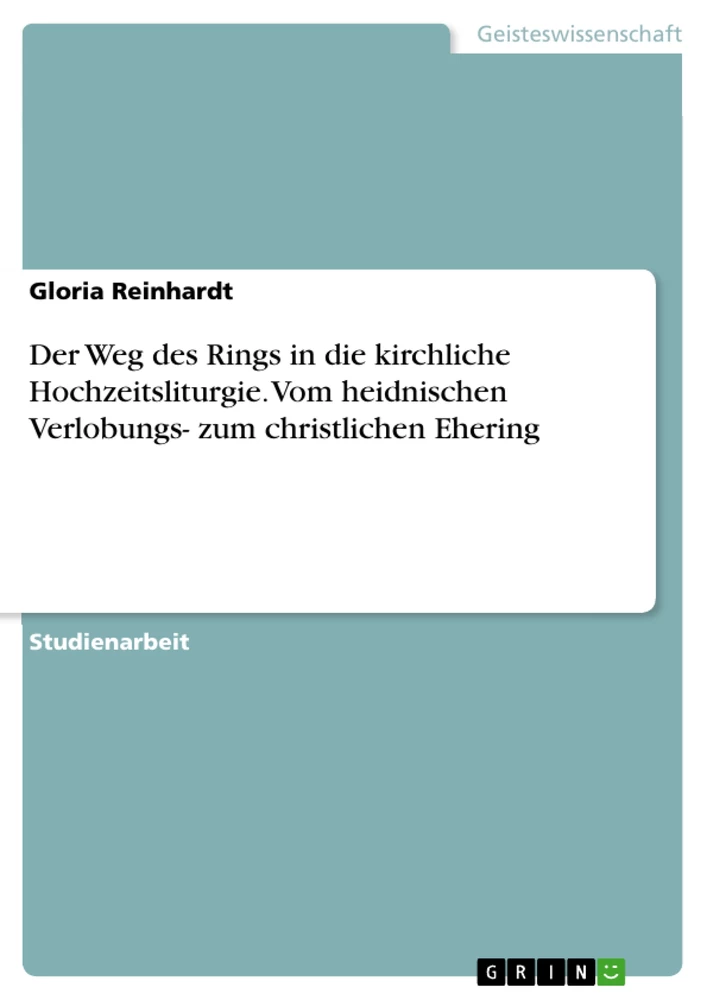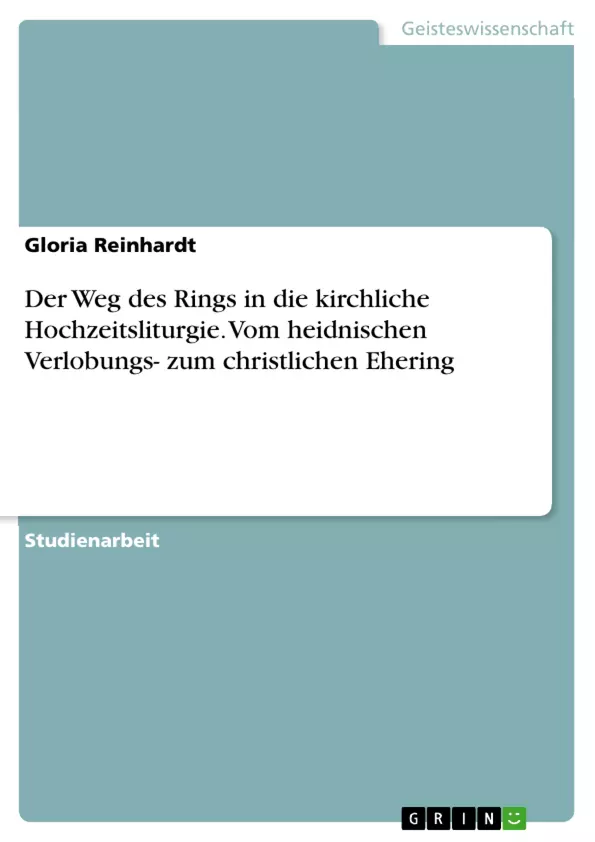Obwohl der Ringwechsel seinen festen Platz in der Liturgie des Trauungsgottesdienstes hat und sich der Verlobungs- bzw. der Ehering durch die christliche Kirche im Abendland verbreitete, ist er nicht christlichen Ursprungs. Der Ring als Treuesymbol findet keine Erwähnung in der Heiligen Schrift, obwohl die Kirche die Ehe in Analogie besonders zum Neuen Bund zwischen Jesus Christus und der Kirche als seiner Braut stellt. Der Ehering ist ein Beispiel dafür, dass die Kirche weltlich-lokale Volksbräuche und -riten in ihre Liturgie aufnahm und diese kanonisierte. So hat auch der Ring innerhalb des kirchlichen Hochzeitsritus seine eigene Geschichte, die unabhängig vom Christentum beginnt. Da im Laufe der Geschichte die westliche und östliche Kirche ihre eigene Ordnung aufbauen und sie sich mit der Völkerwanderung und der Vermischung von romanisch-lateinischer und germanischer Kultur auch in Bezug auf die Feier der Trauung eigenständig entwickeln, ist es sinnvoll die West- und die Ostkirche getrennt voneinander zu betrachten. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird im Folgenden die Entwicklung des Verlobungs- bzw. Eherings allein in der römisch-katholischen Kirche dargestellt. Im Vergleich mit dem Alten und Neuen Testament wird aufgezeigt, dass der Ring in seiner heutigen Bedeutung für die Ehe nicht aus biblischen, ferner urchristlichen Zeiten stammt, sondern sein Ursprung im antiken Rom auszumachen ist.
Ziel ist es, die Geschichte des Eheringes zu skizzieren und seine Aufnahme in den kirchlichen Hochzeitsritus zu erläutern. Dazu ist es notwendig, die Entwicklung des Eherechts zu behandeln. Neben liturgiewissenschaftlichen Beiträgen, wie von Korbian Ritzer, der sich intensiv mit den Bräuchen der frühen Christen beschäftigt, und Artikeln aus rechtsgeschichtlichen Nachschlagewerken wird vor allem die Dissertation von Manfred Mühl herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eheschließungen im Alten und Neuen Testament
- Der Alte und der Neue Bund als Vorbild für das christliche Eheverständnis
- Die Rolle von Schmuck in der Bibel
- Parallelen zwischen biblischem und römischen Eherecht der Antike und der Ursprung des Verlobungsrings
- Einsegnung der Ehe in der Kirche Roms ab dem 4. Jahrhundert
- Vom Verlobungs- zum Ehering – Entwicklung einer Hochzeitsliturgie
- Die Verlegung der Trauung in die Kirche
- Der Ring als fester Bestandteil der Hochzeitsliturgie
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung des Eherings und seine Integration in die kirchliche Hochzeitsliturgie zu untersuchen. Es wird der Weg vom heidnischen Verlobungs- zum christlichen Ehering nachgezeichnet, wobei der Fokus auf der römisch-katholischen Kirche liegt. Die Arbeit vergleicht dabei biblische und antike römische Eherechtsvorstellungen mit der Entwicklung des Rings als Symbol der Ehe.
- Der Ehering als kulturelles und religiöses Symbol
- Die Entwicklung des Eherechts im Alten und Neuen Testament
- Der Einfluss des antiken römischen Rechts auf die Eheringtradition
- Die Integration des Eherings in die Liturgie der römisch-katholischen Kirche
- Die Entwicklung der Hochzeitsliturgie im Laufe der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Eherings als Symbol für eheliche Treue und Liebe ein. Sie betont die weit verbreitete Praxis des Ringtausches bei Eheschließungen und den kulturellen und religiösen Wert des Rings. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die heutige Bedeutung des Rings eine Entwicklung über Jahrtausende darstellt, deren Ursprung nicht im Christentum selbst liegt, und dass die Arbeit sich auf die römisch-katholische Tradition konzentrieren wird. Die Ziele der Arbeit – die Skizzierung der Geschichte des Eherings und seiner Aufnahme in den kirchlichen Hochzeitsritus – werden klar formuliert.
Eheschließungen im Alten und Neuen Testament: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Ehe im Alten Testament, ausgehend vom Deuteronomium als Grundlage des Familienrechts. Es analysiert verschiedene Aspekte wie Erbfolgerecht, Umgang mit vorehelichem Geschlechtsverkehr und Scheidung. Der patriarchalische Charakter der Ehe, die Sippenstruktur und die Rolle des Brautpreises werden erläutert, wobei Beispiele aus dem Buch Genesis und Tobit herangezogen werden. Die Rolle des Mannes in der Entscheidung über die Heirat und die Bedeutung des Brautpreises im Kontext von Exogamie und der Versorgung der Frau werden ausführlich dargestellt. Das Kapitel zeigt die Unterschiede zwischen den rechtlichen Aspekten der Ehe im Alten Testament und der modernen Auffassung auf.
Schlüsselwörter
Ehering, Hochzeitsliturgie, Eheverständnis, Altes Testament, Neues Testament, Römisches Recht, Kirchliche Trauung, Treue, Symbol, Antike, Bibel, Kanonisierung, Volksbräuche, Liturgiewissenschaft, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Abhandlung: "Die Entwicklung des Eherings und seine Integration in die kirchliche Hochzeitsliturgie"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Eherings und seine Integration in die kirchliche Hochzeitsliturgie der römisch-katholischen Kirche. Sie verfolgt den Weg vom heidnischen Verlobungs- zum christlichen Ehering und vergleicht biblische und antike römische Eherechtsvorstellungen mit der Entwicklung des Rings als Symbol der Ehe.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Ehering als kulturelles und religiöses Symbol, die Entwicklung des Eherechts im Alten und Neuen Testament, den Einfluss des antiken römischen Rechts, die Integration des Eherings in die Liturgie der römisch-katholischen Kirche und die Entwicklung der Hochzeitsliturgie im Laufe der Geschichte. Die Arbeit analysiert auch die Rolle von Schmuck in der Bibel und Parallelen zwischen biblischem und römischem Eherecht der Antike.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über Eheschließungen im Alten und Neuen Testament, ein Kapitel über den Alten und Neuen Bund als Vorbild für das christliche Eheverständnis, ein Kapitel über die Rolle von Schmuck in der Bibel, ein Kapitel über Parallelen zwischen biblischem und römischem Eherecht und den Ursprung des Verlobungsrings, ein Kapitel über die Einsegnung der Ehe in der Kirche Roms ab dem 4. Jahrhundert, ein Kapitel über die Entwicklung vom Verlobungs- zum Ehering (inkl. Unterkapiteln zur Verlegung der Trauung in die Kirche und dem Ring als festen Bestandteil der Liturgie) und eine Schlussfolgerung.
Wie wird die Entwicklung des Eherings dargestellt?
Die Arbeit zeichnet den Weg vom heidnischen Verlobungs- zum christlichen Ehering nach. Sie analysiert die rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Ehe im Alten Testament, untersucht den Einfluss des antiken römischen Rechts auf die Eheringtradition und beschreibt die Integration des Eherings in die Liturgie der römisch-katholischen Kirche im Laufe der Geschichte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf das Alte und Neue Testament, das römische Recht und die Entwicklung der kirchlichen Hochzeitsliturgie. Genauer wird in der Zusammenfassung zu den Kapiteln auf Quellen wie das Deuteronomium, das Buch Genesis und Tobit Bezug genommen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ehering, Hochzeitsliturgie, Eheverständnis, Altes Testament, Neues Testament, Römisches Recht, Kirchliche Trauung, Treue, Symbol, Antike, Bibel, Kanonisierung, Volksbräuche, Liturgiewissenschaft, Rechtsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Personen bestimmt, die sich für die Geschichte des Eherings, die Entwicklung des Eherechts und die Hochzeitsliturgie interessieren. Sie richtet sich insbesondere an ein akademisches Publikum.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf der römisch-katholischen Tradition und der Entwicklung des Eherings innerhalb dieser Tradition.
- Citation du texte
- Gloria Reinhardt (Auteur), 2014, Der Weg des Rings in die kirchliche Hochzeitsliturgie. Vom heidnischen Verlobungs- zum christlichen Ehering, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278646