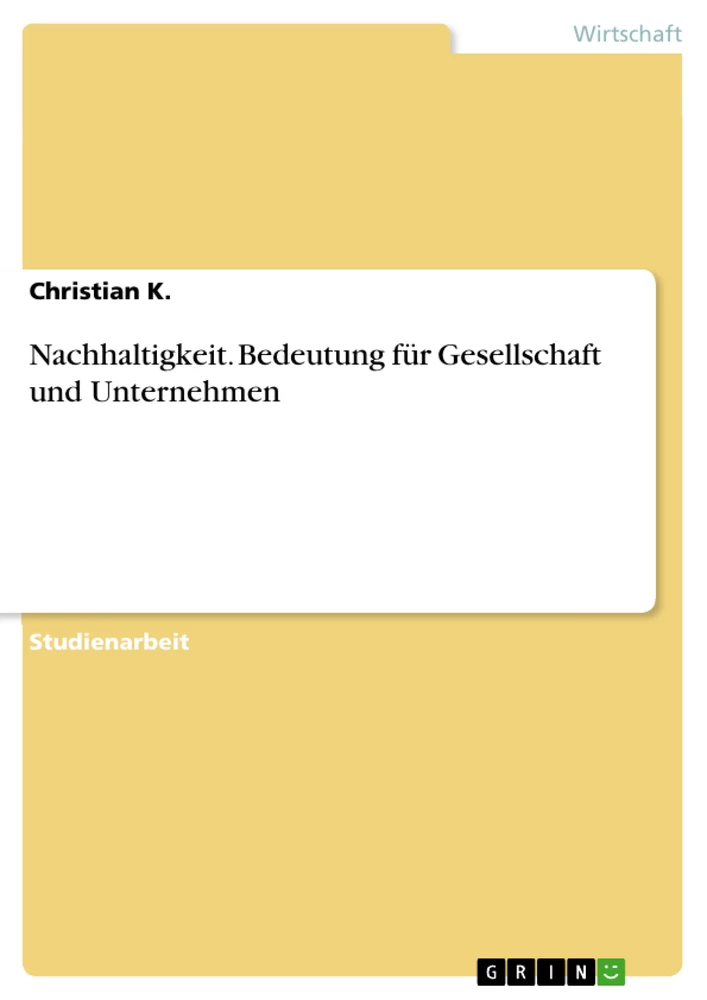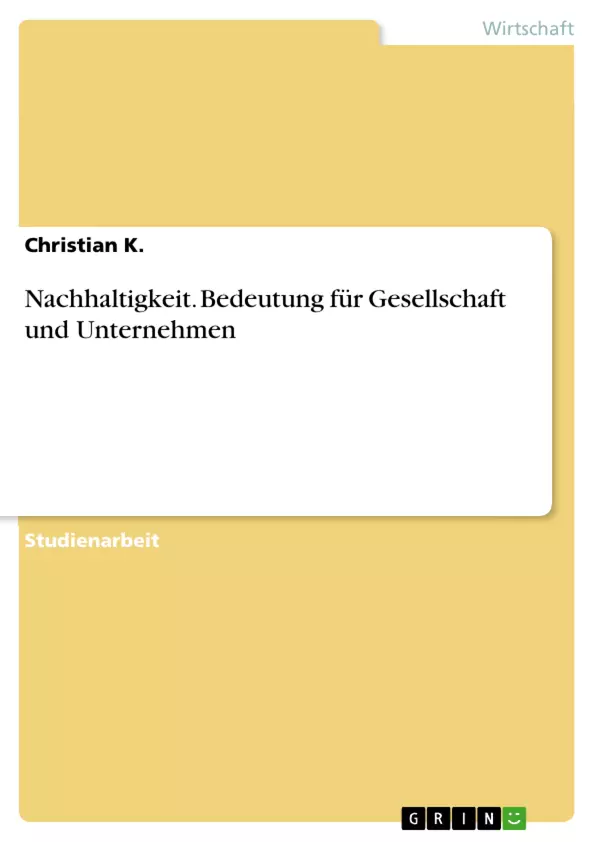Kein Begriff der vergangenen Jahrzehnte hat einen ähnlich rasanten Aufstieg erlebt, wie der Begriff der Nachhaltigkeit. Dabei hat die Nachhaltigkeit viele Gesichter und befasst sich seit ihrer erstmaligen Benennung Anfang des 18. Jahrhunderts mit weitaus mehr Themen als der ausschließlich ökologischen Betrachtung. Ausgangspunkt für einen breiten öffentlichen Diskurs war nicht zuletzt, die durch den Club of Rome im Jahr 1972 in Auftrag gegebene und publizierte Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft unter dem Titel "The Limits to Growth". Deren Schlussfolgerung war, dass bei einer gleichbleibenden Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen, die absoluten Wachstumsgrenzen der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht sein würden. Was es bedeutet, die Grenzen des Wachstums zu überschreiten, musste bereits die auf der Osterinsel im Südostpazifik beheimatete Hochkultur der Rapa Nui feststellen. Deren Bevölkerung befand sich, aufgrund ihrer übermäßigen Beanspruchung der durch das geschlossene Ökosystem zur Verfügung gestellten Ressourcen, am Rande des Aussterbens. Die zurückliegenden Jahre zeigen, dass die nachhaltige Entwicklung nicht nur ein zunehmendes Interesse seitens der Politik, Wissenschaft und Gesellschaft erfährt. Sie erhält auch branchenübergreifend Eingang in die unternehmerische Praxis und der langfristigen strategischen Ausrichtung verschiedenartiger Unternehmen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Gesellschaft und die Unternehmen herauszustellen. Dazu wird in den ersten drei Kapiteln zunächst ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffes und dessen verschiedenen Dimensionen gegeben. Im 4. Kapitel wird der Begriff der nachhaltigen Ökonomie ausführlicher behandelt. Das 5. Kapitel befasst sich mit der unternehmerischen Sicht auf das Thema Nachhaltigkeit. Das inhaltlich letzte Kapitel umfasst eine ausführliche Darstellung des nachhaltigen Konsums.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Nachhaltigkeit
- 2.1 Ursprung der Nachhaltigkeitstheorie
- 2.2 Politische Entwicklung der Nachhaltigkeitstheorie
- 3. Die Dimensionen der Nachhaltigkeit
- 3.1 Das Drei-Säulen-Modell
- 3.2 Starke und Schwache Nachhaltigkeit
- 3.3 Kritik am Drei-Säulen-Modell
- 4. Nachhaltige Ökonomie
- 5. Nachhaltigkeit im Unternehmen
- 5.1 Wettbewerbsstrategische Gründe für nachhaltiges Unternehmenshandeln
- 5.2 Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement
- 6. Nachhaltiger Konsum
- 7. Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und untersucht dessen Bedeutung für die Gesellschaft und Unternehmen. Sie verfolgt das Ziel, die geschichtliche Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffes und dessen verschiedene Dimensionen aufzuzeigen. Darüber hinaus werden die nachhaltige Ökonomie, die unternehmerische Sicht auf Nachhaltigkeit und der nachhaltige Konsum beleuchtet.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffes
- Dimensionen der Nachhaltigkeit
- Nachhaltige Ökonomie
- Nachhaltigkeit im Unternehmen
- Nachhaltiger Konsum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Nachhaltigkeit ein und beleuchtet die Bedeutung des Begriffs in der heutigen Zeit. Sie stellt die Relevanz der Nachhaltigkeit für die Gesellschaft und Unternehmen heraus und gibt einen Überblick über die Inhalte der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Nachhaltigkeitstheorie. Es beleuchtet den Ursprung der Nachhaltigkeitstheorie und die politische Entwicklung des Begriffs.
Das dritte Kapitel widmet sich den Dimensionen der Nachhaltigkeit. Es analysiert das Drei-Säulen-Modell, die Unterscheidung zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit und die Kritik am Drei-Säulen-Modell.
Das vierte Kapitel behandelt die nachhaltige Ökonomie. Es untersucht die Konzepte und Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der unternehmerischen Sicht auf Nachhaltigkeit. Es analysiert die wettbewerbsstrategischen Gründe für nachhaltiges Unternehmenshandeln und beleuchtet das strategische Nachhaltigkeitsmanagement.
Das sechste Kapitel widmet sich dem nachhaltigen Konsum. Es untersucht die Bedeutung des Konsums für die Nachhaltigkeit und die Möglichkeiten, den Konsum nachhaltiger zu gestalten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsbegriff, Nachhaltigkeitsentwicklung, Nachhaltige Ökonomie, Nachhaltiges Unternehmenshandeln, Nachhaltiger Konsum, Drei-Säulen-Modell, Starke und Schwache Nachhaltigkeit, Wettbewerbsstrategien, Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement.
- Quote paper
- Christian K. (Author), 2014, Nachhaltigkeit. Bedeutung für Gesellschaft und Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278680