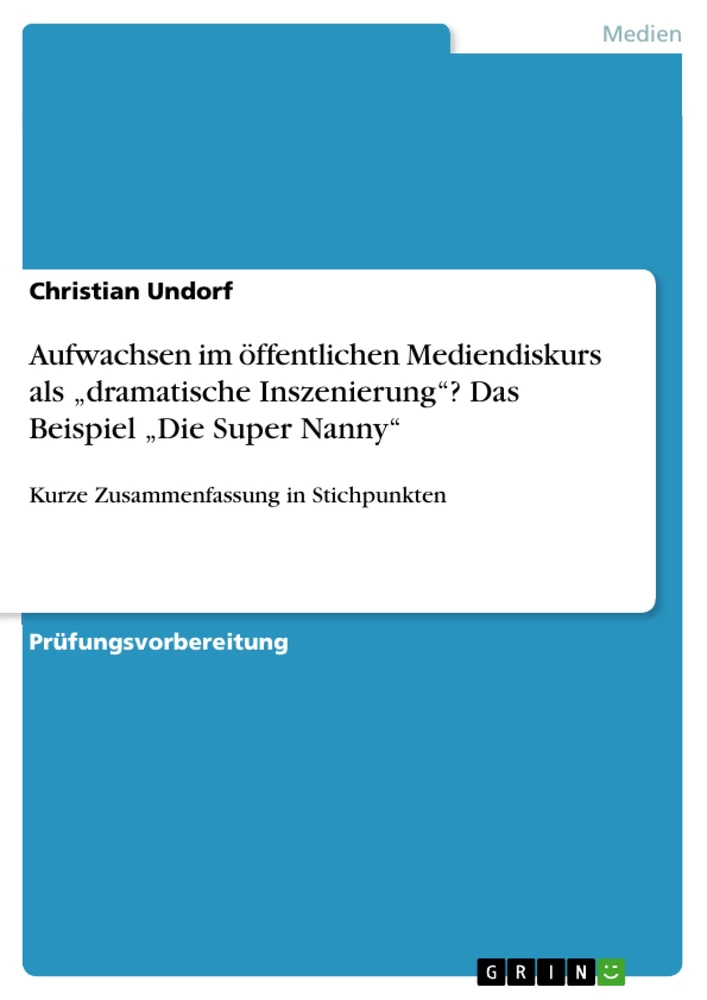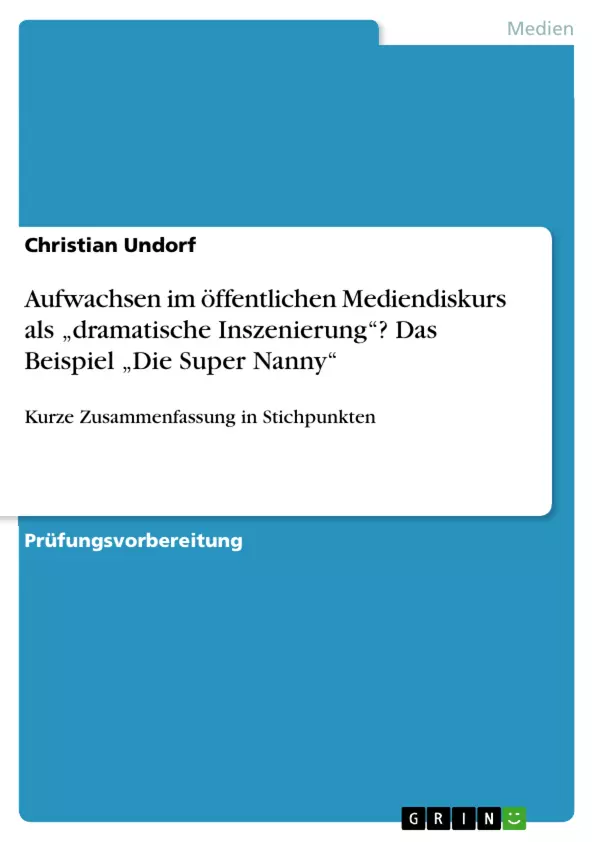Das Beispiel „Die Super Nanny“ vor dem Hintergrund der Frage: Aufwachsen im öffentlichen Mediendiskurs als „dramatische Inszenierung“? Ein kurzer Überblick in Stichpunkten.
Inhaltsverzeichnis
- Das Format ,,Die Super Nanny"
- Umstrittene Unterhaltungssendung im Charakter des Reality-TV, durchschnittlich 2-5 Mio. Zuschauer; Adaption des brit. Originals; weitere Ableger in Österreich, USA, Polen, Australien, Brasilien, Frankreich, Spanien & Niederlanden
- Serie begleitet Diplompädagogin Katharina Saalfrank bei einwöchigen Besuchen in Familien, die Sorgen mit dem Nachwuchs haben → agiert im Muster der Familienhilfe
- RTL-Pressemappe über Saalfrank: „Ihre Erziehungsmaxime lautet: Streng aber gerecht. Sie sagt:,Kinder brauchen strikte Tagesabläufe und Regeln. Eine konsequente Erziehung mit festen Strukturen hilft Kindern und Eltern, macht aus kleinen Quälgeistern liebenswerte Sonnenscheine und verhilft gestressten Eltern zu einem harmonischen Familienleben.""
- Diskurs wird außerhalb der Sendung weitergeführt: Internet, Merchandising, Erziehungsratgeber in Buchform zur Sendung, ähnliche Formate in Senderfamilie
- Die mediale Inszenierung der (Familien-)Erziehung bei der „,Super Nanny"
- Weitere Merkmale/Auffälligkeiten der medialen Umsetzung:
- Schwarz-Weiß-Dramaturgie, besonders im Trailer und Teaser
- Genre des Affektfernsehens/ungezügelte Emotionalität
- zumeist kurze Sequenzen und schnelle Schnitte, Zusammenhänge werden erst durch Sprecher verständlich → Manipulation?/verzerrter Eindruck?
- Stimmungen werden mit Mitteln des Bildschnitts, der Lichtregie, Musikuntermalung etc. gezielt „in Szene gesetzt" → mediale Dramatisierung
- Problematik der isolierten Familiendarstellung
- Sendung bedient/nährt Hoffnung auf Sicherheit und überschaubaren Erfolg durch Konzentration auf eigenen, begrenzten Raum (Bild des „Einzelkämpfers“) → Privatisierung sowie Ausblendung der sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge
- Frage nach Einfluss bzw. Beeinflussung durch Produzenten der Sendung auf die Arbeit des Erziehungshelfers
- Ein Blick in das Buch zur Sendung:,,Die Super Nanny - Glückliche Kinder brauchen starke Eltern"
- Form der Ansprache: kurze, leicht verständliche Sätze; Autorin als einfühlsamer Mentor; überwiegende Verwendung des Imperativs; rhetorische Fragen; reich bebildert und buntes, dynamisches Layout → auch das klassische Buch zur Sendung setzt auf sehr viele visuelle Reize
- Auffällig: Im Gegensatz zum TV-Format verhält sich das Buch eher „bescheiden“ (geringe Verbindlichkeit); außerdem werden der eigenen Kindheitsreflexion der Eltern und externen Beratungsangeboten großen Stellenwert eingeräumt.
- Gemeinsamkeit: Wissen nicht disziplinär geordnet, sondern vor allem am Erfolg orientiert
- Anschließende Überlegungen
- Ohne Ratgeber keine Erziehung? - Der pädagogische Diskurs als ,,Entmündigungsdiskurs"?
- Medienkompetenz der Beteiligten?
- Sendung präsentiert Erfolgsgeschichten/suggeriert rasche Machbarkeit (Nachhaltigkeit?) → pädagogische Interventionen als Heilmittel?
- Diskussion: Fügt sich die Super Nanny in einen in den letzten Jahren zunehmenden Diskussionstrend über eine Rückkehr zur autoritär-direktiv geführten Erziehung, wie zuletzt besonders entschieden gefordert von Bueb?
- Bünder: Konsum- & Mediengesellschaft erst mit ein Grund dafür, dass sich Heranwachsende heute mehr und mehr zu selbstbewussten und fordernden Interaktionspartnern entwickeln und sich daher nicht mehr so einfach und widerspruchsfrei lenken lassen
- Anhang: Die öffentliche Kontroverse zur Sendung
- Positiv bewertete Aspekte
- Studie der Universität Wien:
- Propagierter Erziehungsstil überwiegend demokratisch geprägt
- 24% der Szenen: ,,selbstbewusstes Agieren vor dem Kind"
- 18% der Szenen: ,,liebevoller Umgang mit dem Kind"
- Zuschauermotivation entspringe in erster Linie einem Orientierungsbedürfnis
- Enttabuisierung gesellschaftl. Missstände (Bsp.: häusliche Gewalt, Sendung vom 29.11.06)
- Sendung fördere eigene Bereitschaft, Kinder zu bekommen
- weitere, oft genannte These: „Die Super Nanny" mache das Thema Erziehung wieder populär und trage zur öffentlichen Diskussion über Erziehung bei
- zudem ist das Fernsehen nach wie vor meist genutztes Informationsmedium, das viele Menschen erreicht → niederschwelliges Beratungsangebot?
- Negativ bewertete Aspekte
- Studie der Universität Wien (2006):
- hauptsächliche Verwendung der Mütter als Adressaten der Ratschläge → spiegle zwar gesellschaftl. Verhältnisse wieder, lasse aber Potentiale einer demokrat. Erziehungskultur unausgeschöpft
- Deutscher Kinderschutzbund:
- simple Dramaturgie: zunächst hochgradig negativ besetzt (Mutter scheinbar ohne Kompetenzen, Kind ohne guten Seiten) - schließlich die Lösung
- verzerrter Eindruck durch geraffte Darstellung (ca. 45 Min. Nettosendezeit)
- isolierte Familiendarstellung, reduziert auf Binnenleben
- Gefahr der langfristigen Stigmatisierung der beteiligten Familie bzw. vor allem der Kinder
- Jan-Uwe Rogge:
- negative Vorführung und Entmündigung der Erziehenden in passiver Objektrolle (i.d.R. nur reaktiv), mehr ,,Dressur" als Erziehung → vermittle „Machbarkeitswahn der Pädagogik"
- Prof. Peter Bünder, FH Düsseldorf
- Eltern als „Befehlsempfänger“ ohne aktiv gestaltende Rolle; Mangel an Dialog & Reflexion → instruktive Kommunikation
- „medial gesponserte Gehorsamkeitserziehung“
- weitere kritisierte Aspekte:
- Regeln & Struktur würden in der Sendung dirigistisch von Außen vorgegeben; Postulate sollen von teilnehmenden Familien vorbehaltlos übernommen werden; Verhaltenstechniken würden verabsolutiert
- Kinder wie Eltern würden in Off-Kommentaren des Sprechers sowie O-Tönen der Super Nanny (Stilmittel des Formats) nicht selten diskriminiert
- Rahmenbedingungen der Familie spielen keine Rolle, sofern sie nicht den Unterhaltungswert steigern → keine Ressourcenorientierung
- Mediale Inszenierung von Erziehung
- Kritik an der Sendung und deren Einfluss
- Öffentlicher Diskurs über Erziehung
- Familienhilfe und Erziehungsberatung
- Medienkompetenz und Medienkritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Fernsehsendung „Die Super Nanny“ als Beispiel für die mediale Inszenierung von Erziehung im öffentlichen Diskurs. Sie untersucht, wie die Sendung das Problem der Überforderung von Eltern und Erziehern darstellt und welche Lösungsansätze sie präsentiert. Dabei werden die medialen Mittel der Inszenierung, die Auswirkungen auf die Familien und die öffentliche Kontroverse um die Sendung beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Beschreibung des Formats „Die Super Nanny“ und seiner Verbreitung. Sie beleuchtet die Rolle der Diplompädagogin Katharina Saalfrank und die von RTL propagierte Erziehungsmaxime. Anschließend wird die mediale Inszenierung der Sendung analysiert, wobei die Dramaturgie, die Emotionalität und die Inszenierung von Veränderung im Vordergrund stehen. Die Problematik der isolierten Familiendarstellung und die Frage nach dem Einfluss der Produzenten auf die Arbeit der Erziehungshelfer werden ebenfalls diskutiert.
Im dritten Kapitel wird das Buch „Die Super Nanny - Glückliche Kinder brauchen starke Eltern“ analysiert. Die Form der Ansprache, die Verwendung von visuellen Reizen und die Unterschiede zum TV-Format werden beleuchtet. Die Arbeit stellt anschließend Überlegungen zur Rolle des pädagogischen Diskurses, der Medienkompetenz der Beteiligten und der Nachhaltigkeit der in der Sendung präsentierten Erfolgsgeschichten an. Sie diskutiert, ob die Sendung in einen Trend zur Rückkehr zu autoritär-direktiv geführter Erziehung passt.
Im Anhang werden die öffentlichen Kontroversen um die Sendung zusammengefasst. Die Arbeit präsentiert sowohl positive als auch negative Bewertungen der Sendung, die aus Studien und Medienberichten stammen. Sie beleuchtet die Kritik an der Dramaturgie, der isolierten Familiendarstellung und der Entmündigung der Erziehenden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die mediale Inszenierung von Erziehung, die Sendung „Die Super Nanny“, die Rolle der Diplompädagogin Katharina Saalfrank, die Kritik an der Sendung, die öffentliche Kontroverse, die Medienkompetenz, die Familienhilfe, die Erziehungsberatung und den öffentlichen Diskurs über Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was wird am TV-Format „Die Super Nanny“ kritisiert?
Kritiker bemängeln die mediale Inszenierung, die Bloßstellung von Kindern, die einfache Schwarz-Weiß-Dramaturgie und die Suggestion schneller Machbarkeit pädagogischer Erfolge.
Welchen Erziehungsstil propagierte Katharina Saalfrank in der Sendung?
Ihr Stil wurde als „streng aber gerecht“ beschrieben, mit Fokus auf feste Strukturen, Regeln und Konsequenz, wobei Studien auch demokratische Elemente fanden.
Wie unterscheidet sich das Buch zur Sendung vom Fernsehformat?
Das Buch ist weniger verbindlich, räumt der Selbstreflexion der Eltern mehr Platz ein und verweist stärker auf externe Beratungsangebote als die TV-Show.
Was versteht man unter „Affektfernsehen“ im Kontext der Super Nanny?
Es bezeichnet ein Genre, das gezielt auf ungezügelte Emotionalität und die Zurschaustellung privater Krisen zur Unterhaltung des Publikums setzt.
Fördert die Sendung die Rückkehr zur autoritären Erziehung?
Die Arbeit diskutiert, ob das Format einen Trend zu direktiv-geführter Erziehung bedient, wie er etwa von Bernhard Bueb gefordert wurde.
- Quote paper
- Christian Undorf (Author), 2008, Aufwachsen im öffentlichen Mediendiskurs als „dramatische Inszenierung“? Das Beispiel „Die Super Nanny“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278724