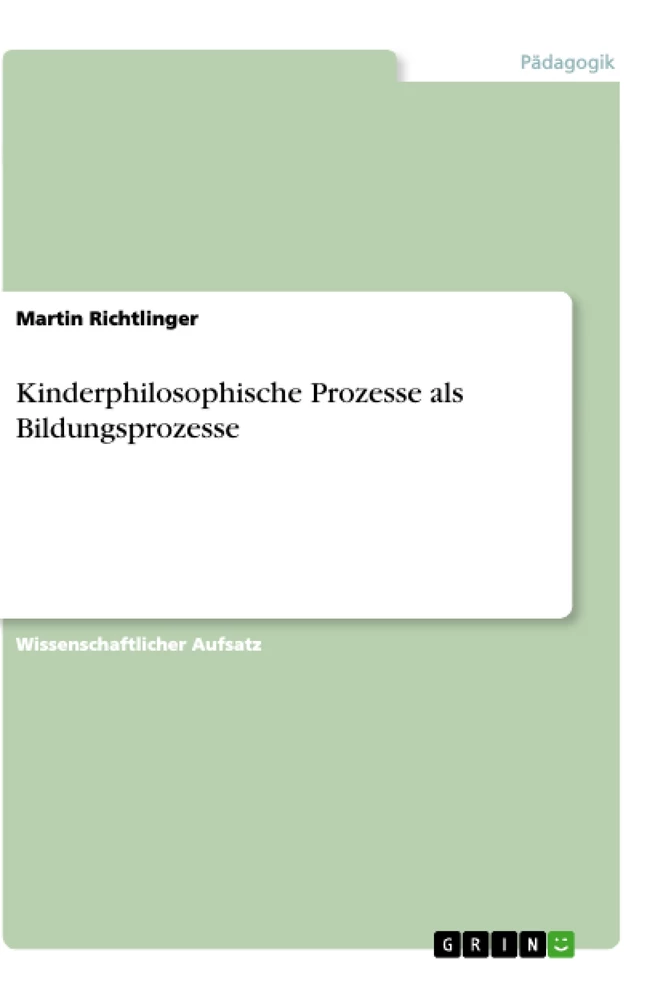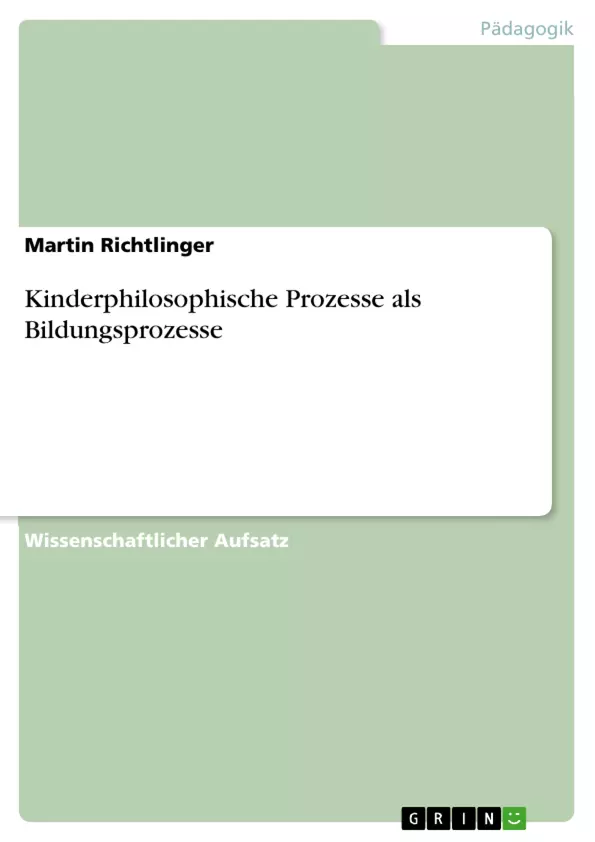Das Philosophieren ist so alt wie die Menschheit selbst. Die eigene Lebenswelt mit ihren Erscheinungen zu hinterfragen, ist Teil der ureigenen Neugier des menschlichen Individuums. Besonders die griechische Antike brachte eine Vielzahl berühmter Philosophen hervor, die bereits ihre „Liebe zur Weisheit“
entdeckten. Heutzutage wird insbesondere ein Augenmerk auf
kinderphilosophische Prozesse gerichtet und es wird auch in Deutschland bewusst daran gearbeitet, das Philosophieren an Schulen und in Kindergärten verstärkt zu betreiben.
Im Folgenden soll nun dieser Prozess des Philosophierens untersucht werden,insbesondere hinsichtlich seiner Merkmale. Fragen wie: Was kann das Philosophieren und woher kommt die Lust daran, wird auf den Grund gegangen werden. Ferner werden die Chancen und Möglichkeiten des Philosophierens in den Blick genommen und es wird die Methodik der Philosophie in der Schule
erläutert. Diesbezüglichen werden Ideen für die Umsetzung verschiedener Methoden im Unterricht gegeben und es wird auf den Begriff des „ganzheitlichen Philosophierens“ eingegangen. Letztendlich soll verdeutlicht werden, dass der philosophische Prozess bei Kindern zugleich ein Bildungsprozess ist, da er eine kritische und selbstreflektierende Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt, den Mitmenschen und dem eigenen Selbst anstößt und somit Entwicklungspotenzial bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale des kinderphilosophischen Prozesses
- Chancen und Möglichkeiten des Philosophierens
- Philosophieren in der Schule
- Methodik des Philosophierens und konkrete Ideen für den Unterricht
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem kinderphilosophischen Prozess und untersucht dessen Merkmale, Chancen und Möglichkeiten. Ziel ist es, die Bedeutung des Philosophierens für die Bildung von Kindern aufzuzeigen und die Methodik des Philosophierens in der Schule zu erläutern. Dabei werden konkrete Ideen für die Umsetzung verschiedener Methoden im Unterricht gegeben und der Begriff des „ganzheitlichen Philosophierens" beleuchtet.
- Merkmale des kinderphilosophischen Prozesses
- Chancen und Möglichkeiten des Philosophierens
- Methodik des Philosophierens in der Schule
- Bedeutung des Philosophierens für die Bildung von Kindern
- Der Begriff des „ganzheitlichen Philosophierens"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Philosophierens bei Kindern ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft dar. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Kinder überhaupt in der Lage sind zu philosophieren und welche Chancen und Möglichkeiten das Philosophieren für sie bietet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Merkmalen des kinderphilosophischen Prozesses. Es wird untersucht, ob Kinder überhaupt in der Lage sind zu philosophieren und welche Besonderheiten den kinderphilosophischen Prozess auszeichnen. Dabei wird auch auf die Frage eingegangen, ob Kinder überhaupt Lust am Philosophieren haben und welche Rolle die kindliche Naivität und Ungezwungenheit im philosophischen Prozess spielen.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Chancen und Möglichkeiten des Philosophierens für Kinder. Es wird die Methodik des Philosophierens in der Schule erläutert und konkrete Ideen für die Umsetzung verschiedener Methoden im Unterricht gegeben. Dabei wird auch auf den Begriff des „ganzheitlichen Philosophierens" eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den kinderphilosophischen Prozess, die Bildung von Kindern, die Methodik des Philosophierens, Chancen und Möglichkeiten des Philosophierens, ganzheitliches Philosophieren, Perspektivenwechsel, Toleranz, Hermeneutik, Kritikfähigkeit, Selbstreflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Philosophierens mit Kindern?
Es soll die natürliche Neugier fördern, Bildungsprozesse anstoßen und Kinder zu einer kritischen sowie selbstreflektierenden Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt anregen.
Sind Kinder überhaupt in der Lage zu philosophieren?
Ja, Kinder besitzen eine unvoreingenommene Sicht auf die Welt. Ihre Naivität und Ungezwungenheit sind wertvolle Merkmale des kinderphilosophischen Prozesses.
Was bedeutet "ganzheitliches Philosophieren"?
Dieser Ansatz verbindet kognitive Prozesse mit emotionalen und sozialen Aspekten, um eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen.
Wie kann Philosophie im Unterricht umgesetzt werden?
Durch spezifische Methoden wie Gedankenexperimente, Sokratische Gespräche oder den Einsatz von Bilderbüchern, die ethische und philosophische Fragen aufwerfen.
Welche Kompetenzen werden durch das Philosophieren gefördert?
Gefördert werden insbesondere die Kritikfähigkeit, Toleranz, der Perspektivenwechsel und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
- Arbeit zitieren
- Martin Richtlinger (Autor:in), 2014, Kinderphilosophische Prozesse als Bildungsprozesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278859