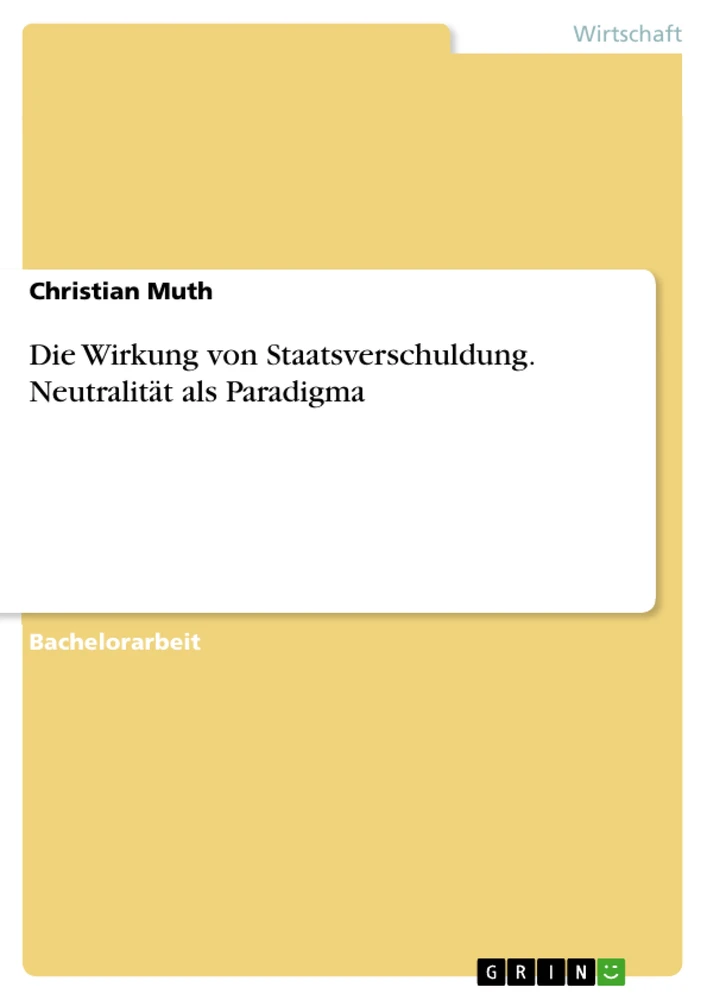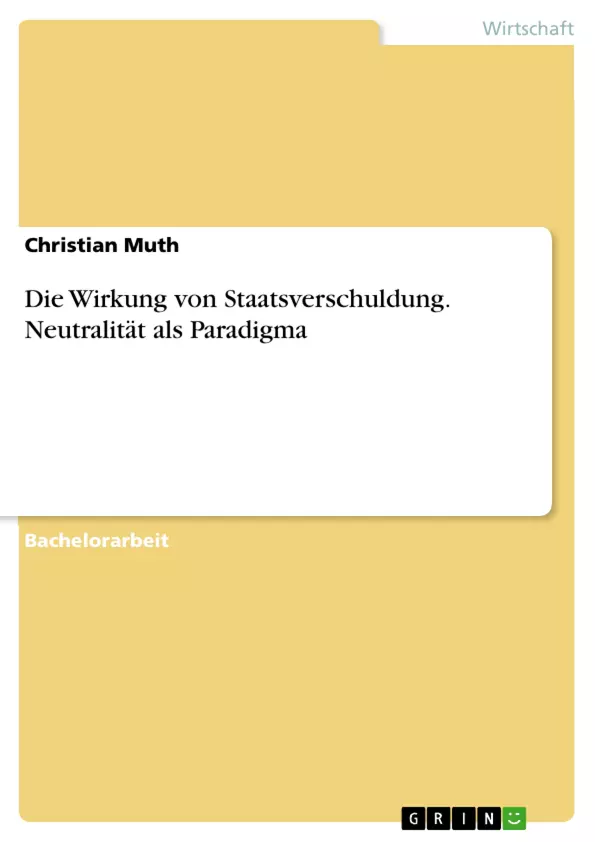Das Phänomen der staatlichen Verschuldung ist schon seit der Gründung von Staaten und in Folge dessen seit der Möglichkeit eigener Finanzpolitik Thema der politischen Diskussion. Die Aufnahme von Schulden und damit einhergehend eine Belastung nachfolgender Generationen ohne deren Zustimmung, wurde immer wieder kontrovers diskutiert. Ein demokratisches System zeichnet sich jedoch gerade durch Machtzuweisung auf Zeit aus. Es bleibt zu hinterfragen, ob dieses Prinzip durch übermäßige Verschuldung ohne die Möglichkeit der Zustimmung zukünftiger Entscheidungsträger nicht durchbrochen wird. In der Neuzeit, spätestens mit dem Aufkommen der europäischen Schuldenkrise, hat das Thema erneut an Brisanz gewonnen. Es werden in regelmäßigen Abständen neue Meldungen über drohende Zahlungsunfähigkeiten einzelner Länder veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Arbeit steht besonders Griechenland stark im öffentlichen Fokus. Doch wie stellt sich die Lage wirklich dar? Der Schuldenstand des griechischen Staates liegt aktuell bei 142 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, aber auch das Finanzvermögen griechischer Privathaushalte weist ein ähnliches Volumen auf. Hat die griechische Bevölkerung in Rücksicht auf die steigende Verschuldung der öffentlichen Haushalte und in Erwartung höherer steuerlicher Belastungen in der Zukunft vorgesorgt?
Und hat Staatsverschuldung in dieser Hinsicht überhaupt eine in solchem Maß wohlfahrtsmindernde Wirkung, wie häufig in den Medien der Eindruck erweckt wird?
Diese Arbeit liefert einen theoretischen Unterbau für die Relevanz von Staatsverschuldung.
Das Ricardianische Äquivalenztheorem, mit einem Standpunkt der von der klassischen keynesianischen Theorie abweicht, bietet hierfür einen guten Ansatzpunkt. Darauf aufbauend wird diskutiert werden, welche kritischen Modellannahmen zu hinterfragen sind. Anschließend wird untersucht, unter welchen Umständen das Modell auf die Wirklichkeit übertragbar und damit praktikabel ist. Schlussendlich wird die Theorie mit einer Analyse über die Entwicklung der gesamtstaatlichen Verschuldung und der privaten Vermögensbildung in der Bundesrepublik Deutschland nach der deutschen Wiedervereinigung abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- Staatsverschuldung - Relevanz des Themas
- Ricardianisches Äquivalenztheorem
- Zwei-Perioden-Modell mit einer Generation
- Partialmodell mit zwei Perioden
- Einführung von Steuern versus Aufnahme von Schulden
- Unendliche Periodenlaufzeit
- Modell der überlappenden Generationen
- Kritische Punkte zum Ricardianischen Äquivalenztheorem
- Unterschiede zum Modell des Keynesianismus
- Alternative Sicht zur Lebenszyklushypothese
- Diskussion der Modellannahmen
- Intergenerativer Altruismus
- Vollkommene Kapitalmärkte
- Vollständige Information und Rationalität
- Finanzierung durch unverzerrende Steuern
- Implementierbarkeit der Theorie in der Realität
- Todeszeitpunkt
- Fertilität
- Rentenmarkt
- Anreizwirkung der Vererbung
- Sparverhalten
- Bedeutung des Theorems
- Empirische Fakten für Deutschland
- Aussagekraft des Ricardianischen Modells
- Sparmotive
- Statistisches Rahmenwerk
- Ergebnisse
- Trendlinie
- Zeitraumbetrachtung
- Schlussfolgerungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Staatsverschuldung auf die Volkswirtschaft, wobei das Ricardianische Äquivalenztheorem als theoretisches Fundament dient. Es wird analysiert, wie sich die Modellannahmen auf die Praxis übertragen lassen, und welche empirischen Evidenzen für die Gültigkeit des Theorems existieren.
- Das Ricardianische Äquivalenztheorem und seine zentralen Aussagen
- Kritikpunkte und Grenzen des Modells
- Die Relevanz des Theorems für die realwirtschaftliche Entwicklung
- Empirische Evidenz für Staatsverschuldung in Deutschland
- Die Bedeutung der Staatsverschuldung für die zukünftige Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Relevanz des Themas Staatsverschuldung und stellt die historische und aktuelle Bedeutung des Themas heraus. Kapitel 2 erklärt das Ricardianische Äquivalenztheorem anhand verschiedener Modellwelten und zeigt, wie es die Auswirkungen von Staatsverschuldung auf die Wirtschaft theoretisch beschreibt. Kapitel 3 diskutiert die Kritikpunkte und Grenzen des Modells sowie die Übertragbarkeit auf die Realität. Kapitel 4 präsentiert empirische Daten und Ergebnisse zu Staatsverschuldung und privatem Vermögensaufbau in Deutschland. Kapitel 5 bietet einen Ausblick auf die weitere Relevanz des Themas und die daraus resultierenden politischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Ricardianisches Äquivalenztheorem, Steuerfinanzierung, Kreditfinanzierung, Lebenszyklushypothese, empirische Evidenz, Deutschland, Wirtschaftspolitik, Vermögensbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Ricardianische Äquivalenztheorem?
Das Theorem besagt, dass es für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage unerheblich ist, ob Staatsausgaben durch Steuern oder durch Schulden finanziert werden, da Bürger für künftige Steuerlasten sparen.
Welche Rolle spielt der intergenerative Altruismus?
Das Modell geht davon aus, dass Eltern ihren Kindern Vermögen hinterlassen, um die Last künftiger Steuern auszugleichen, was die Neutralität der Staatsverschuldung stützt.
Warum wird das Ricardianische Modell oft kritisiert?
Kritikpunkte sind unter anderem unvollkommene Kapitalmärkte, mangelnde Information der Bürger und die Tatsache, dass Steuern oft verzerrend wirken.
Wie unterscheidet sich das Modell vom Keynesianismus?
Im Gegensatz zum Ricardianischen Modell geht der Keynesianismus davon aus, dass Schuldenaufnahme kurzfristig die Nachfrage und den Konsum stimuliert.
Gibt es empirische Belege für das Theorem in Deutschland?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Staatsverschuldung und der privaten Vermögensbildung in Deutschland nach der Wiedervereinigung, um die Gültigkeit des Theorems zu prüfen.
- Citation du texte
- Christian Muth (Auteur), 2011, Die Wirkung von Staatsverschuldung. Neutralität als Paradigma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278903