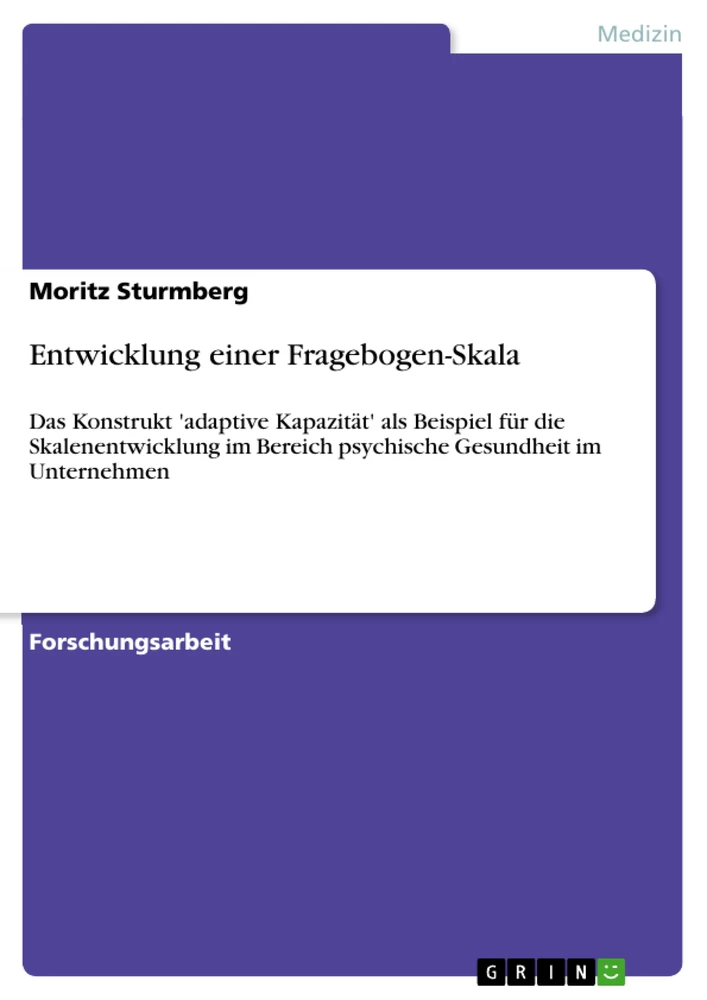Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Fragenbogenskala zur Identifizierung von psychosozialen Risiken und Belastungen von MitarbeiterInnen in Betrieben/Unternehmen, konkret mit der „adaptiven Kapazität“ als einem zentralen Aspekt psychischer Gesundheit/Krankheit. Psychische Erkrankungen entstehen durch eine Diskrepanz zwischen den einem Menschen zur Verfügung stehenden (internen und externen) Ressourcen und den entgegengebrachten Anforderungen seiner Umwelt. Die Indikation von Risikofaktoren für psychische Erkrankungen im Zuge der Auswertung des hier erarbeiteten Fragebogens kann im konkreten Fall idealerweise eine Ursachenforschung intensivieren sowie präventive und interventionistische Unterstützungsleistungen bereitzustellen. Hierzu gehört auch, äußere Anforderungen unter Umständen an die vorhandene interne Kapazität angleichen zu müssen. Die vorliegende Arbeit kann aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen kein verlässliches Messinstrument bereitstellen. Das zentrale Anliegen ist jedoch, verschiedene Bereiche des Konstrukts 'adaptive Kapazität' darzulegen, die wissenschaftlich fundiert als maßgeblich für die Skalen-/Fragebogenentwicklung im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit im Betrieb oder Unternehmen betrachtet werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemdarstellung
- Konstrukt/ Skala: Adaptive Kapazität
- Forschungsfrage und Ziel der Untersuchung
- Fragebogenkonzeption und Items
- Antwortkategorien
- Pretestauswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anlage: Fragebogen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Fragebogenskala zur Identifizierung von psychosozialen Risiken und Belastungen von MitarbeiterInnen in Betrieben/Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf dem Konstrukt der „adaptiven Kapazität“ als einem zentralen Aspekt psychischer Gesundheit/Krankheit. Ziel ist es, die Determinanten der adaptiven Kapazität in Bezug auf die psychische Gesundheit im Betrieb zu erfassen und Rückschlüsse auf die individuelle adaptive Kapazität der befragten Person zu ziehen.
- Entwicklung einer Fragebogenskala zur Erfassung der adaptiven Kapazität
- Identifizierung von psychosozialen Risiken und Belastungen im Arbeitsumfeld
- Analyse der Determinanten der adaptiven Kapazität
- Bewertung des Gefährdungspotenzials für psychische Erkrankungen
- Entwicklung eines Messinstruments zur Erfassung der psychischen Gesundheit im Betrieb
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik psychischer Erkrankungen im Betrieb dar und erläutert die Relevanz der adaptiven Kapazität als Konstrukt für die psychische Gesundheit. Kapitel 2 definiert das Konstrukt der adaptiven Kapazität und beschreibt die verschiedenen Dimensionen, die für die Skalenentwicklung relevant sind. Die Forschungsfrage und das Ziel der Untersuchung werden formuliert. Kapitel 2.2 erläutert die Konzeption des Fragebogens und die Entwicklung der Items. Die Pretestauswertung wird in Kapitel 2.4 kurz dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die adaptive Kapazität, psychische Gesundheit im Betrieb, psychosoziale Risiken, Belastungen, Fragebogenskala, Skalenentwicklung, Forschungsfrage, Itementwicklung, Pretestauswertung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „adaptiver Kapazität“ im Arbeitskontext?
Adaptive Kapazität bezeichnet die Fähigkeit von Mitarbeitern, auf Anforderungen der Umwelt mit ihren internen und externen Ressourcen angemessen zu reagieren, um die psychische Gesundheit zu erhalten.
Wie können psychosoziale Risiken im Betrieb identifiziert werden?
Durch die Entwicklung und Anwendung wissenschaftlich fundierter Fragenbogenskalen können Belastungsfaktoren und Ressourcenlücken systematisch erfasst werden.
Warum ist die Prävention psychischer Erkrankungen im Unternehmen wichtig?
Psychische Erkrankungen entstehen oft durch eine Diskrepanz zwischen Ressourcen und Anforderungen. Präventive Maßnahmen können Ursachenforschung intensivieren und frühzeitige Unterstützung bieten.
Was ist das Ziel der hier entwickelten Skala?
Das Ziel ist die Darlegung der verschiedenen Bereiche des Konstrukts „adaptive Kapazität“, die für die Messung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz maßgeblich sind.
Was wurde im Rahmen der Fragebogenkonzeption durchgeführt?
Die Arbeit umfasst die Itementwicklung, die Festlegung von Antwortkategorien sowie eine erste Pretestauswertung zur Überprüfung der Skala.
- Quote paper
- Moritz Sturmberg (Author), 2014, Entwicklung einer Fragebogen-Skala, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279056