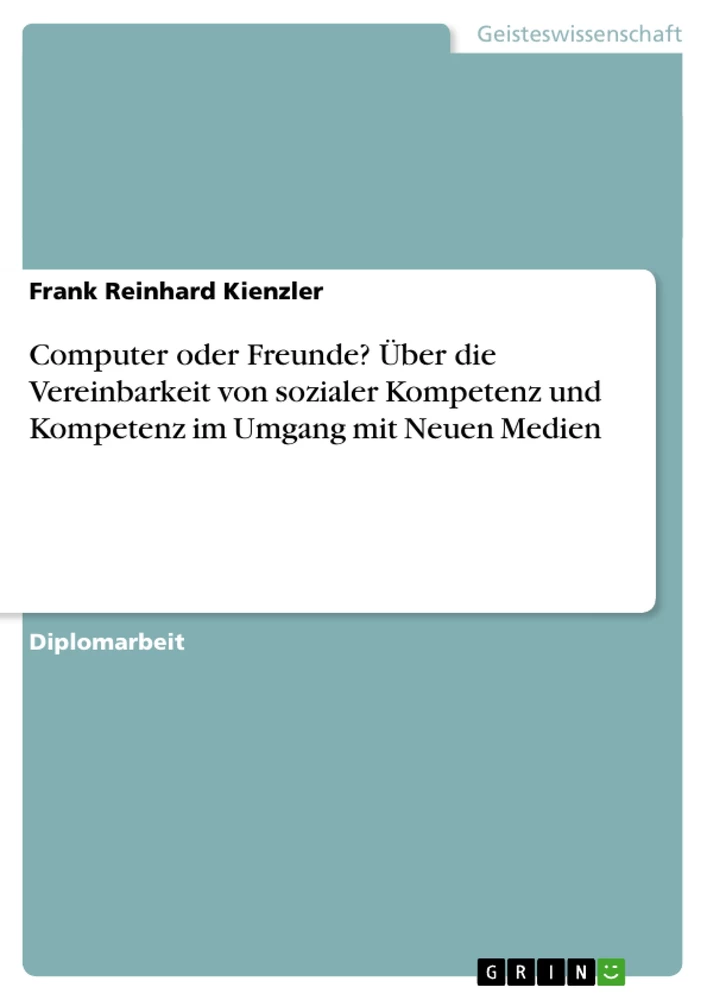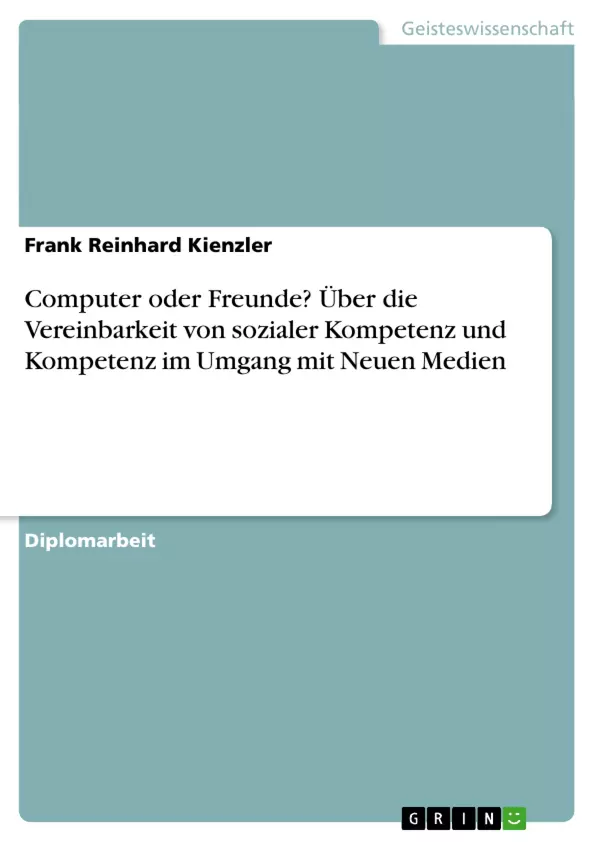Wohl keine andere Generation konnte bisher auf solch eine breite Palette von Medien zurückgreifen und ist somit gleichsam mit einer Medienvielfalt aufgewachsen, wie die heutige. Handys, Computer, Spielkonsolen, Fernseher und viele andere technische Errungenschaften beginnen die Kinder- und Jugendzimmer zu dominieren. Es ist von daher anzunehmen, dass gerade diese Vielfalt und die damit verbundene alltägliche Präsenz auch Auswirkungen auf das soziale Umfeld Jugendlicher haben dürfte. Können neue Medien Freundschaften und Beziehungen ersetzen oder zumindest in negativer Art und Weise beeinflussen und sind speziell medial kompetente Menschen davon besonders betroffen? Diese Fragestellung drängt sich geradezu auf, denn Medien erlauben Passivität, sie erlauben, faul zu sein. Wirkt sich diese Faulheit nun auch auf soziale Kontakte aus?
Die Frage nach der Vereinbarkeit von sozialer Kompetenz und Kompetenz im Umgang mit neuen Medien ist, für sich genommen, auf den ersten Blick recht paradox. Viele neue Medien, wie beispielsweise das Mobiltelefon oder auch das Internet sind von ihrer originären Funktionalität her auf Kommunikation mit anderen Menschen ausgerichtet. Können sie dann zu einer Verringerung von sozialen Beziehungen beitragen? Tragen sie überhaupt zu einer Verringerung derselben bei oder ist nicht vielleicht sogar das Gegenteil der Fall und medial kompetente Jugendliche haben mehr und tiefergehende soziale Beziehungen als ihre weniger kompetenten Peers? Mit dieser Frage beschäftigt sich, neben der breiten Öffentlichkeit, auch die wissenschaftliche Fachliteratur seit geraumer Zeit; nebenbei bemerkt, mit den unterschiedlichsten Ergebnissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische und empirische Einordnung
- 2.1 Medien im gesellschaftlichen Kontext
- 2.1.1 Was sind Medien?
- 2.1.1.1 Entstehungsgeschichte der Medien
- 2.1.1.2 Alte Medien - Neue Medien
- 2.1.1.3 Jugendtypische Medien
- 2.1.2 Mediales und non-mediales Freizeitverhalten Jugendlicher
- 2.1.2.1 Das Freizeitverhalten Jugendlicher aus Sicht der SHELL JUGENDSTUDIE 2000
- 2.1.2.2 Das Freizeitverhalten Jugendlicher aus Sicht der JIM-STUDIE 2002
- 2.1.2.3 Das Freizeitverhalten Jugendlicher aus Sicht der Studie GENERATION N
- 2.1.2.4 Erkennbarer Einfluss von Medien auf das Freizeitverhalten Jugendlicher
- 2.1.3 Funktionen von Medien im Alltag Jugendlicher
- 2.1.3.1 Unterhaltungs- und Entspannungs-Funktion
- 2.1.3.2 Informations- und Meinungsbildungs-Funktion
- 2.1.3.3 Funktion, interpersonale Kommunikation zu ersetzen
- 2.1.3.4 Soziale-Funktion
- 2.1.3.5 Große Vielfalt in den Funktionen von Medien im Alltag Jugendlicher
- 2.1.4 Medienkompetenz oder Kompetenz im Umgang mit Neuen Medien? Der Versuch einer Begriffsbestimmung
- 2.1.5 Was kann unter sozialer Kompetenz verstanden werden?
- 2.2 Der Einfluss von Medien auf die soziale Kompetenz Jugendlicher
- 2.2.1 Betrachtung von ausgewählten Einzelmedien unter besonderer Berücksichtigung des medialen und sozialen Kompetenzbegriffs
- 2.2.1.1 Das Fernsehen
- 2.2.1.2 Computer
- 2.2.1.2.1 Der Einfluss des Computers auf soziale Beziehungen
- 2.2.1.2.2 Haben Computerspiele einen Einfluss auf die Einbindung in soziale Strukturen?
- 2.2.1.3 Internet/Online-Medien
- 2.2.2 Lassen sich mediale und soziale Kompetenz miteinander vereinbaren? Die Ergebnisse der 13. SHELL JUGENDSTUDIE
- 3.3 Das Untersuchungsinstrument: schriftliche Befragung
- 2.3 Hypothesen und Fazit der theoretischen und empirischen Einordnung
- 3. Empirische Untersuchung über die Vereinbarkeit von sozialer Kompetenz und Kompetenz im Umgang mit neuen Medien im Jugendzentrum Kaiserslautern
- 3.1 Das Jugend- und Programmzentrum Kaiserslautern
- 3.1.1 Der Träger
- 3.1.2 Die Personalsituation
- 3.1.3 Gesetzliche Grundlagen
- 3.1.4 Räumlichkeiten und Ausstattung
- 3.1.5 Arbeitsschwerpunkt Medienpädagogik
- 3.2 Vorüberlegungen und Ziele der Befragung
- 3.3.1 Die Untersuchungsgruppe
- 3.3.2 Die Entwicklung des Fragebogens
- 3.3.3 Die Durchführung der Befragung
- 4. Auswertung und Ergebnisse
- 4.1 Die soziographischen Daten der jugendlichen Befragten (Fragen 1 bis 4)
- 4.1.1 Die geschlechtliche Verteilung bei den befragten Jugendlichen (Frage 1)
- 4.1.2 Der Altersdurchschnitt der befragten Jugendlichen (Frage 2)
- 4.1.3 Das Bildungsniveau der befragten Jugendlichen (Frage 3)
- 4.1.4 Die Nationalität der befragten Jugendlichen (Frage 4)
- 4.2 These 1: Unterschiedlicher Wirkungsgrad von Einzelmedien auf soziale Kontakte (Frage 13)
- 4.3 These 2: Keine Vereinsamung durch die Nutzung von Computer und Internet
- 4.3.1 Soziographische Daten der Profilgruppen
- 4.3.1.1 Die geschlechtliche Verteilung innerhalb der Profilgruppen (Frage 1)
- 4.3.1.2 Das Durchschnittsalter der Profilgruppen (Frage 2)
- 4.3.1.3 Die Schulbildung der Profilgruppen (Frage 3)
- 4.3.1.4 Die Nationalität der Profilgruppen (Frage 4)
- 4.3.2 Der Fernsehkonsum der Profilgruppen (Frage 9)
- 4.3.3 Soziabilität der Profilgruppen
- 4.3.3.1 Partnerschaften und Freundschaften (Fragen 11 und 12)
- 4.3.3.2 Freizeitverhalten (Frage 13)
- 4.3.3.3 Häufigkeit der Begegnung mit ausländischen Jugendlichen (Frage 14)
- 4.3.3.4 Einschätzung der Lernmöglichkeiten von deutschen und ausländischen Jugendlichen von einander (Frage 14)
- 4.3.3.5 Ansprechpartner bei Problemen (Fragen 16 und 17)
- 4.3.3.6 Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Organisation (Frage 19)
- 4.3.3.7 Computernutzung (Frage 10)
- 4.3.4 Zusammenfassung
- 4.4 These 3: Im Umgang mit Medien bestehen geschlechtsspezifische Unterschiede
- 4.4.1 Mediennutzung und Besitz (Frage 7)
- 4.4.2 Nutzungspräferenzen (Fragen 8 und 10)
- 4.4.3 Internetnutzungsdauer (Frage 8)
- 4.4.4 Zusammenfassung
- 4.5 These 4: Im Umgang mit Medien bestehen bildungsspezifische Unterschiede
- 4.5.1 Mediennutzung und Besitz (Frage 7)
- 4.5.2 Nutzungspräferenzen (Fragen 8 und 10)
- 4.5.3 Internetnutzungsdauer (Frage 8)
- 4.5.4 Zusammenfassung
- 4.6 These 5: Im Umgang mit Medien bestehen kulturspezifische Unterschiede
- 4.6.1 Mediennutzung und Besitz (Frage 7)
- 4.6.2 Nutzungspräferenzen (Fragen 8 und 10)
- 4.6.3 Zusammenfassung
- 4.7 These 6: Erst die Freunde, dann die Medien (Frage 13)
- 5. Schlusswort
- Der Einfluss verschiedener Medien (Fernsehen, Computer, Internet) auf die soziale Kompetenz Jugendlicher.
- Die Funktionen von Medien im Alltag Jugendlicher, insbesondere in Bezug auf Unterhaltung, Information, Kommunikation und soziale Interaktion.
- Die Rolle des Jugendzentrums Kaiserslautern in der Förderung der Medienkompetenz und der sozialen Kompetenz Jugendlicher.
- Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Medienkonsum und zum sozialen Verhalten von Jugendlichen im Jugendzentrum Kaiserslautern.
- Die Analyse von soziographischen Daten, um geschlechtsspezifische, bildungsspezifische und kulturspezifische Unterschiede im Umgang mit Medien aufzudecken.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Vereinbarkeit von sozialer Kompetenz und Kompetenz im Umgang mit Neuen Medien bei Jugendlichen. Sie zielt darauf ab, den Einfluss von Medien auf die soziale Entwicklung Jugendlicher zu erforschen und zu analysieren, ob sich mediale und soziale Kompetenz miteinander vereinbaren lassen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Kapitel 2 befasst sich mit der theoretischen und empirischen Einordnung des Themas. Es werden verschiedene Medien und ihre Funktionen im Alltag Jugendlicher vorgestellt und die Begriffe der Medienkompetenz und der sozialen Kompetenz definiert. Außerdem wird der Einfluss von Medien auf die soziale Kompetenz Jugendlicher analysiert. Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung, die im Jugendzentrum Kaiserslautern durchgeführt wurde. Es werden das Jugendzentrum und die Untersuchungsgruppe vorgestellt, sowie die Entwicklung und Durchführung des Fragebogens beschrieben. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert und analysiert. Es werden die soziographischen Daten der jugendlichen Befragten ausgewertet und verschiedene Thesen zum Einfluss von Medien auf soziale Kontakte, Vereinsamung, geschlechtsspezifische, bildungsspezifische und kulturspezifische Unterschiede im Umgang mit Medien aufgestellt.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, soziale Kompetenz, Jugend, Medienkonsum, Freizeitverhalten, Jugendzentrum, empirische Untersuchung, soziographische Daten, Einfluss von Medien, Vereinsamung, geschlechtsspezifische Unterschiede, bildungsspezifische Unterschiede, kulturspezifische Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen zu Medien und sozialer Kompetenz
Führen neue Medien zur sozialen Vereinsamung von Jugendlichen?
Studien wie die Shell Jugendstudie zeigen, dass mediale und soziale Kompetenz oft Hand in Hand gehen. Viele Medien dienen primär der Kommunikation und stärken soziale Beziehungen.
Welchen Einfluss haben Computerspiele auf die Soziabilität?
Computerspiele sind oft in soziale Strukturen eingebunden (z.B. Online-Gaming). Sie ersetzen selten reale Kontakte, sondern ergänzen das Freizeitverhalten.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Mediennutzung?
Ja, Untersuchungen zeigen oft unterschiedliche Präferenzen bei der Wahl der Medien und der Nutzungsdauer zwischen Jungen und Mädchen.
Welche Rolle spielt das Bildungsniveau beim Medienumgang?
Das Bildungsniveau kann die Art der Mediennutzung beeinflussen, etwa im Hinblick auf die Informations- oder Unterhaltungsfunktion von Internet und Fernsehen.
Was ist wichtiger für Jugendliche: Medien oder Freunde?
Die empirische Untersuchung deutet darauf hin, dass für die meisten Jugendlichen reale Freunde Vorrang vor der Mediennutzung haben ("Erst die Freunde, dann die Medien").
- Citar trabajo
- Frank Reinhard Kienzler (Autor), 2004, Computer oder Freunde? Über die Vereinbarkeit von sozialer Kompetenz und Kompetenz im Umgang mit Neuen Medien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27911