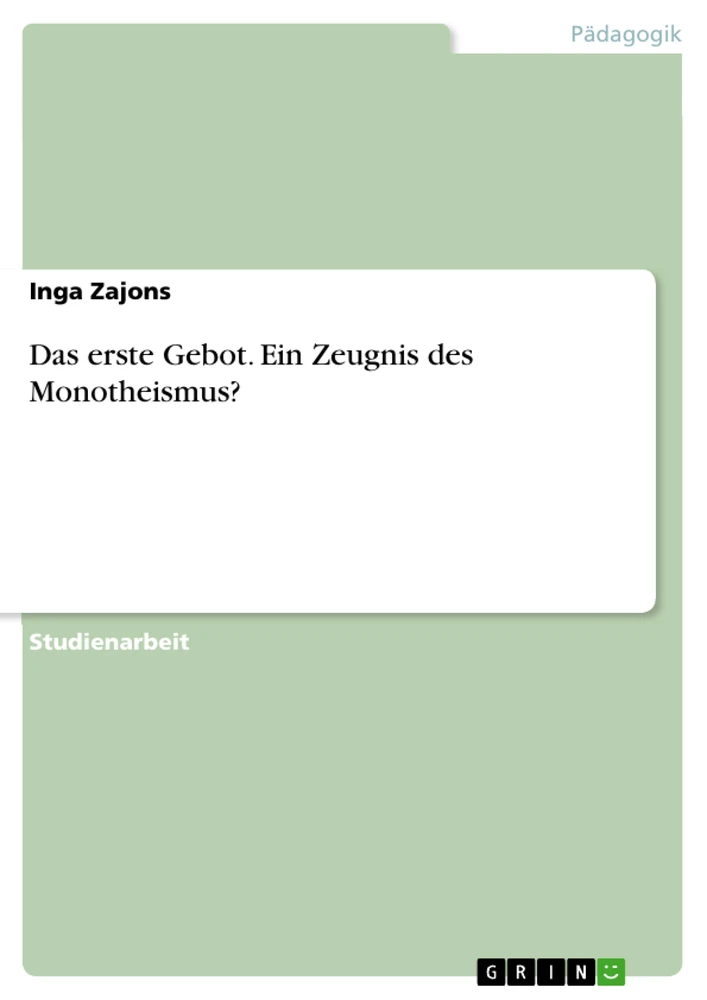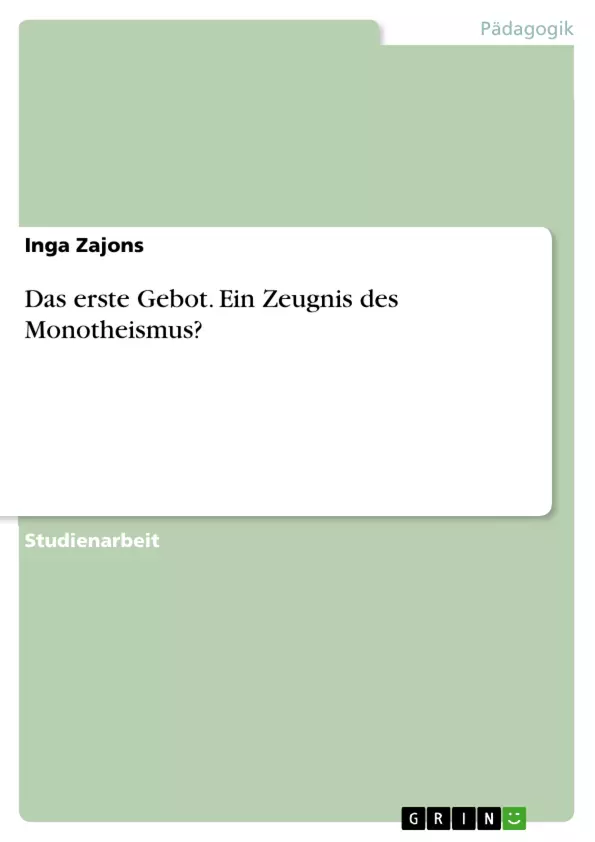„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Eigentlich scheint dieser Appell sehr deutlich zu sein. Es geht um den einen Gott, den es zu verehren gilt. Betrachtet man jedoch das erste Gebot und dessen historischen Kontext genauer, stellt man angesichts der kulturellen Vielfalt eine gewisse Problematik fest. Was bedeutete dieser Ausspruch für die Menschen der damaligen Zeit? Sollte die Existenz anderer Götter geleugnet werden, oder zielte das Gebot auf etwas ganz anderes ab? Handelte es sich hierbei vielmehr um eine ausschließliche Anerkennung des einen Gottes Israels? Diese Fragen finden noch heute in der alttestamentlichen Wissenschaft Gehör. Es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um ein Phänomen des alten Israels und dessen Umwelt. Die Frage nach Gott und dessen Beziehung zum Menschen zeugt noch immer von Aktualität. So empfängt er durch ihn sowohl Heil als auch Leid und kann sein Schicksal als Geschick nicht aus Gottes Hand nehmen.
"Am Guten Tag sei guter Dinge, und am bösen Tag bedenke: Diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist." (Koh 7,14) Wie ist das Erste Gebot demnach zu verstehen? Es stellt sich die Frage, ob es als radikale Aufforderung zur Ausschließlichkeit des Glaubens zu sehen ist, oder ob es sich vielmehr um ein Bekenntnis, welches die Verehrung eines einzigen Gottes fordert, handelt. Diese Arbeit wird sich mit der Frage nach dem einzigen Gott befassen und versuchen die Bedeutung des Ersten Gebotes herauszustellen. Es soll darauf eingegangen werden, ob es sich hierbei um einen Aufruf zur Ausschließlichkeit Gottes handelt, oder ob der Begriff „Monotheismus“ vor dem Hintergrund des Fremdgötterverbots keine Gültigkeit besitzt. Dabei soll jedoch nicht nur der Fokus auf das historische Israel gelenkt werden. Es soll anschließend konstatiert werden, welche Bedeutung das Erste Gebot mit seinem appellativen Charakter für die heutige Zeit besitzt und wie es angesichts der Kulturvielfalt zu verstehen ist. So wird zunächst auf die Ausschließlichkeit Gottes im Allgemeinen eingegangen, um die Aktualität zu verdeutlichen. Anschließend wird der Fokus auf das Erste Gebot gelenkt und dem damit verbundenen Jahweglauben. Hierbei spielt sowohl die Entstehungsgeschichte als auch die formale Gestalt des Gebotes eine besondere Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frage nach der Ausschließlichkeit Gottes
- Monotheismus und Monolatrie
- Gott als der Einzige unter Göttern des historischen Israels
- Inhalt und Intention des biblischen Monotheismus
- Die Entstehungsgeschichte des Ersten Gebotes
- Formale Analyse des Ersten Gebotes
- Inhalt und Intention des biblischen Monotheismus
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem einzigen Gott und untersucht die Bedeutung des Ersten Gebots „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Der Fokus liegt darauf, zu analysieren, ob dieses Gebot als Aufforderung zur Ausschließlichkeit Gottes zu verstehen ist oder ob der Begriff „Monotheismus“ in diesem Kontext seine Gültigkeit verliert. Zudem werden die historischen und kulturellen Hintergründe des Ersten Gebotes betrachtet, um seine Relevanz für die heutige Zeit zu erforschen.
- Die historische und kulturelle Bedeutung des Ersten Gebotes im Kontext des historischen Israels.
- Die Frage nach der Ausschließlichkeit Gottes und die Kritik an der Monotheismus-Vorstellung in der heutigen Zeit.
- Die Analyse des Ersten Gebots hinsichtlich seiner Entstehungsgeschichte und Form.
- Die Rolle des Jahweglaubens im Zusammenhang mit dem Ersten Gebot.
- Die Bedeutung des Ersten Gebotes für die heutige Zeit und die Herausforderungen, die sich aus der Kulturvielfalt ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach der Interpretation des Ersten Gebotes in seiner historischen und aktuellen Relevanz und setzt den Rahmen für die weiteren Analysen.
- Die Frage nach der Ausschließlichkeit Gottes: Dieses Kapitel beleuchtet die Diskussion um den Anspruch auf eine universelle Verehrung Gottes und zeigt die Kritik daran in einer säkularisierten Welt auf. Es führt zudem den Begriff des Monotheismus im Vergleich zu anderen Religionsformen ein.
- Gott als der Einzige unter Göttern des historischen Israels: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Inhalt und der Intention des biblischen Monotheismus im Kontext des historischen Israels. Es analysiert die Entstehungsgeschichte des Ersten Gebotes und untersucht dessen formale Gestalt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Monotheismus, des Ersten Gebotes, der Entstehung des Jahweglaubens und der Frage nach der Ausschließlichkeit Gottes im Kontext des historischen Israels und der heutigen Zeit. Darüber hinaus werden die Themen der Kulturvielfalt, Säkularisierung und Religionsmissbrauch behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Bedeutet das erste Gebot die Leugnung anderer Götter?
Die Arbeit untersucht, ob das Gebot die Existenz anderer Götter theoretisch leugnet oder vielmehr die exklusive Verehrung des Gottes Israels (Monolatrie) fordert.
Was ist der Unterschied zwischen Monotheismus und Monolatrie?
Monotheismus glaubt an nur einen Gott; Monolatrie erkennt die Existenz anderer Götter an, verehrt aber nur einen einzigen als relevant für das eigene Volk.
Welche Bedeutung hat das erste Gebot in der heutigen Kulturvielfalt?
Es wird als Appell zur Ausschließlichkeit und als Bekenntnis diskutiert, das auch in einer säkularisierten Welt Fragen nach dem „höchsten Gut“ aufwirft.
Was verrät die Entstehungsgeschichte über die Intention des Gebotes?
Die historische Analyse zeigt, dass das Gebot in einer Umwelt voller fremder Kulte als Identitätsmerkmal für den Jahweglauben fungierte.
Wie wird Religionsmissbrauch im Kontext des ersten Gebotes thematisiert?
Die Arbeit beleuchtet kritisch, wie der Ausschließlichkeitsanspruch sowohl Heil als auch Leid bringen kann und wie er heute verstanden werden muss.
- Arbeit zitieren
- Inga Zajons (Autor:in), 2013, Das erste Gebot. Ein Zeugnis des Monotheismus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279131