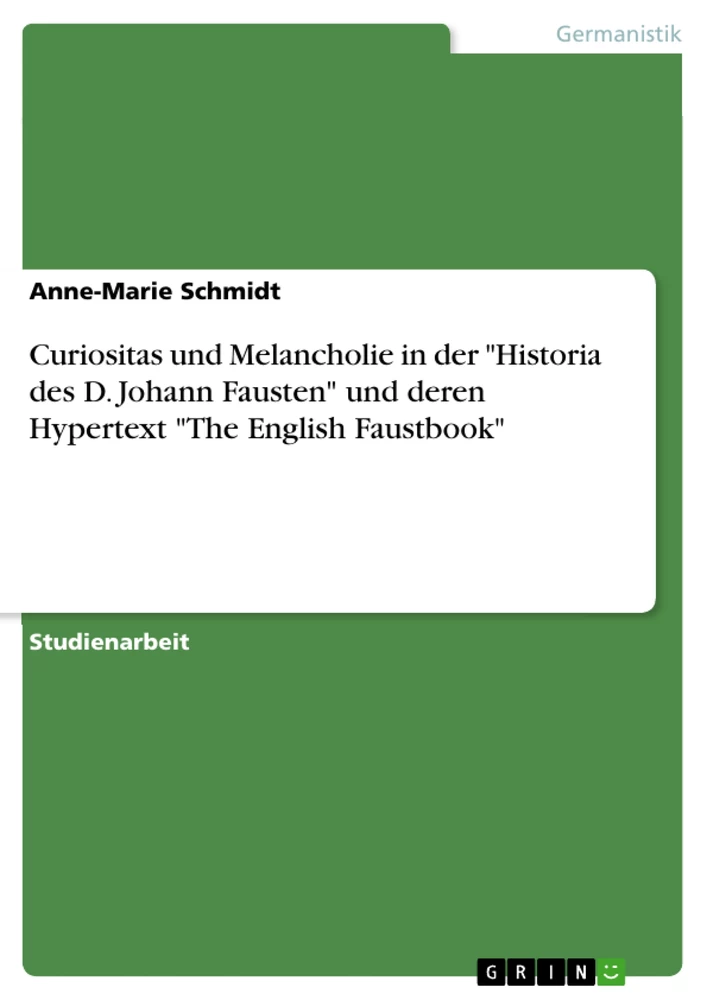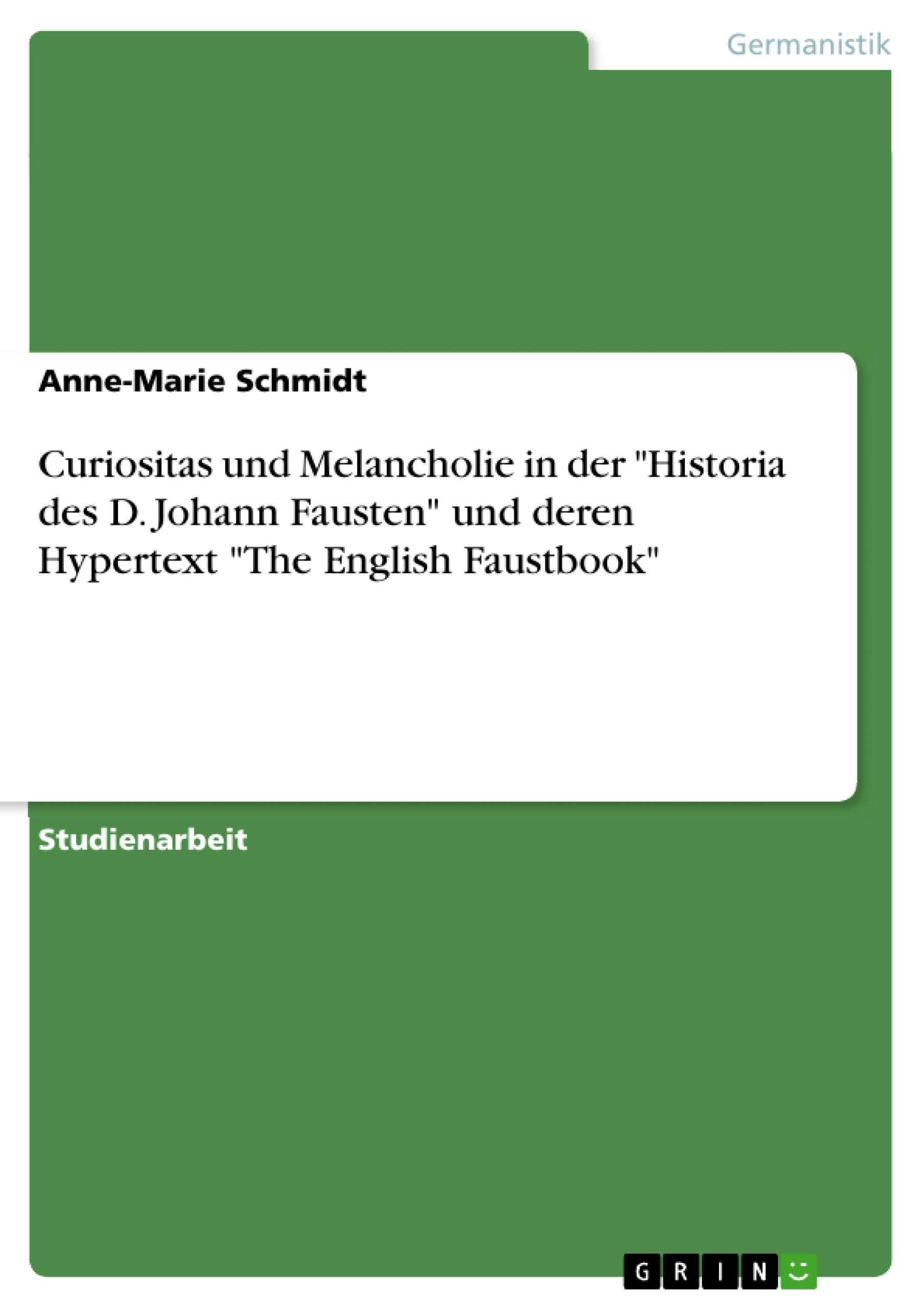Alle namhaften deutschen Transformationen des Fauststoffs gehen auf die Historia des D. Johann Fausten zurück, die 1587 in Frankfurt von Johann Spieß herausgegeben wurde, denn es hätte „ein grosse nachfrage nach gedachtes Fausti Historia bey den Gastungen vnnd Gesellschafften“ gegeben. Im Zentrum dieser Arbeit soll eine Transformation analysiert werden, deren unmittelbare Textvorlage die Historia war und die in der bisherigen Forschung nur dezente Aufmerksamkeit genossen hat. Sie ist wiederum die Grundlage aller nachfolgenden Transformationen der englischen Fausttradition: The English Faustbook von 1588.
Wie bereits die Forschung gezeigt hat, wird in den vielen Faustversionen nicht der Stoff tradiert, sondern Text transformiert. Dabei steht die Identität Fausts im Mittelpunkt, von der einzelne Aspekte durch die Transformationen erschaffen, verändert oder betont werden, wobei jeder Autor seine eigenen Schwerpunkte setzte, wie es MARINA MÜNKLER passend beschrieb: „Wer etwas verändert, dem ist etwas aufgefallen – etwas, das er für langweilig, überflüssig, verbesserungsbedürftig, irritierend, beunruhigend oder inakzeptabel hielt.“ Als wesentliche Identitätsmarkierungen des Faust sieht sie „curiositas, Melancholie und Gewissen […] Zauberei und Karriere.“ Da eine Analyse dieser fünf Semantiken den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, werden vordergründig die beiden Semantiken curiositas und Melancholie analysiert werden und welchen Einfluss die Umgestaltungen des Autors des EFB auf sie nehmen. Aufgrund der eng miteinander verknüpften Thematiken, wie sich noch in der weiteren Analyse zeigen wird, werden Überschneidungen und Betrachtungen gleicher Episoden unter unterschiedlichen Gesichtspunkten nicht vermeidbar sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- GÉRARD GENETTES Transtextualitätstheorie
- Semantische Transformationen
- Formale Transformationen
- Aussparungen und Kürzungen
- Erweiterungen und Ersetzungen
- Curiositas
- Entwicklung des Begriffs und Verwendung in der Historia
- Mephostophiles als Freund und Gegenspieler
- Fehlgerichtetes Forschen
- Die Qualität des Wissens und der Erkenntniswege
- Göttliche Gnade als Rettungsanker
- Melancholie
- Vier-Säfte-Lehre und Melancholiediskurs des 16. Jahrhunderts
- Faustus melancholische Komplexion
- Die angeborene melancholische Konstitution
- Das Krankheitsbild
- Mephostophiles als Arzt je nach Bedarf
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Transformation der Historia von D. Johann Fausten im englischen Faustbuch (EFB) von 1588. Sie untersucht, inwieweit das EFB trotz Zusätzen und Auslassungen den Intentionen des deutschen Autors treu bleibt. Die Arbeit fokussiert auf die beiden Semantiken curiositas und Melancholie und analysiert deren Darstellung in beiden Texten. Sie untersucht, wie der Autor des EFB diese Semantiken umgestaltet und welche Auswirkungen diese Umgestaltungen auf die Figur des Faust haben.
- Transtextualitätstheorie von GÉRARD GENETTE
- Die Darstellung von curiositas in der Historia und im EFB
- Die Darstellung von Melancholie in der Historia und im EFB
- Die Rolle von Mephostophiles in beiden Texten
- Die Transformationen des EFB im Vergleich zur Historia
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die beiden zu analysierenden Texte, die Historia von D. Johann Fausten und The English Faustbook, vor. Sie erläutert die Bedeutung der Historia als Grundlage für alle deutschen Transformationen des Fauststoffs und die Bedeutung des EFB als Grundlage für die englische Fausttradition. Die Einleitung stellt zudem die Forschungsfrage nach der Treue des EFB zur Historia und die beiden zu analysierenden Semantiken, curiositas und Melancholie, vor.
Das zweite Kapitel stellt die Transtextualitätstheorie von GÉRARD GENETTE vor. Es werden die fünf Typen der Transtextualität, Intertextualität, Paratextualität, Metatextualität, Architextualität und Hypertextualität, erläutert und die Hypertextualität als Grundlage für die Analyse der beiden Faustfassungen herausgestellt. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Arten von Transformationen, die bei der Entstehung eines Hypertextes stattfinden können, und die Bedeutung der Transformationen für die Identität der Figuren.
Das dritte Kapitel analysiert die Darstellung von curiositas in der Historia und im EFB. Es untersucht die Entwicklung des Begriffs curiositas und seine Verwendung in der Historia. Es beleuchtet die Rolle von Mephostophiles als Freund und Gegenspieler von Faust und die Auswirkungen von Fausts fehlgerichtetem Forschen. Das Kapitel analysiert die Qualität des Wissens und der Erkenntniswege, die Faust verfolgt, und die Rolle der göttlichen Gnade als Rettungsanker für Faust.
Das vierte Kapitel analysiert die Darstellung von Melancholie in der Historia und im EFB. Es untersucht die Vier-Säfte-Lehre und den Melancholiediskurs des 16. Jahrhunderts. Es beleuchtet Fausts melancholische Komplexion, sowohl seine angeborene melancholische Konstitution als auch das Krankheitsbild der Melancholie. Das Kapitel analysiert die Rolle von Mephostophiles als Arzt für Faust und die Auswirkungen von Mephostophiles' Behandlung auf Fausts melancholischen Zustand.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Historia von D. Johann Fausten, The English Faustbook, Transtextualität, curiositas, Melancholie, Mephostophiles, Transformationen, Identität, Wissensdrang, göttliche Gnade, Vier-Säfte-Lehre, Krankheitsbild, literarische Analyse.
- Quote paper
- B.A. Anne-Marie Schmidt (Author), 2013, Curiositas und Melancholie in der "Historia des D. Johann Fausten" und deren Hypertext "The English Faustbook", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279234