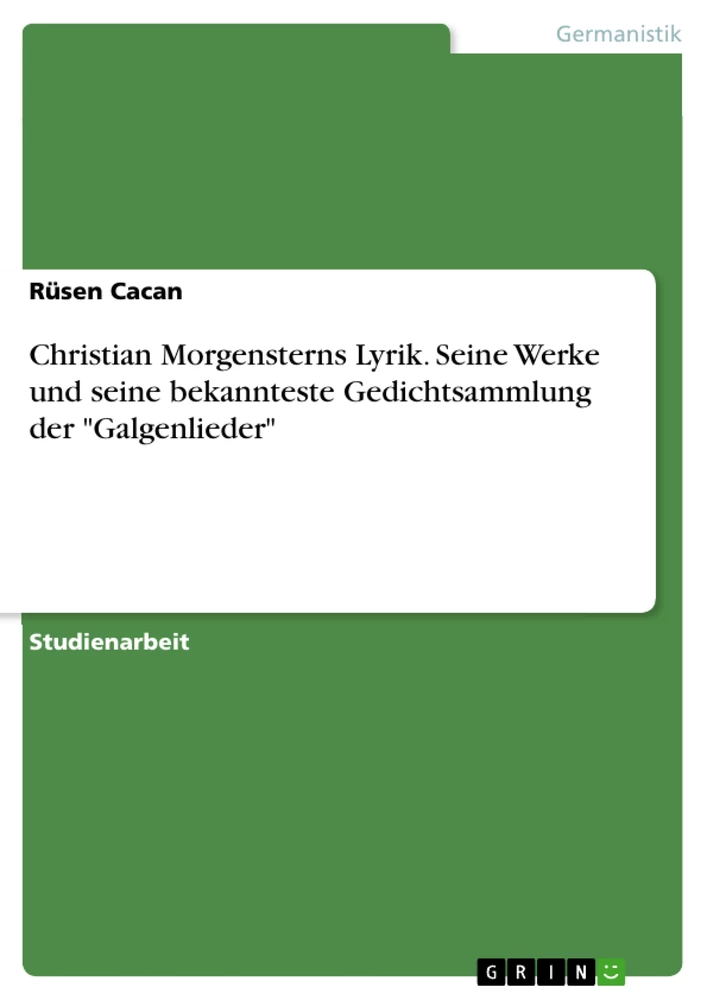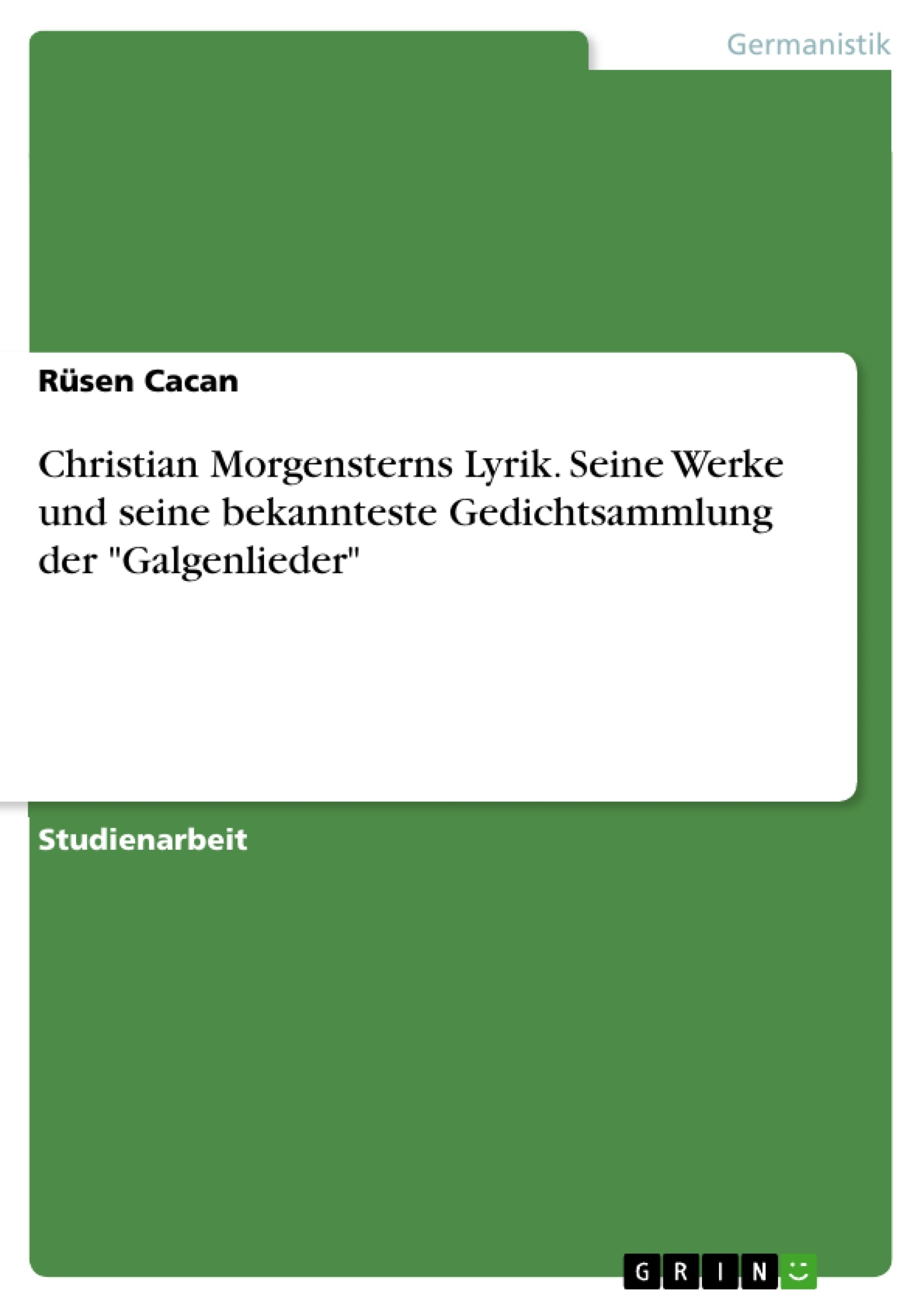Christian Morgenstern hat seine Gedichte „dem Kind im Manne gewidmet, hat Perspektiven gewählt, die zunächst nicht so ernst genommen werden sollten, später hat er aufgrund persönlicher Neigungen auch anthroposophische Deutungen hingelegt. Er war von Nietzsche beeinflusst. „Im ächten Manne ist ein Kind versteckt: das will spielen.“ Dieses Zitat von Friedrich Wilhelm Nietzsche erscheint in fast jeder Auflage von Morgensterns Galgenlieder. Wie stark es mit diesem Werk verbunden ist, verdeutlicht sich nach dem Lesen. Dieses Zitat verkörpert zudem Morgensterns Lebenseinstellung, aber auch diejenige anderer Menschen, die erkannt haben, dass das Leben nicht nur ernst genommen werden sollte. Der Humor verkörpert hierbei eine zusätzliche Hochachtung vor dem Leben.
Als Christian Morgenstern Student war, schrieb er viele Gedichte, sodass manche der Galgenlieder aus seinen Studentenjahren (um 1895) stammen. Er machte in dieser Zeit mit seinen Freunden einen Ausflug zum Galgenberg, der in der Nähe von Berlin liegt. Die Idee für die Namensgebung seiner Sammlung entsprang einer Wanderung zum Galgenberg.
Erst im Jahre 1905 wurden die Galgenlieder herausgegeben, zudem stammen viele in dieser Sammlung erschienene Gedichte aus dieser Zeit. Als er das Studium abgeschlossen hatte, erkrankte er an einer vererbten Lungenkrankheit. Selbst in dieser Zeit verlor er seinen Humor nicht, und nach dem Motto „Humor heilt“, schrieb er weitere lustige Gedichte.
Morgenstern wird mit den Galgenliedern zum Vorbild für die späteren satirischen Lyriker wie Ringelnatz, Tucholsky, Kästner u. a., führte zwar selber auch einen Tradition weiter, die sich von Heinrich Heine her datieren lässt, setzte aber unverkennbare Maßstäbe für die literarische Berechtigung des Humbugs, des kauzigen Humors, des Spottes, der sich selber nicht ernst nimmt.
Er schrieb diese Gedichte in erster Linie zur eigenen Entspannung und später auch um seine Krankheit zeitweise vergessen zu können. Die Galgenlieder galten für ihn nicht als sein Aushängeschild schlechthin. Wichtiger waren die ernsten, philosophisch gestimmten Sammlungen. Allerdings verhalfen ihm jene, im Gegensatz zu den Galgenliedern, nicht zur Berühmtheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leben
- Die Werke
- Galgenlieder
- Wie sich das Galgenkind die Monatsnamen merkt
- Das ästhetische Wiesel
- Auf dem Fliegenplaneten
- Die zwei Wurzeln
- Der Würfel
- Analyse eines Gedichtes von Morgenstern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk des deutschen Lyrikers Christian Morgenstern, insbesondere mit seiner bekanntesten Gedichtsammlung „Galgenlieder“. Ziel ist es, einen Einblick in Morgensterns Leben und seine poetischen Schaffensperioden zu geben, um seine Werke, insbesondere die „Galgenlieder“, besser verstehen zu können.
- Die Entwicklung des Humors in Morgensterns Werk
- Der Einfluss von Nietzsche auf Morgensterns Werk
- Die Bedeutung der „Galgenlieder“ in der deutschen Literatur
- Die Rolle der satirischen Lyrik im 20. Jahrhundert
- Die Auseinandersetzung mit existenziellen Themen in Morgensterns Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Relevanz von Christian Morgensterns Werk für die deutsche Literatur dar. Das zweite Kapitel widmet sich dem Leben des Autors und zeichnet seinen Lebensweg von der Kindheit bis zum Tod nach. Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über Morgensterns Werke und konzentriert sich dabei auf die „Galgenlieder“ als seine bekannteste Gedichtsammlung. In Kapitel vier werden ausgewählte Gedichte aus den „Galgenliedern“ analysiert und in ihren Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
Christian Morgenstern, Galgenlieder, satirische Lyrik, Humor, Nietzsche, Anthroposophie, deutsche Literatur, 20. Jahrhundert, Existenzialismus.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern?
Die 1905 veröffentlichten Galgenlieder sind Morgensterns bekannteste Gedichtsammlung. Sie zeichnen sich durch skurrilen Humor, Sprachspielereien und eine satirische Auseinandersetzung mit dem Leben aus.
Welchen Einfluss hatte Friedrich Nietzsche auf Morgenstern?
Morgenstern war stark von Nietzsches Philosophie beeinflusst, insbesondere von der Idee, dass im Manne ein Kind steckt, das spielen will. Dieser Spieltrieb spiegelt sich in der literarischen Freiheit seiner Gedichte wider.
Wie entstand der Name „Galgenlieder“?
Die Idee entstand während einer Wanderung Morgensterns mit Freunden zum Galgenberg in der Nähe von Berlin um das Jahr 1895.
Welche Bedeutung hat der Humor in Morgensterns Werk?
Für Morgenstern war Humor eine Form der Hochachtung vor dem Leben und ein Mittel, um mit seiner schweren Lungenkrankheit umzugehen („Humor heilt“).
War Morgenstern nur ein humoristischer Dichter?
Nein, er verfasste auch ernste, philosophisch und anthroposophisch gestimmte Werke. Berühmt wurde er jedoch fast ausschließlich durch seine humoristische Lyrik.
- Citation du texte
- Rüsen Cacan (Auteur), 2010, Christian Morgensterns Lyrik. Seine Werke und seine bekannteste Gedichtsammlung der "Galgenlieder", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279522