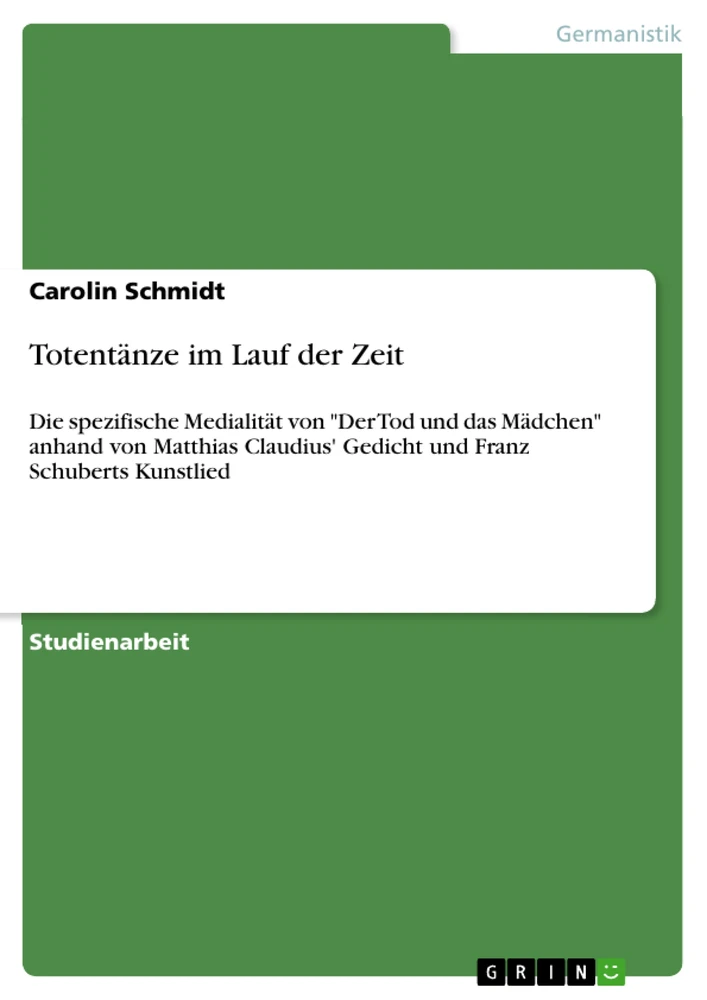Die Vorstellung, im Dunkeln über einen Friedhof zu gehen, löst bis heute bei den meisten Menschen einen Schauer aus. Man denkt an Geister, Dämonen oder gar Vampire, die aus ihren Gräbern steigen und die Menschheit in Angst und Schrecken versetzen. Doch warum ist das so? Ohne Zweifel hat die im frühen 20. Jahrhundert aufkommende Kunstform des Films dazu beigetragen, in denen wir gespenstische Wesen kennenlernen. Verfilmte Romane wie „Frankenstein“ oder Bram Stokers „Dracula“ zählen zu den ersten Horrorfilmen überhaupt. Tatsächlich geht diese Vorstellung von Spukgestalten weit zurück bis ins Mittelalter. Aufgrund der damals aufkommenden Pestwellen beschäftigte man sich intensiver mit dem Thema „Tod“ und es entstanden Totentänze in Form von Handschriften oder Fresken. Wandmalereien, die alte Kirchenmauern schmücken, erinnern an diese makabere Kunst, die sich mit dem Sterben beschäftigt. „Makabere Kunst bedeutet nicht, dass jemand Scherze über das Ende des Lebens macht, sondern weist lediglich auf die Beziehung zum Totenkult hin.“ In der Epoche der Archaik soll es Untersuchungen zufolge sogar einen Totendämon namens „Macabré“ gegeben haben. Außerdem hat sich das Wort möglicherweise aus mehreren Sprachen entwickelt, in denen „makaber“ Grab, Friedhof oder Trauerfeier bedeutet.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Totentänze“. In einem ersten Schritt soll die Entstehung von Totentänzen dargestellt werden. Was ist ein Totentanz überhaupt und welcher Ursprung verbirgt sich dahinter? In welcher Gestalt tritt der Tod auf? Wie wird er dargestellt? Anschließend soll auf die Totentanz-Motive in Literatur, Kunst und Musik eingegangen werden. In welcher Form werden hier Totentänze gezeigt? Diverse Werke, die sich dem Thema „Tod und Mädchen“ nähern, werden dabei als Beispiele herangezogen. Bereits früh wurden die bildlich dargestellten Totentänze in der Kunst mit Texten versehen und somit Geschichten oder Ereignisse zu den Abbildern erzählt. Die Kombination von Literatur und Musik trat jedoch erst später ein. Wie aufschlussreich Totentänze in der Musik sind, soll ebenfalls gezeigt werden.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beziehung von Tod und Mädchen. In den zahlreichen entstandenen Totentänzen wurde der Verbindung von Frauen und Mädchen mit dem Tod eine besondere Bedeutung beigemessen. Der Begegnung dieser zweier Charaktere lag oft eine erotische und sexuelle Komponente zugrunde. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung von Totentänzen
- Totentänze in der Literatur
- Totentänze in der Kunst
- Totentänze in der Musik
- Die besondere Beziehung von Tod und Mädchen
- Matthias Claudius: Der Tod und das Mädchen (1775)
- Franz Schubert: Der Tod und das Mädchen (1817/24)
- Bacio di Tosca: Der Tod und das Mädchen (2007)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema „Totentänze“ und analysiert die Entstehung, Darstellung und Bedeutung dieses Motivs in Literatur, Kunst und Musik. Im Fokus steht die spezifische Beziehung von Tod und Mädchen, die in zahlreichen Totentanz-Darstellungen eine besondere Rolle spielt.
- Entstehung und Entwicklung des Motivs „Totentanz“
- Darstellung des Todes in verschiedenen Kunstformen
- Die Beziehung von Tod und Mädchen in Literatur, Kunst und Musik
- Interpretation von „Der Tod und das Mädchen“ von Matthias Claudius und Franz Schubert
- Die Bedeutung des Totentanz-Motivs im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema „Totentänze“ ein und stellt die Relevanz des Motivs im Laufe der Geschichte dar. Sie beleuchtet die Angst vor dem Tod und den Einfluss der Pest auf die Entstehung von Totentänzen. Zudem wird die Fokussierung der Arbeit auf die Beziehung von Tod und Mädchen hervorgehoben.
- Entstehung von Totentänzen: Dieses Kapitel erörtert die historischen Hintergründe des Totentanz-Motivs und untersucht den Ursprung und die Entwicklung des Motivs. Dabei werden verschiedene Interpretationen des Begriffs „Totentanz“ beleuchtet.
- Die besondere Beziehung von Tod und Mädchen: In diesem Kapitel werden verschiedene Werke analysiert, die sich mit dem Thema „Tod und Mädchen“ auseinandersetzen. Zuerst wird Matthias Claudius' Gedicht „Der Tod und das Mädchen“ interpretiert. Anschließend wird Franz Schuberts gleichnamige Vertonung des Gedichts im Detail betrachtet. Abschließend wird die Vertonung des Gedichts durch das deutsche Musikprojekt „Bacio di Tosca“ vorgestellt.
Schlüsselwörter
Totentänze, Tod und Mädchen, Matthias Claudius, Franz Schubert, Bacio di Tosca, Kunstgeschichte, Literatur, Musik, Tod, Sterblichkeit, Pest, Makaberes, Erotik, Sexualität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung des Totentanz-Motivs?
Das Motiv entstand im Mittelalter, primär ausgelöst durch die verheerenden Pestwellen, die eine intensivere Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit erforderten.
Was bedeutet „makabere Kunst“?
Makabere Kunst bezieht sich auf den Totenkult und die Darstellung des Todes, ohne dabei Scherze über das Lebensende zu machen.
Welche Bedeutung hat das Motiv „Der Tod und das Mädchen“?
Es thematisiert die Begegnung von Unschuld und Endlichkeit, oft mit einer erotischen oder sexuellen Komponente in der künstlerischen Darstellung.
Wie vertonte Franz Schubert das Thema?
Schubert nutzte ein Gedicht von Matthias Claudius für eines seiner berühmtesten Lieder und später für ein Streichquartett, um den Dialog zwischen dem Mädchen und dem Tod musikalisch darzustellen.
In welchen Kunstformen finden sich Totentänze heute?
Neben mittelalterlichen Fresken findet man das Motiv heute in der Literatur, der klassischen Musik sowie in modernen Musikprojekten wie Bacio di Tosca.
- Arbeit zitieren
- Carolin Schmidt (Autor:in), 2014, Totentänze im Lauf der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279587