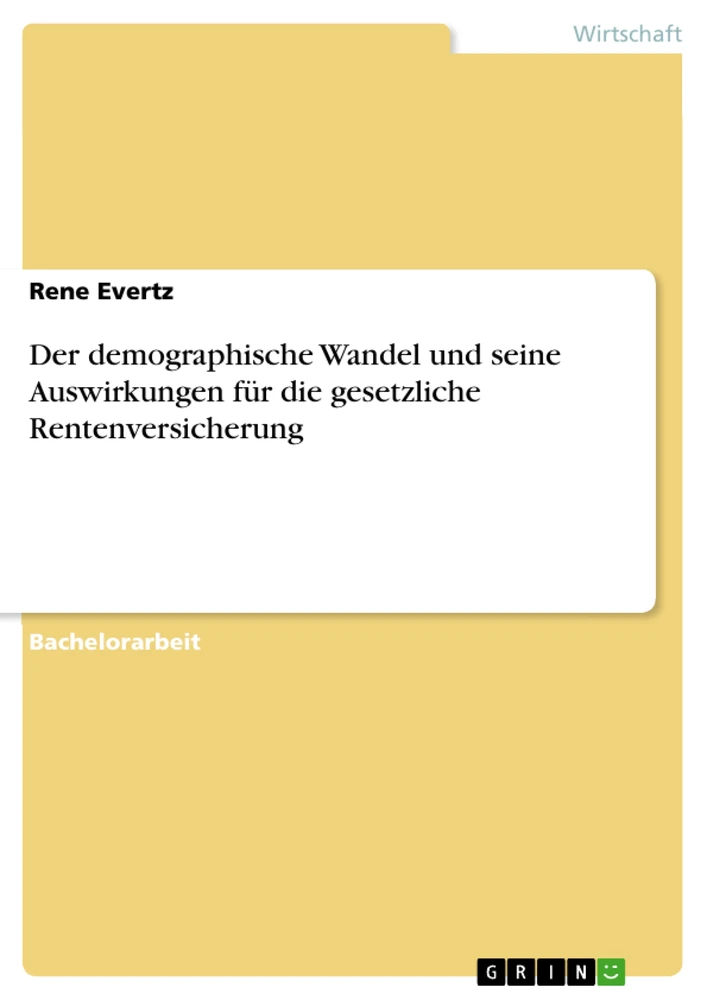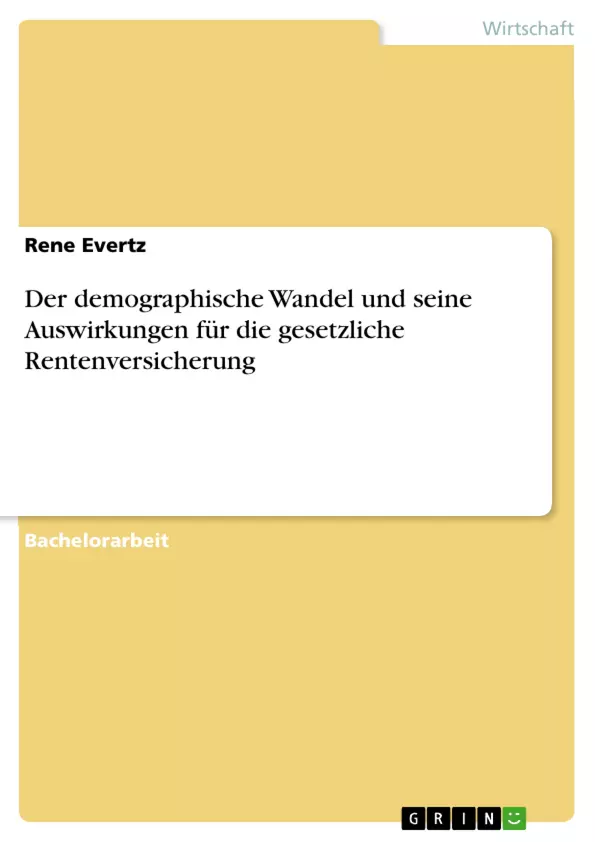Zum 01.10.2013 jährte sich der Weltaltentag und erstmals wurde von der Entwicklungsorganisation HelpAge in Kooperation mit dem Weltbevölkerungsfonds UNFPA ein Weltalten-Index veröffentlich. Darin wird die Situation von älteren Menschen in den im Index aufgeführten 91 Ländern anhand von sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen untersucht und bewertet. Senioren in Schweden, Norwegen und Deutschland geht es dabei am besten. Schlusslicht Afghanistan bietet die schlechtesten Bedingungen für ältere Menschen. Der Studie zufolge wächst die Gruppe der älteren Menschen schneller als jede andere Altersgruppe, so dass es im Jahr 2050 mehr Menschen über 60 Jahre als Kinder unter 15 Jahren geben wird. Die Überalterung der Bevölkerung ist dabei nicht nur in wirtschaftlich starken Ländern zu beobachten, sondern ein globaler Trend. Eine bessere medizinische Vorsorge und Versorgung, sowie Hygiene und eine gesündere Ernährung haben zu einer höheren Lebenserwartung beigetragen, so dass viele Staaten auf das rasante Tempo, dass die Überalterung in den letzten Jahren aufgenommen hat, nicht vorbereitet und teilweise überfordert sind.
Obwohl Deutschland in der Studie eine gute Platzierung erreicht hat, wird der demographische Wandel in Zukunft eine große Herausforderung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung des Landes darstellen. Der aus dem demographischen Wandel resultierende Fachkräftemangel macht sich jetzt schon bemerkbar, so dass große Unternehmen versuchen, durch zusätzliche Anreize, ihre älteren Fachkräfte an sich zu binden. Der Chemiekonzern Bayer, als Beispiel, gewährt seinen Mitarbeitern ab den 57 Lebensjahr 20 Tage, ab dem 60 Lebensjahr 25 Tage und ab den 63 Lebensjahr 30 zusätzliche bezahlte freie Tage.
Die aus dem demographischen Wandel ausgehende Gefahr für die sozialen Sicherungssysteme ist vom Gesetzgeber bereits erkannt. Die Politik in der Bundesre-publik Deutschland versucht durch fiskalische Maßnahmen, wie z.B. Zuschüsse für den Abschluss einer privaten Pflegeversicherung (PflegeBahr) und für die private Altersvorsorge (Riesterrente), sowie Steuererleichterungen für die Rüruprente und der betrieblichen Altersvorsorge, den Bürger zu einer Eigenvorsorge zu motivieren. Trotzdem werden sich künftig die Auswirkungen des demographischen Wandels extrem auf die Sozialsysteme niederschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der demographische Wandel
- Mortalität und Fertilität
- Kennzahlen der Mortalität
- Kennzahlen der Fertilität
- Kombinierte Maße der Mortalität und Fertilität
- Migration
- Messung der Veränderung einer Bevölkerung
- Dynamik der natürlichen Bevölkerungsbewegung
- Mortalitätsrückgang
- Fertilitätsrückgang
- Modell des demographischen Übergangs
- Bevölkerungspyramide
- Mortalität und Fertilität
- Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
- Die demographische Entwicklung in der Vergangenheit
- Die aktuelle demographische Lage
- Fertilität
- Mortalität
- Migration
- Die demographische Entwicklung bis 2060
- Zusammenfassung und Fazit
- Die gesetzliche Rentenversicherung
- Allgemeiner Überblick über die Sozialversicherung
- Die Stellung der GRV innerhalb des deutschen Systems der Alterssicherung
- Die Wirkungsweise des Umlageverfahrens der GRV
- Finanzierungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung
- Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Zusammenhang zwischen Rentenversicherung und Arbeitsmarkt
- Zusammenfassung und Fazit
- Nachhaltigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung
- Die Generationenbilanzierung
- Nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Einfluss des demographischen Wandels auf die nachhaltige Finanzierung
- Zusammenfassung und Fazit
- Reformmöglichkeiten der GRV
- Erhöhung des Renteneintrittsalters
- Lebenserwartungsfaktor
- Zusammenfassung und Fazit
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). Der Fokus liegt auf der Analyse der Nachhaltigkeit der GRV angesichts der demographischen Veränderungen in Deutschland.
- Die demographische Entwicklung in Deutschland
- Der Einfluss des demographischen Wandels auf die Finanzierung der GRV
- Die Herausforderungen für die Nachhaltigkeit der GRV
- Mögliche Reformansätze zur Sicherung der GRV
- Die Bedeutung des Generationenvertrages für die GRV
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 erläutert den demographischen Wandel anhand der Faktoren Fertilität, Mortalität und Migration. Es werden die wichtigsten Kennzahlen vorgestellt und das Modell des demographischen Übergangs erklärt.
Kapitel 3 behandelt die demographische Entwicklung in Deutschland, beginnend mit einem historischen Überblick bis zur aktuellen Situation und einer Prognose bis 2060.
Kapitel 4 beschreibt die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland, einschließlich ihrer Funktionsweise und ihres Finanzierungssystems.
Kapitel 5 geht auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit der GRV ein und erläutert die Methode der Generationenbilanzierung.
Kapitel 6 diskutiert Reformmöglichkeiten der GRV, insbesondere die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Einführung eines Lebenserwartungsfaktors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem demographischen Wandel, den Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung, der Nachhaltigkeit der GRV, Generationenbilanzierung, Reformmöglichkeiten, Alterung der Gesellschaft, Fertilitätsrückgang, Mortalitätsrückgang, Migration, Beitragssatz, Sicherungsniveau, Lebenserwartung, Renteneintrittsalter, Lebenserwartungsfaktor.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich der demographische Wandel auf die Rentenversicherung aus?
Durch sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartung müssen immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner aufkommen, was die Finanzierung des Umlageverfahrens gefährdet.
Was ist das Umlageverfahren?
Es ist das Finanzierungssystem der GRV, bei dem die aktuellen Beitragszahler direkt die Renten der aktuellen Rentner finanzieren (Generationenvertrag).
Welche Reformmöglichkeiten werden diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Einführung eines Lebenserwartungsfaktors.
Was bedeutet Generationenbilanzierung?
Dies ist eine Methode zur Messung der Nachhaltigkeit der Fiskalpolitik, die untersucht, welche Lasten künftige Generationen tragen müssen.
Wie entwickelt sich die Bevölkerung bis 2060?
Prognosen zeigen eine deutliche Überalterung und eine Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Rene Evertz (Autor:in), 2014, Der demographische Wandel und seine Auswirkungen für die gesetzliche Rentenversicherung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279603