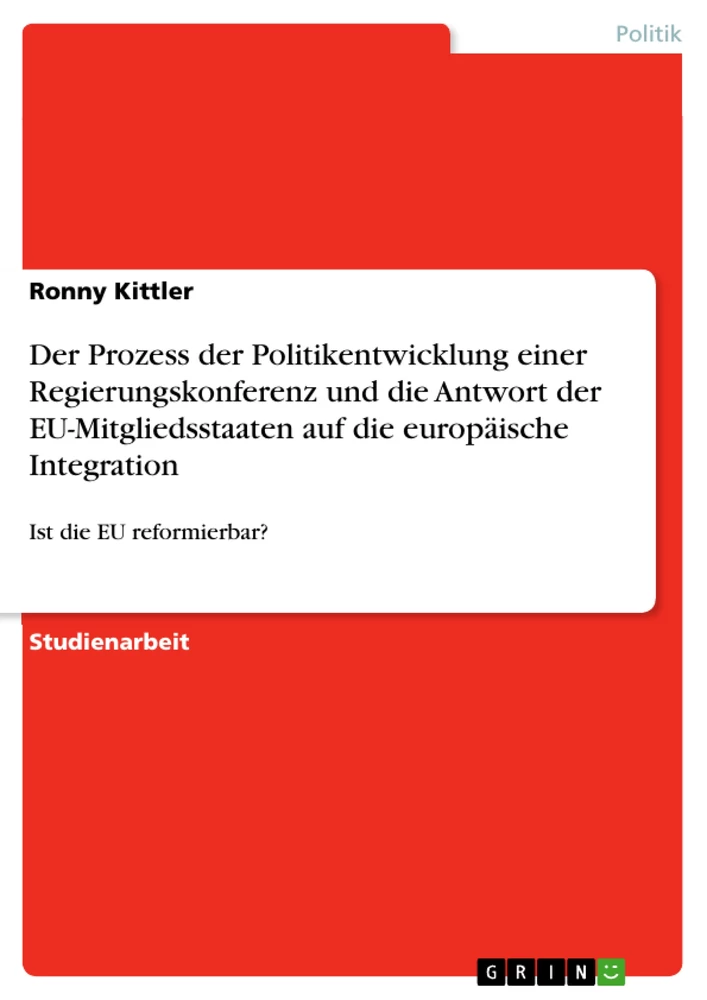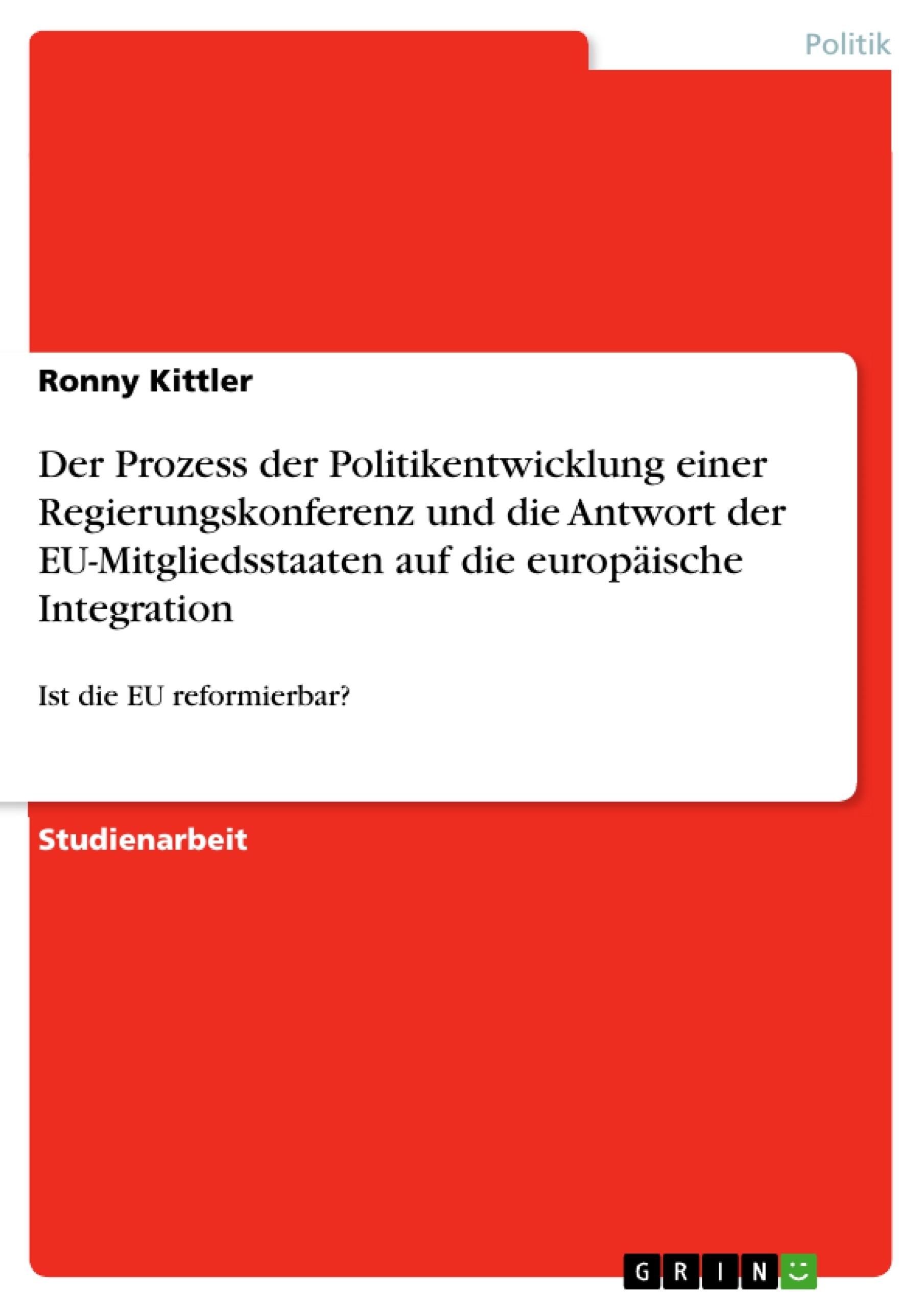Einleitung
Die Regierungskonferenz im Jahr 2000 sollte, durch die Revision des Vertages von Amsterdam, zu einer reformierten Europäischen Union führen, die auf die kommenden Herausforderungen der Osterweiterung und der fortschreitenden Vertiefung, der bereits bestehenden Integration, besser reagieren könnte. Doch anstelle einer gelungenen Reform spiegelt der Vertrag von Nizza den 1992 beginnenden, sukzessiven Reformstau innerhalb der EU Institutionen wieder. Die Reformunfähigkeit der EU resultiert, meiner Meinung nach, aus fest verankerten Politikentwicklungsprozessen und Handlungsstrategien der Mitgliedsstaaten, die es kaum ermöglichen, grundlegende Vertragsrevisionen durchzuführen. Die dadurch induzierte Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, macht notwendige Anpassungen des Institutionengefüges und der Entscheidungsmechanismen kaum oder nur langsam möglich. Das Verständnis der Entstehung und Beständigkeit dieser Prozesse und Strategien erfordert eine Analyse der Auswirkungen europäischer Integration auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene, der sogenannten „bottom up“ Dimension, versuchen verschiedene nationale und transnationale Akteure ihre Interessen auf die Agenda der Regierungskonferenz zu setzen. Die Regierungskonferenz wandelt diese gelieferten Inputs mit Hilfe von bestimmten Entscheidungsprozessen und -typen in Outputs um. Diese Outputs sind die gemeinsamen Normen, Regeln und Verfahren, die das institutionelle Erscheinungsbild der EU definieren und deren Politikprogramme bestimmen (EGV und EUV). Auf der zweiten Ebene, der „top down“ Dimension, haben diese primärrechtlich bestimmten Politikprogramme weitreichende sekundärrechtliche Auswirkungen (Richtlinien, Verordnungen etc.) auf nationalstaatliche Polity, Politics und Policy1.
Zuerst möchte ich die zwei Ebenen systemanalytisch als Politikentwicklungsprozeß darstellen. Die Betrachtung differenziert den Prozeß der Politikentwicklung in drei Dimensionen: Input-Konversion-Output. Anschließend möchte ich zeigen, daß die Mitgliedsstaaten spezielle Handlungsstrategien entwickelt haben, um die Rückkopplungseffekte der Outputs auf ihr System kostenminimal und gewinnmaximal zu gestalten. Die Analyse der Handlungsstrategien wird mich zu dem Schluß führen, daß eine grundlegende Reform der EU nicht zu erwarten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Prozeß der Politikentwicklung einer Regierungskonferenz
- Die Input-Dimension
- Die Mitgliedstaaten
- Die europäische Verwaltung
- "pressure groups" und die Öffentliche Meinung
- Experten
- Die Konversion-Umwandlung von Inputs zu Outputs
- Ein Modell des politischen Entscheidungsprozesses und Typen von Entscheidungen
- Die Output-Dimension
- Von Entscheidungen zu Programmen
- Die Rückkopplung anhand eines Beispiels erklärt
- Drei mögliche Handlungsstrategien für Mitgliedstaaten
- Pace Setting
- Foot-Dragging
- Fence-Sitting
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der Hausarbeit ist es, den Politikentwicklungsprozess einer Regierungskonferenz im Kontext der Europäischen Union zu analysieren. Es soll untersucht werden, wie nationale und transnationale Akteure ihre Interessen in den Entscheidungsprozess einbringen und wie die Regierungskonferenz diese Inputs in Outputs umwandelt. Darüber hinaus werden die Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Rückkopplungseffekte der Outputs auf ihre Systeme beleuchtet.
- Analyse des Politikentwicklungsprozesses einer Regierungskonferenz als offenes System
- Bedeutung der Input-Dimension und der verschiedenen Akteure (Mitgliedstaaten, europäische Verwaltung, "pressure groups", Experten)
- Konversion von Inputs zu Outputs und die Rolle von Entscheidungsmechanismen und -typen
- Auswirkungen der Outputs auf nationale und transnationale Akteure in der „top down“ Dimension
- Analyse von Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten zur Minimierung der Kosten und Maximierung des Gewinns der Outputs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der Reformunfähigkeit der Europäischen Union, die aus fest verankerten Politikentwicklungsprozessen und Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten resultiert. Es wird eine systemanalytische Betrachtung des Politikentwicklungsprozesses auf zwei Ebenen ("bottom up" und "top down") vorgestellt.
Im zweiten Kapitel wird der Politikentwicklungsprozess einer Regierungskonferenz als offenes System dargestellt. Die Input-Dimension umfasst die verschiedenen Akteure und ihre Interessen, die auf die Agenda der Regierungskonferenz Einfluss nehmen. Die Konversion-Dimension beschreibt die Umwandlung der Inputs in Outputs durch Entscheidungsmechanismen und -typen. Die Output-Dimension befasst sich mit den Auswirkungen der Entscheidungen auf die Politikprogramme und das institutionelle Erscheinungsbild der EU.
Kapitel drei präsentiert drei mögliche Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten: "Pace Setting", "Foot-Dragging" und "Fence-Sitting". Diese Strategien dienen dazu, die Rückkopplungseffekte der Outputs auf die nationalen Systeme kostenminimal und gewinnmaximal zu gestalten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Reformunfähigkeit der EU, der Politikentwicklungsprozess von Regierungskonferenzen, die Input- und Output-Dimensionen, die verschiedenen Akteure im Entscheidungsprozess, Entscheidungsmechanismen und -typen sowie die Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten. Wichtige Konzepte sind die "bottom up" und "top down" Dimension, die "black box" und die Kosten-Gewinn-Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die EU oft reformunfähig?
Die Reformunfähigkeit resultiert oft aus festgefahrenen Entscheidungsprozessen und Handlungsstrategien der Mitgliedstaaten, die meist nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zulassen.
Was ist der Unterschied zwischen „Bottom-up“ und „Top-down“ in der EU-Integration?
Bottom-up beschreibt, wie Akteure Interessen auf die Agenda setzen; Top-down bezeichnet die Auswirkungen europäischer Programme und Normen auf die Nationalstaaten.
Welche Handlungsstrategien nutzen Mitgliedstaaten?
Es gibt drei Hauptstrategien: Pace-Setting (Vorreiterrolle), Foot-Dragging (Verzögerung) und Fence-Sitting (neutrales Abwarten), um Kosten zu minimieren und Gewinne zu maximieren.
Welche Rolle spielen Regierungskonferenzen?
Regierungskonferenzen dienen der Revision von EU-Verträgen (wie dem Vertrag von Nizza), um die Union an neue Herausforderungen wie die Osterweiterung anzupassen.
Wer sind die Akteure in der Input-Dimension?
Dazu gehören die Mitgliedstaaten, die europäische Verwaltung, Pressure Groups (Interessengruppen), Experten und die öffentliche Meinung.
- Citar trabajo
- Ronny Kittler (Autor), 2002, Der Prozess der Politikentwicklung einer Regierungskonferenz und die Antwort der EU-Mitgliedsstaaten auf die europäische Integration, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27961