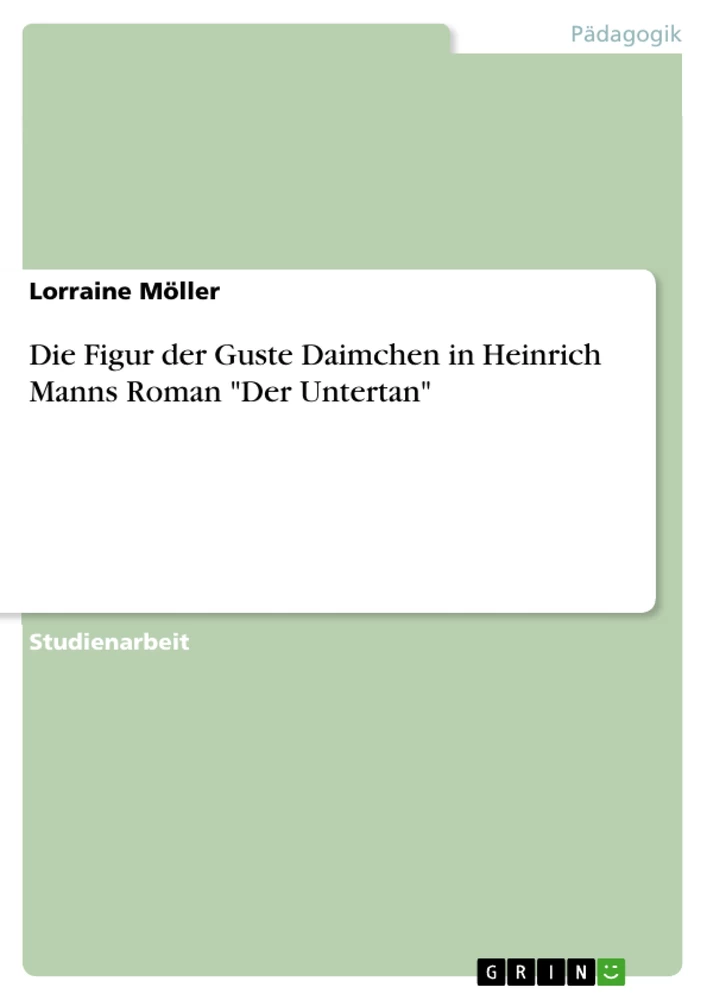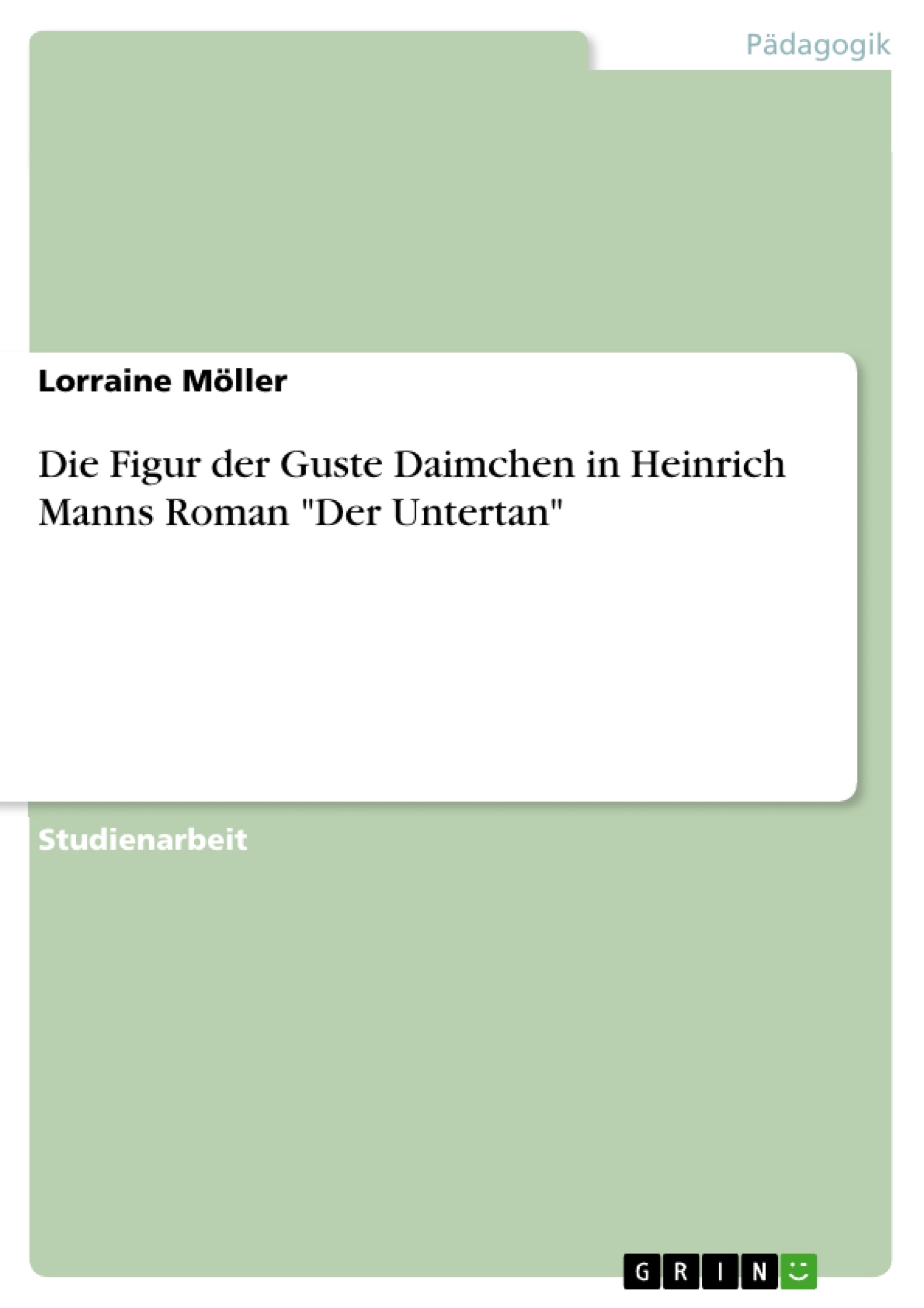Auch wenn einige Kritiker unterstellen, Heinrich Mann habe mit seinem Roman „Der Untertan“ lediglich ein literarisches Pamphlet geschaffen, so ist es dem Autor zweifellos gelungen, mit seiner Hauptfigur einen Typus, „der für die deutsche Geschichte so repräsentativ wie verhängnisvoll war, treffsicher auf die literarische Bühne zu stellen.“ Was von der Wirkung des Werks für die Zukunft bleibt, ist „das Denkmal einer Übergangszeit, unerbittlicher, aber auch stärker, als alle anderen Denkmäler, die sie geschaffen hat“, wie Paul Block im Berliner Tageblatt 1918 erklärt.
Während Heinrich Mann in einem Brief an Ludwig Ewers 1894 betont, dass ihm nichts über „richtig gesehene, eindrucksvolle Frauengestalten“ gehe und sie der „Prüfstein für jeden Dichter“ seien, haben seine Frauenfiguren in der Forschung – im Gegensatz zur Figur Diederich Heßlings oder dem Strukturprinzip der Satire – auffallend wenig Beachtung gefunden. Dies überrascht, denn es sind gerade die Frauen, die die hierarchische Ordnung in Netzigs Männergesellschaft stützen, und es ist Guste Daimchen, die spätere Frau Generaldirektor Heßling, die unter zeitkritischer Perspektive nicht weniger satirisch gezeichnet ist als Diederich Heßling selbst. Dass Heinrich Mann Guste Daimchen ganz im Klischee ihrer zeitgenössischen Geschlechterrolle konzipiert, sie auffällig sorgfältig an die Kaisergattin Auguste Viktoria anlehnt und nur durch ihre Person ermöglicht, dass die Hauptfigur zum „ökonomisch wie politisch mächtigsten Mann von Netzig“ avanciert, spricht zweifellos für ihre wichtige Bedeutung im Roman. Ihr Wesen und ihre Beziehung zu Diederich Heßling sollen daher in dieser Arbeit im Fokus der Betrachtung stehen.
Um die Figur von Guste Daimchen näher zu untersuchen, wird zunächst auf die gesellschaftliche Rolle der Frau im Roman eingegangen und gezeigt, dass die Ehe nicht als Liebesvermählung, sondern als profitables Geschäft verstanden wird. Darauf aufbauend werden Parallelen zwischen der Kaisergattin Auguste Viktoria und der Figur Guste Daimchens aufgedeckt.
Im anschließenden Teil werden die wichtigsten Begegnungen bzw. das spätere Ehe- und Familienleben der Heßlings analysiert. Es wird sich zeigen, dass Heinrich Mann mit der berechnenden Guste Daimchen ein perfektes Gegenstück zu Diederich konzipiert, da beide gleichermaßen auf Prestige, Geld und bloße Körperlichkeiten fixiert sind. Ihre Heirat, weit entfernt von Gründen einer echten Zuneigung, wird sich für beide als gewinnbringe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ansatzpunkte für die Bedeutung von Guste Daimchen
- 2.1 Die gesellschaftliche Rolle der Frau im Roman
- 2.2 Die Ehe als profitables Hochzeitsarrangement
- 2.3 Die Kaisergattin Auguste Viktoria als Bezugsquelle für Guste Daimchen
- 3. Das Wesen von Guste Daimchen und die Beziehung zu ihrem Gatten Diederich Heßling
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Figur Guste Daimchen in Heinrich Manns Roman „Der Untertan“. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Figur im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse des Kaiserreichs zu beleuchten und ihre Beziehung zu Diederich Heßling zu analysieren.
- Die gesellschaftliche Rolle der Frau im Kaiserreich und im Roman
- Die Ehe als wirtschaftliches und soziales Arrangement
- Der Vergleich zwischen Guste Daimchen und Kaiserin Auguste Viktoria
- Die Charakterisierung Gustes Daimchens und ihre Beziehung zu Diederich Heßling
- Die satirische Darstellung der Geschlechterrollen im Kaiserreich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Figur Guste Daimchen in Heinrich Manns „Der Untertan“ heraus, obwohl sie in der Forschung im Vergleich zu Diederich Heßling bisher wenig Beachtung gefunden hat. Sie betont die Bedeutung Gustes für Diederichs Aufstieg und argumentiert, dass ihre Rolle im Roman nicht weniger satirisch ist als die seines. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Gustes Wesen und ihrer Beziehung zu Diederich.
2. Ansatzpunkte für die Bedeutung von Guste Daimchen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die Analyse der Figur Guste Daimchen. Es beleuchtet zunächst die gesellschaftliche Rolle der Frau im Kaiserreich, die durch finanzielle und moralische Zwänge stark eingeschränkt war und die Frauen von grundlegenden Bürgerrechten ausschloss. Die Ehe wird als profitables Geschäft dargestellt, im Gegensatz zu einer Liebesvermählung. Anschließend werden Parallelen zwischen Guste Daimchen und Kaiserin Auguste Viktoria aufgezeigt, um Gustes Charakter und ihre Motivationen besser zu verstehen. Das Kapitel dient als analytische Brücke zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Figur.
Schlüsselwörter
Guste Daimchen, Heinrich Mann, Der Untertan, Kaiserreich, Geschlechterrollen, Frauenrolle, Ehe, Satire, Auguste Viktoria, Gesellschaftliche Verhältnisse, Hochzeitsarrangement, Zeitkritik.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich Manns "Der Untertan" - Fokus Guste Daimchen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle der Figur Guste Daimchen in Heinrich Manns Roman "Der Untertan". Im Gegensatz zu Diederich Heßling, der in der Forschung mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, konzentriert sich diese Arbeit auf die Bedeutung Gustes für den Roman und ihre Beziehung zu Diederich.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Rolle der Frau im Kaiserreich, die Ehe als wirtschaftliches und soziales Arrangement, den Vergleich zwischen Guste Daimchen und Kaiserin Auguste Viktoria, die Charakterisierung Gustes Daimchens und ihre Beziehung zu Diederich Heßling sowie die satirische Darstellung der Geschlechterrollen im Kaiserreich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Ansatzpunkten für die Bedeutung von Guste Daimchen (inklusive der gesellschaftlichen Rolle der Frau, der Ehe als Arrangement und des Vergleichs mit Kaiserin Auguste Viktoria), ein Kapitel zum Wesen von Guste Daimchen und ihrer Beziehung zu Diederich Heßling und eine Zusammenfassung.
Wie wird die Figur Guste Daimchen charakterisiert?
Die Arbeit analysiert Guste Daimchens Charakter und ihre Motivationen im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse des Kaiserreichs. Der Vergleich mit Kaiserin Auguste Viktoria dient als Instrument, um ein tieferes Verständnis ihrer Rolle zu ermöglichen. Ihre Rolle wird als mindestens genauso satirisch wie die Diederichs dargestellt.
Welche Bedeutung hat die Ehe im Kontext der Arbeit?
Die Ehe wird nicht als Liebesvermählung, sondern als ein profitables und soziales Arrangement dargestellt, das die gesellschaftliche Stellung der Frau beeinflusst und von finanziellen und moralischen Zwängen geprägt ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Guste Daimchen, Heinrich Mann, Der Untertan, Kaiserreich, Geschlechterrollen, Frauenrolle, Ehe, Satire, Auguste Viktoria, Gesellschaftliche Verhältnisse, Hochzeitsarrangement, Zeitkritik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung der Figur Guste Daimchen im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse des Kaiserreichs zu beleuchten und ihre Beziehung zu Diederich Heßling zu analysieren. Die Arbeit hebt die bisher vernachlässigte Rolle Gustes Daimchens in der Forschung hervor.
Welche Quellen werden verwendet?
Die konkreten Quellen werden in der vollständigen Arbeit genannt, diese Übersicht bietet nur einen Auszug der Thematik.
- Quote paper
- M. Sc. Lorraine Möller (Author), 2014, Die Figur der Guste Daimchen in Heinrich Manns Roman "Der Untertan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279616