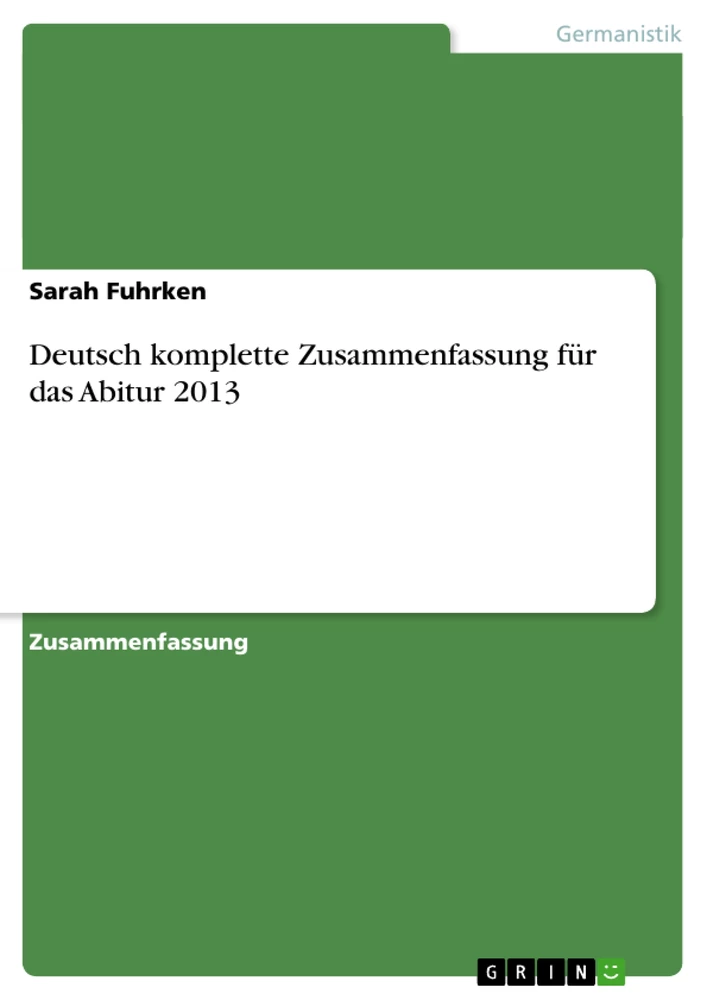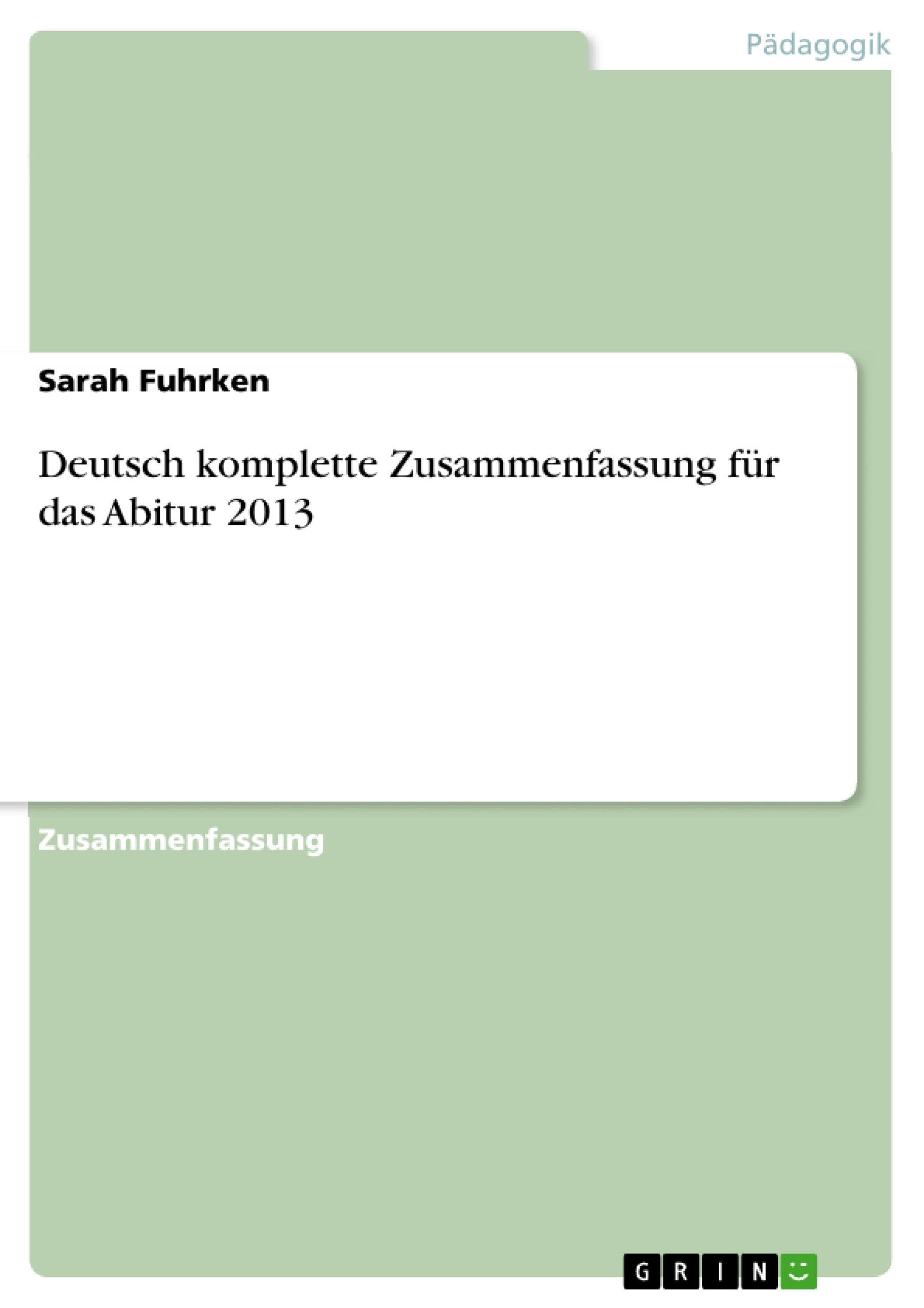Die Zusammenfassung ist sehr ausführlich und bezieht sich (unter anderem) auf folgende Aspekte:
-Interpretation und Analyse
- Literatur und Sprache um 1800
- Drama und Kommunikation
- Literatur und Sprache um 1900
- Vielfalt lyrischen Sprechens
- Literatur und Sprache von 1945 bis zur Gegenwart
- Epochen (sehr ausführlich)
- Faserland
- Kabale und Liebe
- Der gute Mensch von Sezuan
....und noch viel mehr
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemein
- a. Epochenumbrüche
- b. Zentrale Autoren
- c. Allgemeiner Aufbau
- d. Epischer Text
- i. Genre
- ii. Darstellungsformen
- iii. Rede- & Gedankenwiedergabe
- iv. Erzählhaltung
- v. Erzählform & -perspektive
- vi. Erzählverhalten
- vii. Figurenkonzeption
- viii. Zeit
- ix. Analyse und Interpretation
- e. Drama
- i. Genre
- ii. Aufbau
- iii. Figurenrede
- iv. Figurenkonzeption
- v. Charakterisierung
- vi. Szenenanalyse
- f. Lyrischer Text
- i. Genre
- ii. Bildlichkeit
- iii. Klanggestalt
- iv. Reim
- v. Vers
- vi. Rhythmus und Metrum
- vii. Analyse & Interpretation
- g. Analyse & Erörterung pragmatischer Texte
- i. Aspekte
- ii. Argumentationsweise
- iii. Sanduhrmodell oder These-Gegenthese-Modell
- h. Redeanalyse
- i. Adressatenbezogenes Schreiben
- j. Gestaltendes Interpretieren
- k. Sprachanalyse
- 2. 1. Semester: Literatur & Sprache um 1800 / Drama und Kommunikation
- a. Periodisierung
- a. Warum ist Periodisierung wichtig
- b. Probleme
- b. Auswirkungen des aufklärerischen Gedanken
- c. Bedeutung alter Texte heute
- d. Entstehung & Bedeutung des Theaters in der Antike
- a. Theorie von Aristoteles in „Poetik“
- i. Komödie
- ii. Tragödie
- iii. Katharsis
- iv. Held einer Tragödie
- e. Theater im 18. Jahrhundert
- a. Entstehung durch Lessing
- b. Gottscheds Regelpoetik
- c. Theatertheorien Gottscheds und Lessing im Vergleich
- f. geschlossenes & offenes Drama
- g. Struktur des Dramas nach Freytag
- h. Theater als moralische Anstalt
- a. Schaubühne (Schiller)
- i. Sturm und Drang
- a. bürgerliches Trauerspiel
- j. Lessing: Hamburgische Dramaturgie
- k. Kabale und Liebe
- a. Figuren
- b. Handlung
- c. Sprache
- d. Intrige
- e. Ferdinands Beziehung zu Luise
- f. Kabale und Liebe als Stück des Sturm und Drang
- g. Ferdinand als Stürmer und Dränger
- h. Konflikte
- l. Romantik
- a. Motive
- b. Romantik als Ausdruck einer Krisenerfahrung
- c. Romantik & Aufklärung im Vergleich
- d. Gemeinsamkeiten
- m. Bertold Brecht
- a. Dramatisches und Episches Theater im Vergleich
- b. offene Parabelform
- n. Der gute Mensch von Sezuan
- a. Inhalt
- 3. 2.Semester: Literatur und Sprache um 1900 / Vielfalt lyrischen Sprechens
- a. Moderne
- i. Umbruch
- b. Traditionelles & Modernes Erzählen im Vergleich
- c. Effi Briest
- i. Inhalt
- ii. Stil
- d. Fräulein Else
- i. Inhalt
- ii. Stil
- e. Effi und Else im Vergleich
- f. Was ist der Mensch?
- i. Wandel des Menschenbildes
- ii. Freuds psychischer Apparat
- 1. Das Es
- 2. Das Ich
- 3. Das Über-Ich
- iii. Nihilismus
- iv. Vergleich „Das Göttliche“ & „Arzt II“
- v. Lebenskrisen & Identitätsprobleme
- vi. Stationen des Lebens
- g. Frauenbilder
- i. Ideal
- ii. Typen
- 1. Femme fragile
- 2. Femme fatale
- iii. Rollenverhalten der Frau im Wandel
- h. Liebe
- i. lyrische Themen
- ii. Liebesauffassung im Mittelalter
- iii. Liebesauffassung im Barock
- iv. Liebesauffassung im Sturm und Drang
- v. Liebesauffassung in der Klassik
- vi. Liebesauffassung in der Romantik
- vii. Liebesauffassung im Realismus
- viii. Liebesauffassung in der Moderne
- ix. Liebesauffassung in der Postmoderne
- 4. 3. Semester: Literatur & Sprache von 1945 – Gegenwart
- a. Gesellschaftliche Veränderungen nach 1945
- b. Adoleszenzliteratur allgemein
- c. Adoleszenz im Wandel
- d. Jugendliteratur im Wandel
- i. Trümmerliteratur
- ii. Jugendliteratur der 60er
- iii. Neue Jugend (90er)
- iv. Wandel im Vergleich
- v. Unterschiede DDR/BRD
- e. Postmodernes Erzählen
- i. Popliteratur
- 1. Intertextualität
- ii. Popliteratur und Jugendkultur in den Medien
- f. Die Generation Golf
- i. Die Generation Golf in der Literatur
- ii. Ätsch, wir haben mehr Golf als ihr
- g. Faserland
- i. Titel
- ii. Inhalt/Analyse
- iii. Hurrelman zu Faserland
- iv. Erzählperspektiven & -haltung
- v. Elemente modernen Erzählens
- vi. Intertextualität
- 1. Der Tod in Venedig
- 2. American Psycho
- 3. Griechische Mythologie
- vii. Beziehungen des Ich-Erzählers zu anderen
- h. Merkmale der Gegenwartssprache
- i. Theorien des Sprachwandels
- i. Bastian Sick
- ii. André Meinunger
- iii. Peter Schlobinski
- iv. Dieter E. Zimmer
- v. Verein Deutsche Sprache
- vi. Winifred V. Davies
- vii. Rudi Keller
- viii. Jens Jenssen
- ix. Eckart Werthebach
- x. Gerhard Illgner
- xi. Peter Eisenberg
- xii. Peter von Polenz
- xiii. Joachim Heinrich Campe
- xiv. Barbara Sandig
- j. Varietäten der deutschen Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die deutsche Literatur und Sprache von verschiedenen Epochen zu geben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung literarischer Formen, der Veränderung des Menschenbildes und der sprachlichen Entwicklung. Die Arbeit analysiert verschiedene literarische Gattungen und untersucht wichtige literaturgeschichtliche Strömungen.
- Entwicklung literarischer Gattungen (Epik, Dramatik, Lyrik)
- Wandel des Menschenbildes in verschiedenen Epochen
- Sprachwandel und sprachliche Varietäten
- Analyse wichtiger literarischer Strömungen (Aufklärung, Sturm und Drang, Romantik, Moderne, Postmoderne)
- Bedeutung von Literatur im gesellschaftlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemein: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik und bietet einen Überblick über die verschiedenen Epochen, zentralen Autoren und die grundlegenden Strukturen epischer, dramatischer und lyrischer Texte. Es legt die methodischen Grundlagen für die Analyse und Interpretation literarischer Werke und pragmatischer Texte dar, einschließlich der Sprachanalyse.
2. 1. Semester: Literatur & Sprache um 1800 / Drama und Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht die Literatur und Sprache um 1800, mit besonderem Fokus auf das Drama und die Kommunikation. Es behandelt die Periodisierung der Epoche, die Auswirkungen der Aufklärung, die Bedeutung des antiken Theaters (Aristoteles’ Poetik), die Entwicklung des Theaters im 18. Jahrhundert (Lessing vs. Gottsched), die Struktur des Dramas nach Freytag, und die Strömungen Sturm und Drang und Romantik, inklusive detaillierter Analysen von Stücken wie Schillers "Kabale und Liebe". Die Kapitel vergleicht verschiedene Theatertheorien und beleuchtet die Rolle des Theaters als moralische Instanz.
3. 2.Semester: Literatur und Sprache um 1900 / Vielfalt lyrischen Sprechens: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Literatur und Sprache um 1900, den Übergang zur Moderne und die damit einhergehenden Veränderungen im Erzählen, dargestellt an Beispielen wie Fontanes "Effi Briest" und Schnitzlers "Fräulein Else". Der Wandel des Menschenbildes, beeinflusst von Sigmund Freud und dem Nihilismus, sowie die Entwicklung des Frauenbildes und der Vorstellungen von Liebe in verschiedenen Epochen werden eingehend betrachtet. Die Analyse der Texte betont die stilistischen Unterschiede und die Bedeutung von literarischen Werken für die gesellschaftliche und psychologische Reflexion.
4. 3. Semester: Literatur & Sprache von 1945 – Gegenwart: Dieses Kapitel analysiert die Literatur und Sprache der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Es untersucht gesellschaftliche Veränderungen, die Entwicklung der Adoleszenzliteratur, den Wandel der Jugendliteratur (Trümmerliteratur, 60er, 90er), postmodernes Erzählen, die "Generation Golf" und deren literarische Repräsentation (beispielsweise in "Faserland"), sowie aktuelle Merkmale der deutschen Sprache und verschiedene Theorien des Sprachwandels. Die Analyse von "Faserland" beleuchtet dabei die Anwendung von intertextuellen Bezügen und modernen Erzähltechniken.
Schlüsselwörter
Deutsche Literatur, Sprachgeschichte, Epochen, Aufklärung, Sturm und Drang, Romantik, Realismus, Moderne, Postmoderne, Drama, Epik, Lyrik, Menschenbild, Sprachwandel, Analyse, Interpretation, Lessing, Schiller, Goethe, Freud, Intertextualität, Adoleszenzliteratur, Gesellschaft, Kultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Inhaltsverzeichnis der deutschen Literatur- und Sprachgeschichte
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Arbeit?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in vier Hauptkapitel, die einen umfassenden Überblick über die deutsche Literatur- und Sprachgeschichte bieten. Kapitel 1 dient als allgemeine Einführung in die verschiedenen literarischen Gattungen (Epik, Dramatik, Lyrik) und Methoden der Textanalyse. Kapitel 2 befasst sich mit der Literatur und Sprache um 1800, Kapitel 3 mit der Literatur und Sprache um 1900 und Kapitel 4 mit der Literatur und Sprache von 1945 bis zur Gegenwart. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Unterabschnitte, die spezifische Epochen, Autoren, Werke und literaturwissenschaftliche Themen behandeln.
Welche Epochen der Literaturgeschichte werden behandelt?
Die Arbeit deckt einen breiten Zeitraum der deutschen Literaturgeschichte ab, beginnend mit der Antike und dem Einfluss von Aristoteles' Poetik, über die Aufklärung, Sturm und Drang, Romantik, Realismus, Moderne und Postmoderne bis hin zur Gegenwart. Die einzelnen Epochen werden jeweils mit ihren charakteristischen Merkmalen, Autoren und Werken dargestellt.
Welche literarischen Gattungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die drei Hauptgattungen der Literatur: Epik (erzählende Texte), Dramatik (Theaterstücke) und Lyrik (Gedichte). Für jede Gattung werden spezifische analytische Methoden und Kriterien vorgestellt.
Welche Schlüsselwerke und Autoren werden behandelt?
Zu den behandelten Schlüsselwerken gehören Schillers „Kabale und Liebe“, Fontanes „Effi Briest“, Schnitzlers „Fräulein Else“ und weitere Werke der Postmoderne wie „Faserland“. Wichtige Autoren wie Lessing, Schiller, Goethe, Brecht, sowie Vertreter der Moderne und Postmoderne werden diskutiert.
Welche Themen werden im Zusammenhang mit dem Menschenbild behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Menschenbildes in den verschiedenen Epochen. Der Einfluss von Sigmund Freud und dem Nihilismus auf das Verständnis des Menschen in der Moderne wird ausführlich behandelt. Zudem wird die Entwicklung des Frauenbildes und der Vorstellungen von Liebe in verschiedenen Epochen analysiert.
Wie wird der Sprachwandel thematisiert?
Der Sprachwandel wird in einem eigenen Kapitel behandelt, das sich mit verschiedenen Theorien des Sprachwandels und den Varietäten der deutschen Sprache befasst. Es werden verschiedene Linguisten und ihre Ansichten zum Thema vorgestellt.
Welche analytischen Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene analytische Methoden, um literarische Texte und pragmatische Texte zu untersuchen. Diese Methoden umfassen die Analyse von Figuren, Handlung, Sprache, Stil, sowie die Untersuchung von Erzählperspektiven, -verhalten und -formen. Die Arbeit legt auch Wert auf die Interpretation von literarischen Werken im Kontext ihrer Entstehungszeit und ihres gesellschaftlichen Einflusses.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die deutsche Literatur und Sprache von verschiedenen Epochen zu geben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung literarischer Formen, der Veränderung des Menschenbildes und der sprachlichen Entwicklung. Die Arbeit analysiert verschiedene literarische Gattungen und untersucht wichtige literaturgeschichtliche Strömungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft gedacht, die einen umfassenden Überblick über die deutsche Literatur- und Sprachgeschichte erhalten möchten. Sie eignet sich auch für alle, die sich für die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur interessieren.
- Arbeit zitieren
- Sarah Fuhrken (Autor:in), 2013, Deutsch komplette Zusammenfassung für das Abitur 2013, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279659