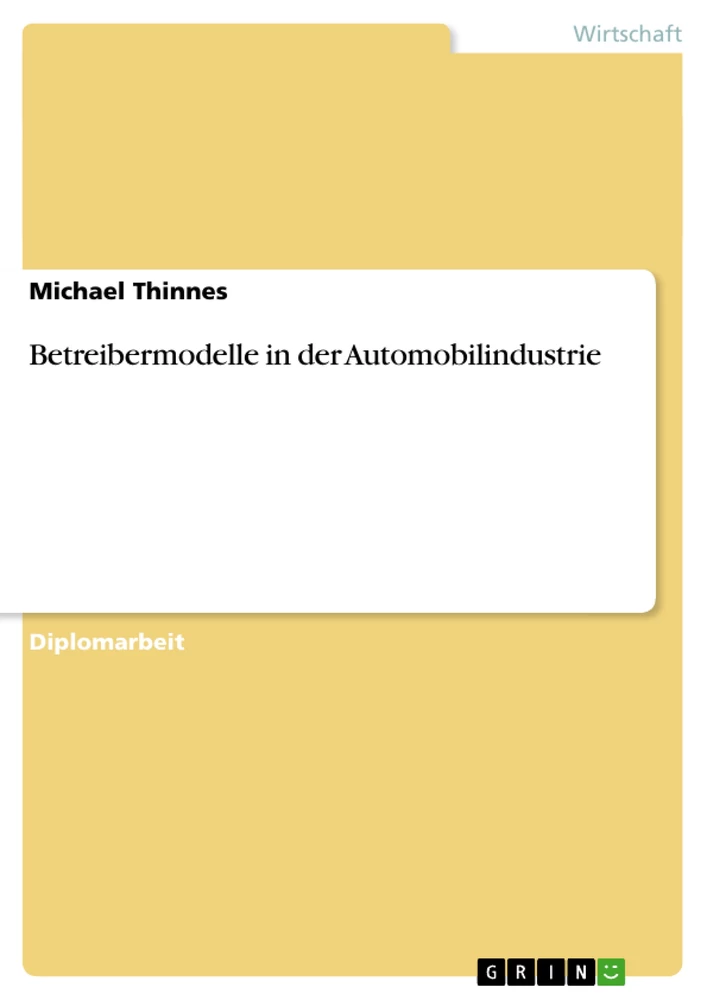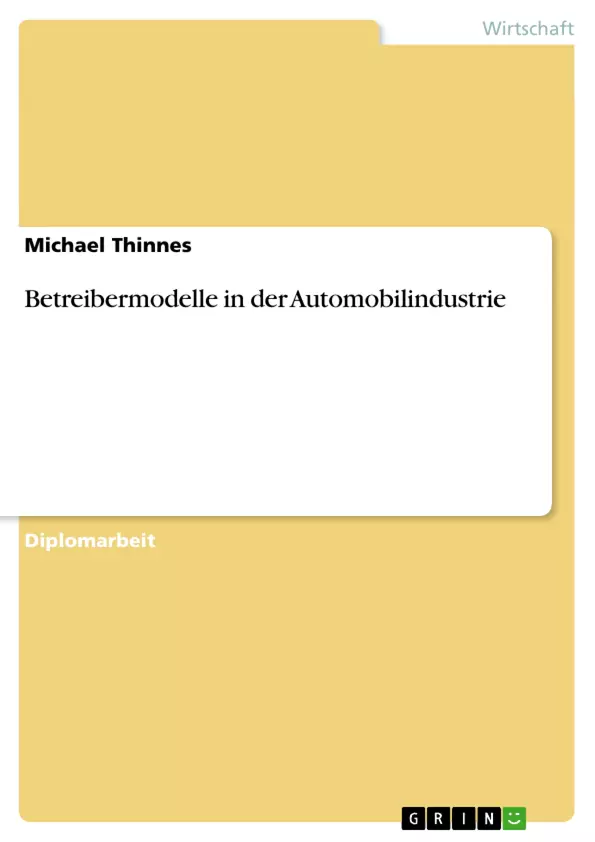Ziel und Aufbau der Arbeit
Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld ist gekennzeichnet durch eine steigende Wettbewerbsintensität. Wirtschaftliche Herausforderungen wie die Globalisierung der Märkte und des Wettbewerbs zwingen die Unternehmen zum Handeln. Der rasante technologische Fortschritt führt zu neuen Produkten und immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen. Im Marketing dominiert zunehmend eine kundenorientierte Denkweise. Eine flexible Reaktion auf Kundenwünsche führt zu einer steigenden Produktdifferenzierung und einer kundenindividuellen Massenproduktion (Mass Customization).
Neben diesen allgegenwärtigen Herausforderungen existiert in der Automobilindustrie eine Vielzahl von weiteren speziellen Herausforderungen und Problemstellungen. So steigt bedingt durch die Kundennachfrage die Zahl der Modellvarianten sukzessive an und es findet ein Triumph der Nische statt.
Die Ziele des Ausbaus und der Festigung von Marktpositionen führen nach Meinung von Marktforschern zu einer Erhöhung der Fertigungsvolumen. Bei bereits bestehenden hohen Überkapazitäten bewirkt dies selbst bei einem Anziehen der Nachfrage ein Überangebot. Zur Generierung zusätzlicher Kaufanreize für den Konsumenten wird der Preisdruck daher anhalten. Dies findet in einer Verschärfung von Preiskämpfen und Rabattschlachten auf den Märkten statt. So verkauft z.B. die Adam Opel AG den ab März 2004 erhältlichen neuen Astra bereits heute mit einem “Frühbucherrabatt“. Die Folge ist eine Reduktion der Gewinnmargen bei den Automobilherstellern.
Diese Problemfelder zwingen die Automobilhersteller zum Handeln und erfordern die Notwendigkeit einer schnelleren Reaktionsfähigkeit und höheren Flexibilität der Unternehmen auf den Märkten. Nach Bellmann haben die ökonomisch-organisatorischen Fragestellungen bei Produktions- und Logistiksystemen eine zentrale Bedeutung im Bereich der Produktionswirtschaft.
Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld ist gekennzeichnet durch eine steigende Wettbewerbsintensität. Wirtschaftliche Herausforderungen wie die Globalisierung der Märkte und des Wettbewerbs zwingen die Unternehmen zum Handeln. Der rasante technologische Fortschritt führt zu neuen Produkten und immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen. Im Marketing dominiert zunehmend eine kundenorientierte Denkweise. Eine flexible Reaktion auf Kundenwünsche führt zu einer steigenden Produktdifferenzierung und einer kundenindividuellen Massenproduktion (Mass Customization).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2 Wettbewerbssituation und Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie
- 2.1 Allgemeine Definition von Wettbewerb und Wettbewerbskräften
- 2.2 Wettbewerbsherausforderungen in der Automobilindustrie
- 2.3 Produktion als Wettbewerbsfaktor
- 2.4 Historischer Abriss der Entwicklung der Automobilindustrie
- 2.4.1 Epoche der handwerklichen Produktion
- 2.4.2 Die erste Revolution - Massenproduktion
- 2.4.3 Die zweite Revolution - schlanke Produktion
- 2.4.4 Aktuelle Produktionsmodelle
- 2.5 Aktuelle Rahmendaten der Automobilindustrie
- 2.5.1 Automobilkonjunktur
- 2.5.1.1 Weltweite Automobilkonjunktur
- 2.5.1.2 Deutsche Automobilkonjunktur
- 2.5.2 Aktuelle Wettbewerbssituation und strukturelle Veränderungen
- 2.5.3 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Automobilindustrie
- 2.6 Folgerungen
- 3 Treiber für Betreibermodelle in der Automobilindustrie
- 3.1 Innovation
- 3.1.1 Definition von `Innovation`
- 3.1.2 Bedeutung von Innovation für die Automobilindustrie
- 3.1.3 Marktsegmentierung: Triumph der Nische
- 3.1.4 Konklusion
- 3.2 Produktivität und Flexibilität
- 3.2.1 Einordnung von Produktivität und Flexibilität in die taktische Planung
- 3.2.2 Definition von Produktivität und Flexibilität
- 3.2.3 Charakteristika der Automobilfertigung
- 3.2.4 Problemfeld Produktivität / Flexibilität
- 3.2.5 Konklusion
- 3.3 Fertigungs- und Wertschöpfungstiefe
- 3.3.1 Definition und Überblick
- 3.3.2 Veränderungen der Wertschöpfungsstruktur
- 3.3.3 Strategische Ansatzpunkte für die Fremdvergabe produktiver und produktionsnaher Leistungen
- 3.3.4 Insourcing-/Outsourcing-Strategien
- 3.3.4.1 Definition von `Insourcing` / 'Outsourcing' und Überblick
- 3.3.4.2 Fremdvergabe von Fertigungsumfängen an Zulieferer
- 3.3.4.3 Fremdvergabe von Fertigungsfunktionen an Ausrüstungslieferanten
- 3.3.4.4 Trend: Insourcing vs. Outsourcing
- 3.3.5 Beurteilung der Fertigungstiefe aus Konsumentensicht
- 3.3.6 Konklusion
- 3.4 Netzwerkbildung
- 3.4.1 Definition von `Netzwerkbildung`
- 3.4.2 Koordination von Netzwerken
- 3.4.3 Paradigmenwechsel: Vom Teilelieferanten zum Systemintegrator
- 3.4.4 Global Sourcing
- 3.4.5 Konklusion
- 3.5 Folgerungen
- 3.5.1 Zusammenfassung der Treiber
- 3.5.2 Veränderung der Wertschöpfungsstrukturen
- 3.5.3 Lösungsstrategien
- 4 Betreibermodelle als ein innovatives Geschäftsmodell
- 4.1 Übersicht über innovative Geschäftsmodelle
- 4.2 Überblick über Betreibermodelle
- 4.2.1 Betreibermodelle in öffentlichen Infrastrukturprojekten
- 4.2.2 Definition von Betreibermodellen in der (Privat-)Wirtschaft
- 4.2.3 Angebot von Betreibermodellen in der deutschen Investitionsgüterindustrie
- 4.3 Einordnung von Betreibermodellen in die Wertschöpfungskette und Eignung
- 4.4 Lebenszyklus von Betreibermodellen
- 4.4.1 Überblick und Definition von Anlagen
- 4.4.2 Phasen von Betreibermodellen mit phasenspezifischen Risiken
- 4.5 Vertragsbeziehungen in Betreibermodellen
- 4.5.1 Beteiligte an Betreibermodellen
- 4.5.2 Rechtliche Details
- 4.6 Funktionen von Betreibermodellen
- 4.6.1 Überblick
- 4.6.2 Leistungsfunktion: Projektierung, Herstellung, Betriebsführung
- 4.6.3 Finanzierungsfunktion
- 4.6.3.1 Überblick und Definition
- 4.6.3.2 Implikationen durch Basel II
- 4.6.3.3 Off-Balance-Finanzierung
- 4.6.3.4 Off-Rating-Finanzierung
- 4.6.3.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- 4.6.3.6 Spezielle Kostenaspekte
- 4.7 Darstellung der theoretischen Modellkonstrukte
- 4.7.1 Überblick
- 4.7.2 Neuere Modellansätze
- 4.7.2.1 Leasingmodell
- 4.7.2.2 Betriebsführungsmodell
- 4.7.2.3 Eigentümermodell (Betreibermodell)
- 4.7.2.4 "Pay on Production"-Modell
- 4.7.3 Modellüberblick und Konklusion
- 4.8 Chancen und Risiken von Betreibermodellen (insbes. PoP-Modell)
- 4.8.1 Betriebswirtschaftliche Chancen
- 4.8.1.1 Chancen des Dienstleistungsnehmers (OEM)
- 4.8.1.2 Chancen des Dienstleistungsanbieters (Betreiber)
- 4.8.2 Betriebswirtschaftliche Risiken
- 4.8.2.1 Risiken des Dienstleistungsnehmers (OEM)
- 4.8.2.2 Risiken des Dienstleistungsanbieters (Betreiber)
- 4.9 Handlungsrahmen mit strategischer Empfehlung
- 4.9.1 Kritische Erfolgsfaktoren bei Betreibermodellen
- 4.9.2 Kriterien zur Eignung von Betreibermodellen mit Handlungsempfehlung
- 4.10 Überblick über realisierte Betreibermodelle in der Automobilindustrie
- 4.10.1 Überblick
- 4.10.2 Seat Eisenmann
- 4.10.3 Ford Eisenmann
- 4.10.4 Smart - Eisenmann
- 4.10.5 Opel - Hörmann Industrietechnik
- Wettbewerbsdruck und Herausforderungen in der Automobilindustrie
- Treiber für Betreibermodelle, wie Innovation, Produktivität und Flexibilität, sowie Netzwerkbildung
- Die Funktionsweise und Charakteristika von Betreibermodellen
- Chancen und Risiken von Betreibermodellen für OEMs und Betreiber
- Realisierte Betreibermodelle in der Automobilindustrie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Betreibermodelle in der Automobilproduktion. Sie analysiert die Treiber, die zur Entstehung dieser innovativen Geschäftsmodelle führen und betrachtet deren Eignung in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie. Die Arbeit untersucht die Chancen und Risiken von Betreibermodellen, insbesondere des "Pay on Production"-Modells, und entwickelt einen Handlungsrahmen mit strategischer Empfehlung.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert die Wettbewerbssituation und den Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Produktion und die aktuellen Herausforderungen im Automobilmarkt. Kapitel 3 identifiziert die Treiber, die die Entwicklung von Betreibermodellen in der Automobilindustrie vorantreiben. Die Kapitel beleuchten die Bedeutung von Innovation, Produktivität und Flexibilität sowie die Bedeutung von Netzwerkbildung und Global Sourcing.
Kapitel 4 widmet sich den Betreibermodellen als innovatives Geschäftsmodell. Es bietet einen Überblick über verschiedene Betreibermodelle, untersucht deren Eignung in der Wertschöpfungskette und beleuchtet den Lebenszyklus von Betreibermodellen. Kapitel 4 analysiert die Funktionen von Betreibermodellen, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierungsfunktion, und stellt verschiedene Modellkonstrukte vor, darunter das Leasingmodell, das Betriebsführungsmodell und das "Pay on Production"-Modell. Die Chancen und Risiken dieser Modelle werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Betreibermodelle, Automobilindustrie, Wettbewerb, Innovation, Produktivität, Flexibilität, Netzwerkbildung, Global Sourcing, Wertschöpfungskette, "Pay on Production"-Modell, Chancen, Risiken, Handlungsrahmen, Strategische Empfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Betreibermodelle in der Automobilindustrie?
Dies sind innovative Geschäftsmodelle, bei denen ein externer Partner (Betreiber) eine Anlage (z.B. Lackiererei) auf dem Gelände des Herstellers plant, baut und eigenverantwortlich betreibt.
Was bedeutet „Pay on Production“ (PoP)?
Bei diesem Modell zahlt der Automobilhersteller (OEM) dem Betreiber nur für tatsächlich produzierte Einheiten (z.B. pro lackierte Karosserie), anstatt die Anlage selbst zu kaufen.
Warum nutzen Firmen wie Opel oder Smart solche Modelle?
Hauptgründe sind die Reduktion der Kapitalbindung, die Erhöhung der Flexibilität bei Nachfrageschwankungen und die Konzentration auf Kernkompetenzen.
Welche Risiken gibt es für den Betreiber?
Der Betreiber trägt das Auslastungsrisiko. Wenn der Hersteller weniger Fahrzeuge produziert als geplant, sinken die Einnahmen des Betreibers trotz hoher Fixkosten.
Wie beeinflusst Basel II die Wahl von Betreibermodellen?
Durch Off-Balance-Finanzierungen können Unternehmen ihre Bilanzkennzahlen verbessern, was sich positiv auf das Rating und die Kreditkonditionen auswirken kann.
- Citation du texte
- Michael Thinnes (Auteur), 2004, Betreibermodelle in der Automobilindustrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27969