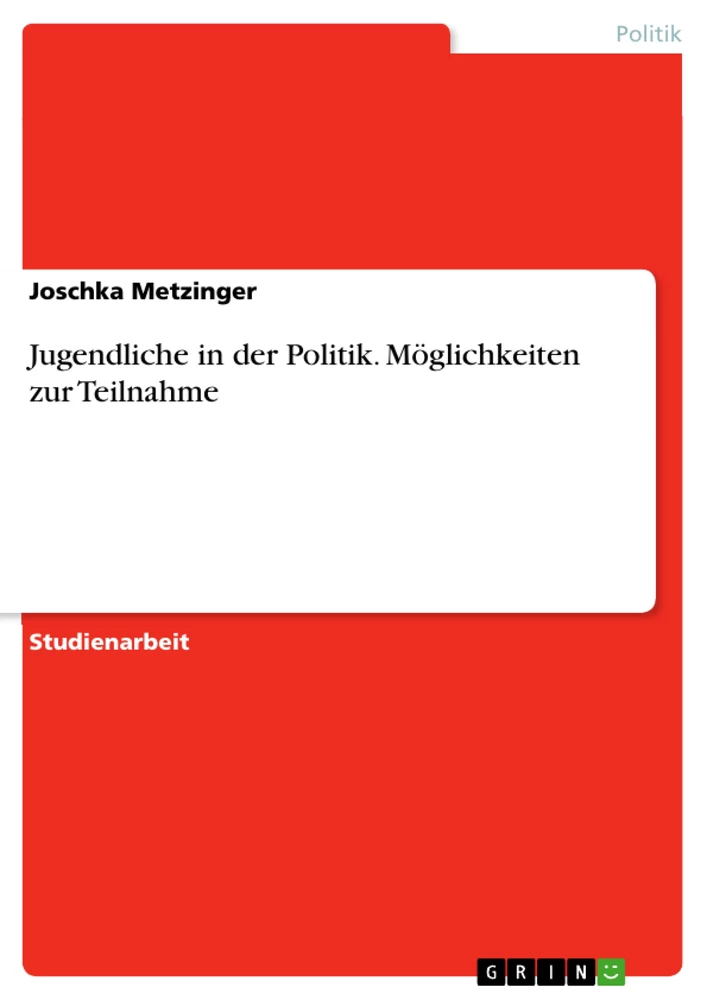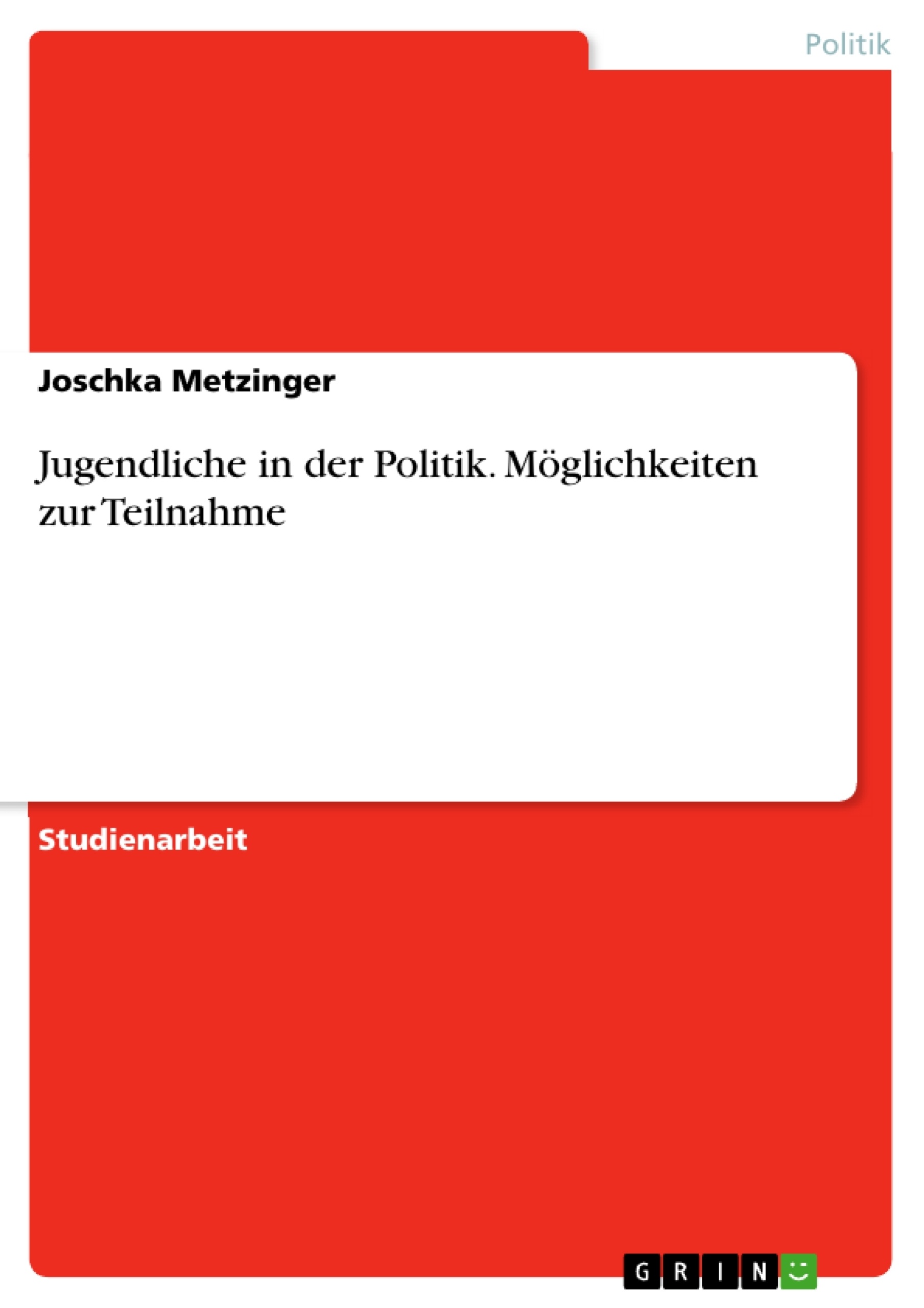Relativ häufig kann man lesen bzw. hören, dass sich ein Großteil der heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der Politik abwendet und sich bei dieser Altersgruppe Tendenzen einer Entpolitisierung zeigen.
Vor diesem Hintergrund ist es interessant, welche politischen Beteiligungsmöglichkeiten junge Menschen in Deutschland haben, um sich in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen. Es gilt hier reale Chancen anzubieten, damit Jugendliche an politischen Entscheidungen mitwirken können. Die Frage stellt sich hier, ob es gelingt, Jugendlichen den Zusammenhang zwischen eigener Lebenswelt, Alltagserfahrung und subjektiver Betroffenheit zum einen und politischen Themen zum anderen darzulegen, um sie zur Beteiligung und Mitgestaltung nachhaltig zu motivieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung: Partizipation
- Rechtliche Grundlagen
- Beteiligungsformen in der Schule
- Wahlrecht mit 16 Jahren
- Partizipation in der Kommune: Der Jugendgemeinderat
- Neue und unkonventionelle Formen jugendlicher Partizipation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der politischen Partizipation von Jugendlichen in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und gängigen Formen der Beteiligung, sowie neue und unkonventionelle Ansätze. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu zeichnen und Handlungsmöglichkeiten für eine stärkere politische Partizipation von Jugendlichen aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Partizipation
- Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen für jugendliche Partizipation
- Konventionelle und unkonventionelle Formen der Beteiligung
- Herausforderungen und Chancen für eine aktivere politische Gestaltung von Jugendlichen
- Beispiele und Best-Practice-Modelle für erfolgreiche Partizipationsprojekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der politischen Partizipation von Jugendlichen in den Kontext aktueller gesellschaftlicher Trends und Herausforderungen. Sie beleuchtet den Rückzug von Jugendlichen aus der Politik und die Gründe dafür.
- Begriffsbestimmung: Partizipation: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "Partizipation" und seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Es werden verschiedene politikwissenschaftliche Ansätze zur Definition von Partizipation vorgestellt und ihre Bedeutung für die politische Praxis erläutert.
- Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die politische Partizipation von Jugendlichen in Deutschland. Es beleuchtet die relevanten Gesetze und Verordnungen, die die Beteiligung von Jugendlichen in verschiedenen Bereichen regeln.
- Beteiligungsformen in der Schule: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten der Partizipation von Jugendlichen im schulischen Kontext. Es werden verschiedene Formen der Schülerbeteiligung vorgestellt und deren Bedeutung für die Entwicklung demokratischer Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserfahrungen diskutiert.
- Wahlrecht mit 16 Jahren: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Debatte um das Wahlrecht mit 16 Jahren. Es werden Argumente für und gegen die Senkung des Wahlalters diskutiert und die Auswirkungen auf die politische Kultur und die Partizipation von Jugendlichen beleuchtet.
- Partizipation in der Kommune: Der Jugendgemeinderat: Dieses Kapitel stellt das Modell des Jugendgemeinderats als eine wichtige Form der Partizipation von Jugendlichen in der Kommune vor. Es werden die Funktionsweise, Aufgaben und Herausforderungen von Jugendgemeinderäten erläutert und Beispiele für erfolgreiche Projekte vorgestellt.
- Neue und unkonventionelle Formen jugendlicher Partizipation: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit neuen und innovativen Formen der Partizipation von Jugendlichen, die sich von traditionellen Formen abheben. Es werden Beispiele für Online-Plattformen, Social Media-Kampagnen und andere innovative Ansätze zur politischen Gestaltung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der politischen Partizipation von Jugendlichen in Deutschland. Zentrale Begriffe sind dabei: Jugend, Politik, Partizipation, Beteiligung, Demokratie, Wahlrecht, Jugendgemeinderat, Bürgerinitiativen, Online-Partizipation, Social Media, politische Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Formen der politischen Beteiligung haben Jugendliche in Deutschland?
Jugendliche können sich in der Schule (Schülermitverantwortung), in Jugendgemeinderäten auf kommunaler Ebene oder durch unkonventionelle Formen wie Online-Kampagnen beteiligen.
Was ist die Debatte um das Wahlrecht mit 16 Jahren?
Es wird diskutiert, ob eine Senkung des Wahlalters die politische Partizipation fördert und die Interessen der Jugend in der Politik besser repräsentiert.
Was ist ein Jugendgemeinderat?
Ein Gremium auf kommunaler Ebene, das die Interessen von Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat vertritt.
Warum wenden sich viele Jugendliche von der Politik ab?
Gründe können fehlende reale Mitwirkungschancen, eine wahrgenommene Distanz zu politischen Themen oder die mangelnde Verknüpfung mit der eigenen Lebenswelt sein.
Welche Rolle spielt die Online-Partizipation?
Neue Medien bieten niedrigschwellige Möglichkeiten für Jugendliche, sich zu organisieren, Meinungen zu äußern und an Bürgerinitiativen teilzunehmen.
- Citation du texte
- BA Joschka Metzinger (Auteur), 2014, Jugendliche in der Politik. Möglichkeiten zur Teilnahme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279720