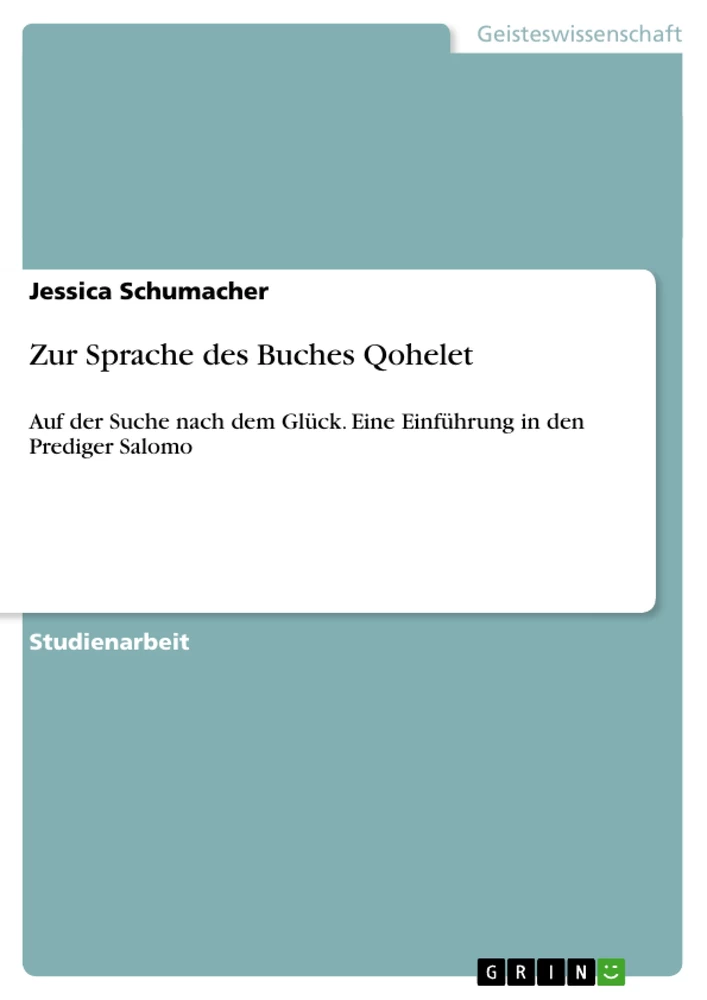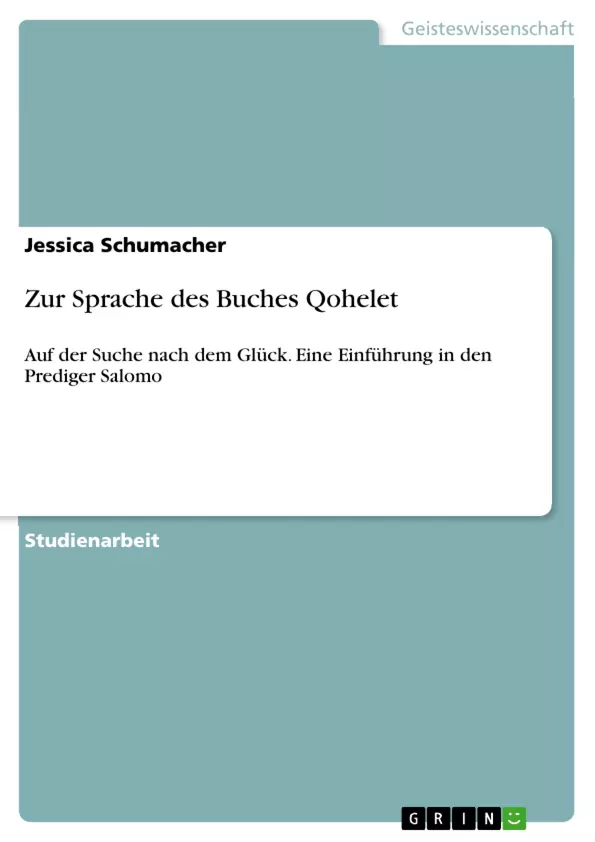In unserem Seminar „Auf der Suche nach dem Glück – Eine Einführung in den Prediger Salomo“ beschäftigen wir uns u.a. mit der zeitlichen Einordnung des Buches Qohelet, fragen nach dem Autor und der Art und Weise (einheitlich, redaktionell) des Geschriebenen. So werde ich nachfolgend versuchen, durch die Untersuchung der Sprache dem Datierungszeitpunkt Qohelets etwas näher kommen. Hierzu beziehe ich mich hauptsächlich auf den Text von Diethelm Michel, den ich in zwei Blöcke einteile und ihn durch weitere Quellen ergänze. Zunächst werde ich auf die Eigenart des von Qohelet geschriebenen Hebräisch und zum anderen auf den Gedankengang, Qohelet könne eine Übersetzung aus dem Aramäischen sein, eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Sprache des Buches Qohelet
- Die Eigenart des von Qohelet geschriebenen Hebräisch
- Übersetzung aus dem Aramäischen?
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Analyse des Buches Qohelet, um Rückschlüsse auf dessen Entstehungszeitpunkt zu ziehen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Eigenart des von Qohelet verwendeten Hebräisch und die Frage, ob es sich um eine Übersetzung aus dem Aramäischen handelt.
- Die sprachlichen Besonderheiten des Buches Qohelet im Vergleich zum übrigen Alten Testament
- Die Bedeutung von Lehnwörtern aus dem Persischen und dem Aramäischen für die Datierung des Textes
- Die Parallelen zwischen dem Hebräisch des Buches Qohelet und dem späteren Mischna-Hebräisch
- Die Rolle von volkstümlichem Hebräisch und sprachlichen Einflüssen aus dem Phönizischen
- Die Frage nach einem möglichen aramäischen Ursprung des Buches Qohelet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor. Das erste Kapitel untersucht die Eigenart des von Qohelet geschriebenen Hebräisch und beleuchtet die Unterschiede zum übrigen Alten Testament. Es wird auf Lehnwörter, grammatische Besonderheiten und die Verwandtschaft zum Mischna-Hebräisch eingegangen. Das zweite Kapitel analysiert die Annahme, Qohelet könne eine Übersetzung aus dem Aramäischen sein. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden abschließend zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Qohelet, Hebräisch, Aramäisch, Mischna, Lehnwörter, Sprachgeschichte, Datierung, Entstehung, altes Testament, volkstümliches Hebräisch, Phönizisch.
Häufig gestellte Fragen
In welcher Sprache ist das Buch Qohelet verfasst?
Es ist in einem spezifischen Hebräisch verfasst, das sich deutlich vom klassischen biblischen Hebräisch unterscheidet und Ähnlichkeiten zum späteren Mischna-Hebräisch aufweist.
Ist Qohelet eine Übersetzung aus dem Aramäischen?
Die Arbeit untersucht diese Theorie kritisch. Während starke aramäische Einflüsse (Aramaismen) vorhanden sind, sprechen viele sprachliche Details für ein ursprüngliches Hebräisch.
Was sagen Lehnwörter über das Alter des Buches aus?
Das Vorkommen von persischen Lehnwörtern (z.B. „Pardes“) deutet darauf hin, dass der Text frühestens in der Perserzeit entstanden sein kann.
Welche Rolle spielt volkstümliches Hebräisch?
Die sprachliche Eigenart von Qohelet wird oft als ein Übergang von der klassischen Schriftsprache hin zu einer eher volkstümlichen, gesprochenen Form des Hebräischen gedeutet.
Wer ist der Autor von Qohelet (Prediger Salomo)?
Obwohl die Tradition Salomo als Autor nennt, weist die sprachliche Analyse auf eine viel spätere Entstehung hin, was Salomo als historischen Verfasser ausschließt.
- Quote paper
- M.A. Jessica Schumacher (Author), 2003, Zur Sprache des Buches Qohelet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279740