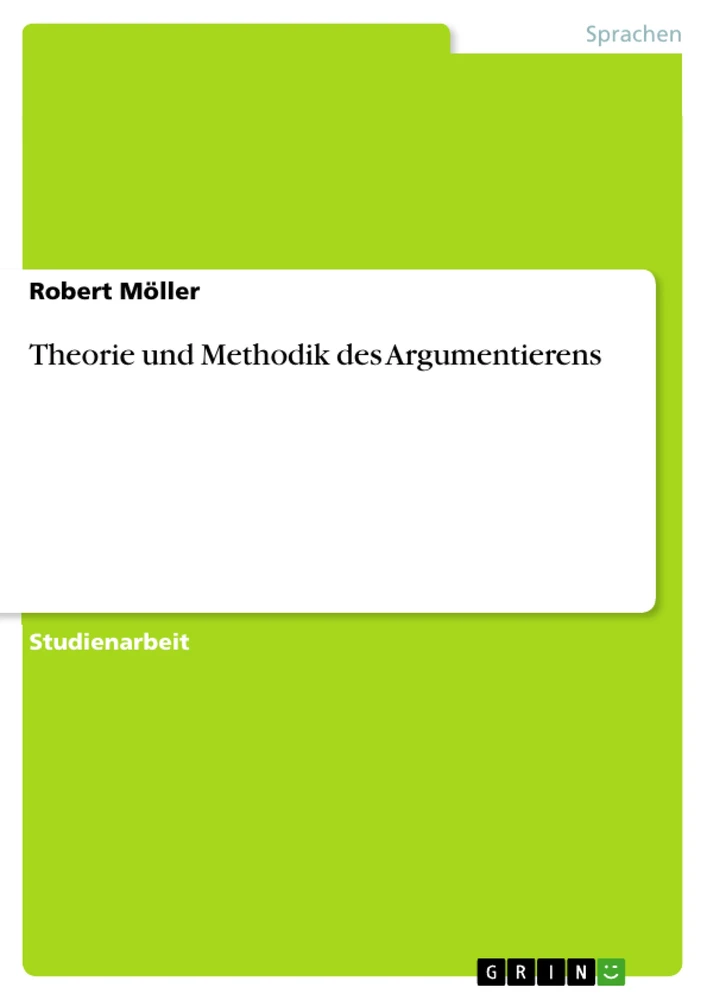Jeder Mensch nutzt diese Form des sprachlichen Handelns innerhalb der unterschiedlichsten Kommunikationsszenarien, ohne sich dabei regelmäßig Gedanken über die methodischen Grundlagen zu machen. Tatsächlich ist ein Argument jedoch mehr als die bloße Aneinanderreihung von Silben und Wörtern zu einem Satz oder Ausspruch. Um an das Eingangszitat anzuknüpfen: Der Kehlkopf formt die Laute, ermöglicht also die Übermittlung der Informationen, während der Kopf, welcher hier als Metapher für den kognitiven Prozess des Denkens dient, den sinnhaften Inhalt, die Information per se konstruiert und damit den Ursprung eines Argumentes darstellt. Um ein gelungenes Argument zu formulieren, bedarf es dementsprechend eines Denkprozesses, welcher wiederum auf Wissen über das Argumentieren basiert.
Ziel dieser Ausarbeitung soll es daher sein, einen Überblick über die Methodik des Argumentierens zu geben und, ausgehend von allgemeinen Betrachtungen, einen Einblick in die wissenschaftlichen Hintergründe dieses Themas zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Argumentationsarten
- 4. Logische Argumentationsfehler – Scheinlogik
- 5. Typen von Argumenten
- 6. Rhetorik und Kommunikation des Argumentierens
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über die Methodik des Argumentierens. Sie untersucht die wissenschaftlichen Grundlagen, beginnend mit einer Begriffsbestimmung und einer Betrachtung verschiedener Argumentationsarten. Die Arbeit analysiert logische Argumentationsfehler und verschiedene Argumenttypen. Schließlich werden Aspekte der Rhetorik und Kommunikation im Kontext des Argumentierens beleuchtet.
- Begriffsbestimmung und Etymologie des Argumentierens
- Unterscheidung verschiedener Argumentationsarten (logisch vs. überzeugend)
- Analyse logischer Argumentationsfehler
- Klassifizierung und Eigenschaften verschiedener Argumenttypen
- Bedeutung von Rhetorik und Kommunikation für erfolgreiches Argumentieren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Dieter Spöri, das die scheinbare Trivialität des Argumentierens im Alltag mit dessen theoretischer Tiefe kontrastiert. Sie legt die Zielsetzung der Arbeit dar: einen Überblick über die Methodik des Argumentierens zu geben und wissenschaftliche Hintergründe zu beleuchten. Die Arbeit kündigt die Struktur an: Begriffsbestimmung, Argumentationsarten, logische Fehler, Argumenttypen, Rhetorik und Kommunikation sowie eine Zusammenfassung.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von „Argumentieren“ und „Argument“. Es analysiert die sprachliche Herkunft (lateinisches „arguere“) und definiert Argumentieren als sprachliches Handeln, das einen Sachverhalt klar darstellt und für den Hörer verständlich macht. Die Arbeit diskutiert die mögliche positive und negative Wirkung von Argumenten, die bestehenden Zusammenhänge als falsch herausstellen können. Der Begriff „Argument“ wird als „Veranschaulichung“ oder „Mittel des Erhellens“ definiert.
3. Argumentationsarten: Hier werden zwei grundlegende Argumentationsarten unterschieden: „logische Argumentation“ (Standardfall) und „Überzeugung/Überredung“ (Non-Standardfall). Die logische Argumentation zielt darauf ab, eine Aussage durch logische Schritte herzuleiten, während der Non-Standardfall andere Mittel einsetzt, um den Gesprächspartner zu überzeugen. Das Kapitel konzentriert sich auf die logische Argumentation, die auf dem Herleiten von Aussagen aus vorangegangenen Entwicklungsschritten basiert.
Schlüsselwörter
Argumentieren, Argumentation, Argumentationsarten, Logik, Argumentationsfehler, Rhetorik, Kommunikation, Sprachliches Handeln, Überzeugung, Beweis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Methodik des Argumentierens
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Methodik des Argumentierens. Sie behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen, verschiedene Argumentationsarten, logische Fehler, Argumenttypen und die Rolle von Rhetorik und Kommunikation im Argumentationsprozess. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Begriffsbestimmung, eine Analyse von Argumentationsarten und logischen Fehlern, eine Klassifizierung von Argumenttypen sowie eine Zusammenfassung der zentralen Themen.
Welche Argumentationsarten werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet hauptsächlich zwischen zwei Argumentationsarten: „logische Argumentation“ (Standardfall), die auf logischen Schritten basiert, und „Überzeugung/Überredung“ (Non-Standardfall), die zusätzliche Mittel zur Überzeugung des Gesprächspartners einsetzt. Der Fokus liegt auf der logischen Argumentation.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte?
Die Zielsetzung ist es, einen Überblick über die Methodik des Argumentierens zu geben und die wissenschaftlichen Hintergründe zu beleuchten. Die Themenschwerpunkte umfassen die Begriffsbestimmung und Etymologie des Argumentierens, die Unterscheidung verschiedener Argumentationsarten, die Analyse logischer Argumentationsfehler, die Klassifizierung und Eigenschaften verschiedener Argumenttypen und die Bedeutung von Rhetorik und Kommunikation für erfolgreiches Argumentieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffsbestimmung, Argumentationsarten, logischen Argumentationsfehlern, Argumenttypen, Rhetorik und Kommunikation im Argumentieren und einer Zusammenfassung. Jedes Kapitel beleuchtet einen spezifischen Aspekt der Argumentationsmethodik. Die Einleitung setzt den Kontext, die Begriffsbestimmung klärt zentrale Termini, die Kapitel zu Argumentationsarten und logischen Fehlern analysieren die Struktur und mögliche Fehlerquellen, und die Kapitel zu Argumenttypen und Rhetorik betrachten die praktische Anwendung und kommunikativen Aspekte des Argumentierens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Argumentieren, Argumentation, Argumentationsarten, Logik, Argumentationsfehler, Rhetorik, Kommunikation, Sprachliches Handeln, Überzeugung, Beweis.
Wie wird der Begriff "Argumentieren" definiert?
Argumentieren wird als sprachliches Handeln definiert, das einen Sachverhalt klar darstellt und für den Hörer verständlich macht. Die Arbeit hebt die potenziell positive und negative Wirkung von Argumenten hervor, die bestehende Zusammenhänge als falsch darstellen können. "Argument" wird als "Veranschaulichung" oder "Mittel des Erhellens" definiert.
- Arbeit zitieren
- Master of Arts Robert Möller (Autor:in), 2010, Theorie und Methodik des Argumentierens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279781