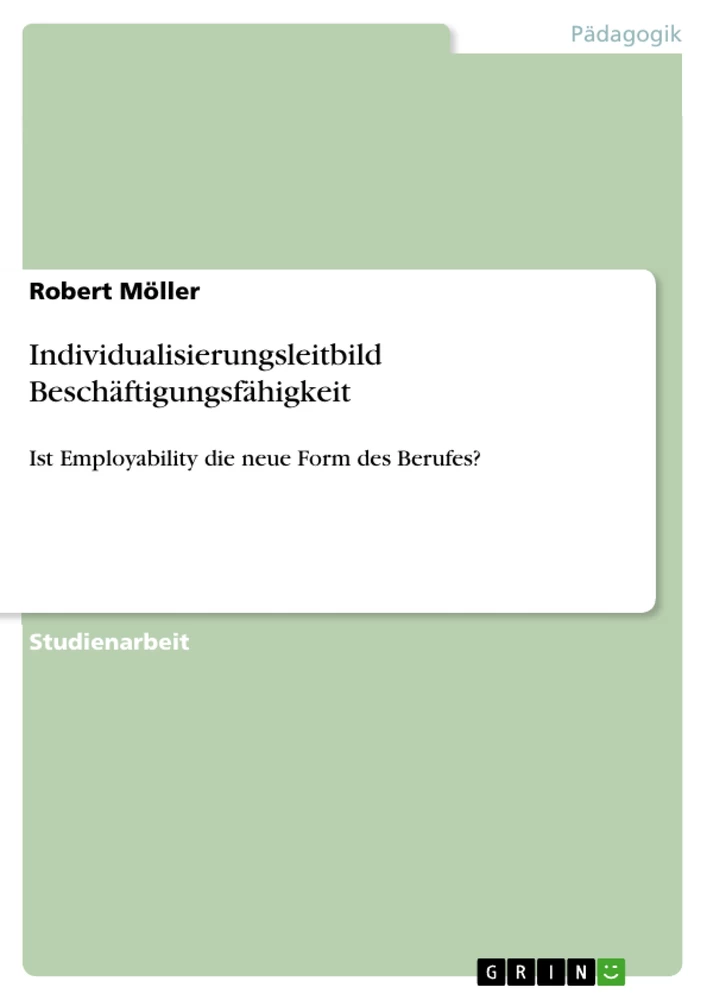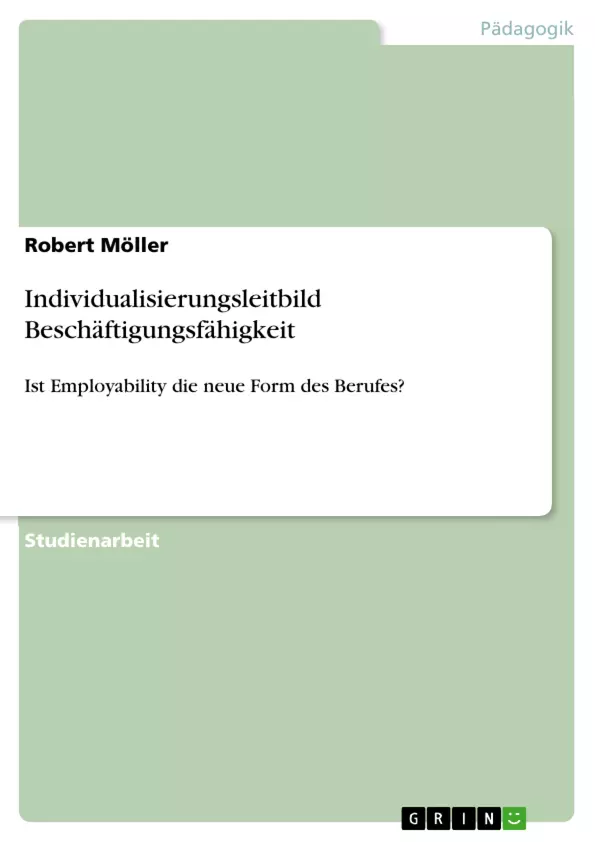Ursprünglich dem angelsächsischen Raum entstammend, hat die Beschäftigungsfähigkeit, auch Employability genannt, in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewonnen. Angetrieben von dem Ziel einer adäquaten Anpassung beruflicher Qualifikationen an sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse, und dem damit einhergehenden Wandel der Erwerbsarbeit, fördert die Einbringung der Employability in den Wirtschaftsraum Deutschland teilweise Hoffnung, teilweise Kritik zutage.
Ziel dieser Ausarbeitung soll es sein, den Begriff der Beschäftigungsfähigkeit zu ergründen, dessen Aufkommen in Deutschland zu erklären und den berufspädagogischen Diskurs zur Thematik Employability versus Beruf zu erläutern.
Zu diesem Zwecke werde ich im ersten Abschnitt die Frage beantworten: „Was ist Employability?“, gefolgt von einer kurzen Schilderung zum Aufkommen dieses Konzeptes innerhalb des deutschen Wirtschaftsraumes. Anschließend möchte ich auf den bereits angesprochenen Diskurs in der Berufspädagogik eingehen, um abschließend ein Fazit, von meinem Standpunkt aus, zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 2. WAS IST EMPLOYABILITY?
- 3. DIE ENTWICKLUNG DER EMPLOYABILITY IM DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
- 4. EMPLOYABILITY IM BERUFSPÄDAGOGISCHEN DISKURS.
- 5. FAZIT.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Konzept der Beschäftigungsfähigkeit, auch Employability genannt, und untersucht dessen Bedeutung im deutschen Wirtschaftsraum. Sie analysiert die Entstehung des Begriffs, seine Entwicklung und die Auswirkungen auf den berufspädagogischen Diskurs.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Employability
- Entwicklung der Employability im deutschen Wirtschaftsraum
- Einfluss von Employability auf den berufspädagogischen Diskurs
- Kritik und Chancen des Employability-Konzepts
- Vergleich von Employability und klassischen Berufsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beschäftigungsfähigkeit ein und verdeutlicht die Relevanz des Begriffs im Kontext des sich wandelnden Beschäftigungssystems. Sie stellt das Ziel der Ausarbeitung dar und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
- Kapitel 2: Was ist Employability?: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition des Begriffs Employability, seine Bedeutung in verschiedenen Kontexten und seine Abgrenzung zu traditionellen Berufsbildern. Es analysiert die verschiedenen Perspektiven auf Employability und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der Anwendung des Konzepts ergeben.
- Kapitel 3: Die Entwicklung der Employability im deutschen Wirtschaftsraum: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Employability-Konzepts im deutschen Wirtschaftsraum. Es untersucht die Faktoren, die zur Verbreitung des Begriffs beigetragen haben, und analysiert die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe Employability, Beschäftigungsfähigkeit, Beruf, Berufspädagogik, Qualifikation, Flexibilität, Mobilität, Lebenslanges Lernen, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsraum Deutschland. Sie untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Anwendung des Employability-Konzepts für Individuen, Unternehmen und die Gesellschaft ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Employability“?
Employability oder Beschäftigungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Individuums, seine Qualifikationen so anzupassen, dass es auf dem sich wandelnden Arbeitsmarkt dauerhaft beschäftigungsfähig bleibt.
Wie kam das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit nach Deutschland?
Das Konzept stammt ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum und gewann in Deutschland an Bedeutung, um berufliche Qualifikationen an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel anzupassen.
Was ist der zentrale Diskurs in der Berufspädagogik zu diesem Thema?
In der Berufspädagogik wird debattiert, ob das Konzept der Employability das traditionelle Modell des „Berufs“ ergänzt oder es durch eine stärkere Individualisierung und Flexibilisierung gefährdet.
Welche Kritikpunkte gibt es am Employability-Konzept?
Kritiker befürchten eine Entgrenzung der Arbeit und dass die Verantwortung für die Beschäftigung allein auf das Individuum übertragen wird, statt soziale Sicherungssysteme zu stärken.
Welche Chancen bietet die Orientierung an Beschäftigungsfähigkeit?
Es fördert das lebenslange Lernen, die berufliche Mobilität und hilft Individuen, sich proaktiv auf technologische und wirtschaftliche Veränderungen einzustellen.
- Quote paper
- Master of Arts Robert Möller (Author), 2010, Individualisierungsleitbild Beschäftigungsfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279790