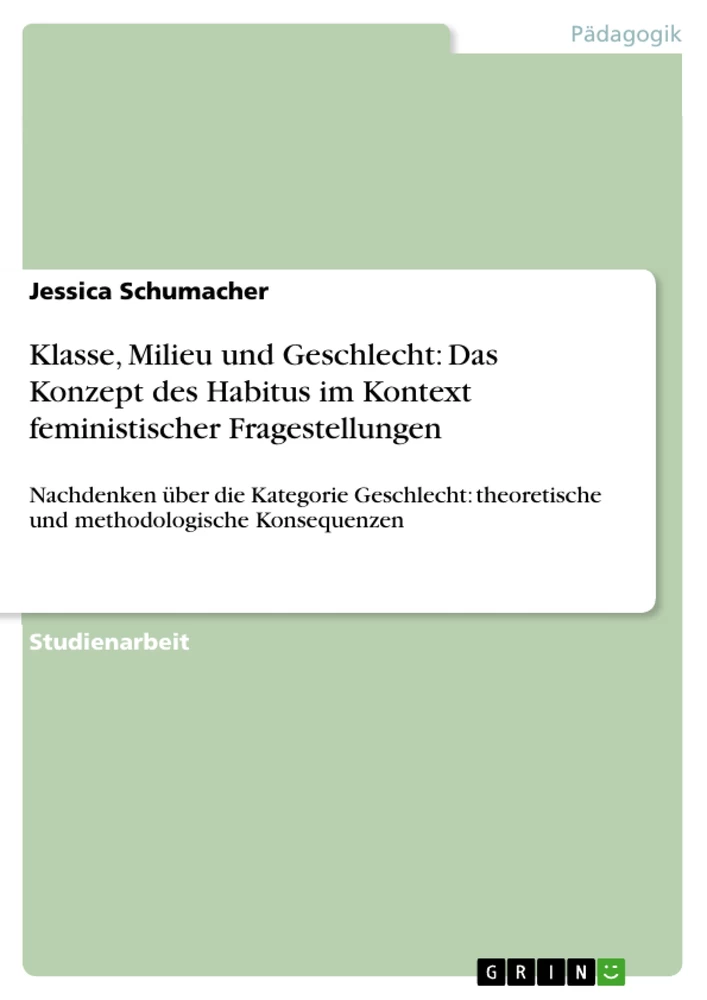In der Bundesrepublik Deutschland sind die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau in allen Lebensbereichen verfassungsgemäß garantiert – seit 1980 speziell auch am Arbeitsplatz, wobei eine geringere Vergütung bei gleichwertiger Arbeit verboten worden ist.
Art. 3 Abs. 2 GG: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Doch trotz rechtlicher Gleichstellung trifft die Gesellschaft immer wieder auf Situationen, in denen keine Gleichstellung ersichtlich ist. Eine Folie , entnommen aus der Broschüre der Bundeszentrale für politische Bildung, zeigt „Auszubildende in den dreißig am stärksten besetzten Ausbildungsberufen nach Rangfolge und Ausbildungsbereich in Deutschland 1999“. Der Beruf des/der Kraftfahrzeugmechanikers/in steht hier auf Rangfolge eins. Nimmt man zum Vergleich eine Folie, welche die Auszubildenden in die Geschlechter differenziert, zeigt es sich, dass dieser Beruf sehr wohl bei den Männern an oberster Stelle steht, bei den Frauen hingegen aber unter den ersten dreißig nicht zu finden ist.
Nachfolgend möchte ich eine kurze Zusammenfassung eines aktuellen Fazits über Geschlechtergleichheit in Deutschland geben, welches die derzeitige Situation aufzeigt.
In Deutschland kann bislang nicht von Geschlechtergleichheit gesprochen werden, obwohl Tendenzen zu sehen sind, die einer allmählichen Angleichung entgegen gehen.
Zum einen sind Veränderungen in Richtung mehr Egalität zwischen den Geschlechtern zu beobachten, da Frauen im mittleren und jüngeren Alter ihren Blick intensiver auf ihre berufliche Qualifikation und Berufstätigkeit legen und parallel dazu Männer ein zunehmendes Verständnis für ihre soziale Rolle als Väter entwickeln.
Andererseits belegen Fakten nach wie vor die Schlechterstellung von Frauen in Bereichen der Erwerbsbeteiligung, des -einkommens, der -muster und –verläufe. Trotz der Qualifikationsgewinne sind Frauen in Führungspositionen seltener vertreten, haben ein größeres Arbeitslosigkeits- und Verarmungsrisiko und erbringen noch immer den größten Teil der Haus- und Familienarbeit. Neben den Geschlechterungleichheiten kommt es zu neuen sozialen Ungleichheiten unter Frauen, da hoch qualifizierte und beruflich orientierte Frauen zunehmend auf Kinder verzichten und es scheint, dass nur Männer beides haben können: Kinder sowie Karriere.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Habituskonzept
- Der soziale Sinn
- Der soziale Raum oder auch das soziale Feld
- Der Kapitalbegriff
- Bourdieu führt die Ansätze des Feldes und Kapitals zusammen
- Ein System dauerhafter Dispositionen
- Dualismus von „Freiheit“ und „Determinismus“
- Der soziale Sinn
- Das Konzept des Habitus im Kontext feministischer Fragestellungen
- Kritik und Anschluss an Bourdieus Erklärungsansatz des Modells des Habitus von Beate Krais
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Habituskonzept von Pierre Bourdieu und dessen Relevanz im Kontext feministischer Fragestellungen. Ziel ist es, die Entstehung von Geschlechterungleichheiten anhand des Habitusmodells zu erklären und zu analysieren, wie diese Ungleichheiten in der Praxis erfahren und reproduziert werden.
- Das Habituskonzept als Erklärungsmodell für Geschlechterungleichheiten
- Die Rolle von Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) in der Reproduktion von Geschlechterrollen
- Die Bedeutung des sozialen Raums und der sozialen Felder für die Entwicklung des Habitus
- Kritik an Bourdieus Habituskonzept und dessen Erweiterung durch feministische Perspektiven
- Die Bedeutung des Habitus für die Analyse von Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Geschlechterungleichheit in Deutschland dar und führt in das Habituskonzept von Pierre Bourdieu ein.
Das Kapitel „Das Habituskonzept“ erläutert die zentralen Elemente des Habitusmodells, wie den sozialen Sinn, den Kapitalbegriff und die Entstehung von dauerhaften Dispositionen. Es wird auch der Dualismus von „Freiheit“ und „Determinismus“ im Habituskonzept beleuchtet.
Das Kapitel „Das Konzept des Habitus im Kontext feministischer Fragestellungen“ analysiert die Kritik an Bourdieus Habituskonzept aus feministischer Perspektive und zeigt auf, wie das Modell erweitert und modifiziert werden kann, um Geschlechterungleichheiten besser zu erklären.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Habituskonzept, Geschlechterungleichheit, feministische Theorie, soziale Ungleichheit, Kapitalformen, sozialer Raum, soziale Felder, Machtstrukturen, Herrschaftsverhältnisse, Kritik an Bourdieu, Erweiterung des Habitusmodells.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Habituskonzept von Pierre Bourdieu?
Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Er wird durch soziale Herkunft und Erfahrungen in bestimmten Feldern (z.B. Erziehung) erworben.
Wie erklärt der Habitus Geschlechterungleichheiten?
Geschlechterrollen werden in den Habitus inkorporiert. Dies führt dazu, dass Männer und Frauen unbewusst Verhaltensweisen reproduzieren, die gesellschaftliche Ungleichheiten (z.B. Berufswahl) verfestigen.
Welche Rolle spielen Kapitalformen nach Bourdieu?
Bourdieu unterscheidet ökonomisches (Geld), kulturelles (Bildung) und soziales Kapital (Beziehungen). Die Verteilung dieser Kapitalien beeinflusst die Positionierung im sozialen Raum.
Warum sind Frauen in Führungspositionen trotz Gleichberechtigung seltener?
Trotz rechtlicher Gleichstellung wirken habituelle Strukturen und soziale Felder oft gegen Frauen, da Führungspositionen historisch männlich geprägte Erwartungsmuster aufweisen.
Was kritisiert die feministische Theorie an Bourdieus Modell?
Feministische Forscherinnen wie Beate Krais kritisieren, dass Bourdieu Geschlecht oft als zweitrangig gegenüber der Klasse betrachtet, und fordern eine Erweiterung des Habitusbegriffs um die Kategorie Geschlecht.
- Quote paper
- M.A. Jessica Schumacher (Author), 2002, Klasse, Milieu und Geschlecht: Das Konzept des Habitus im Kontext feministischer Fragestellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279934