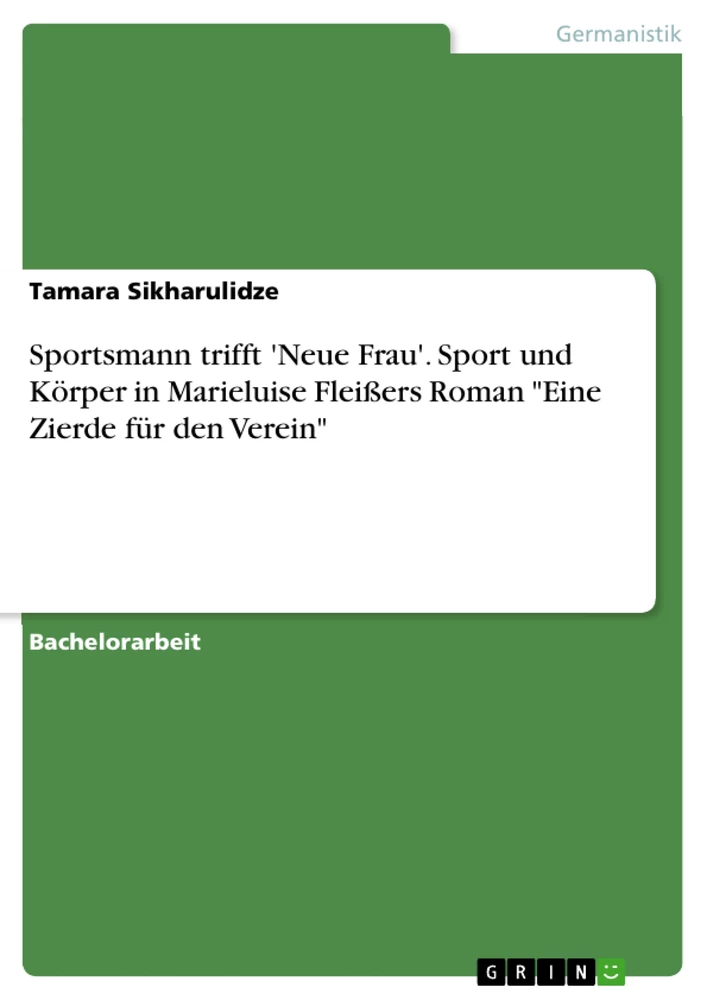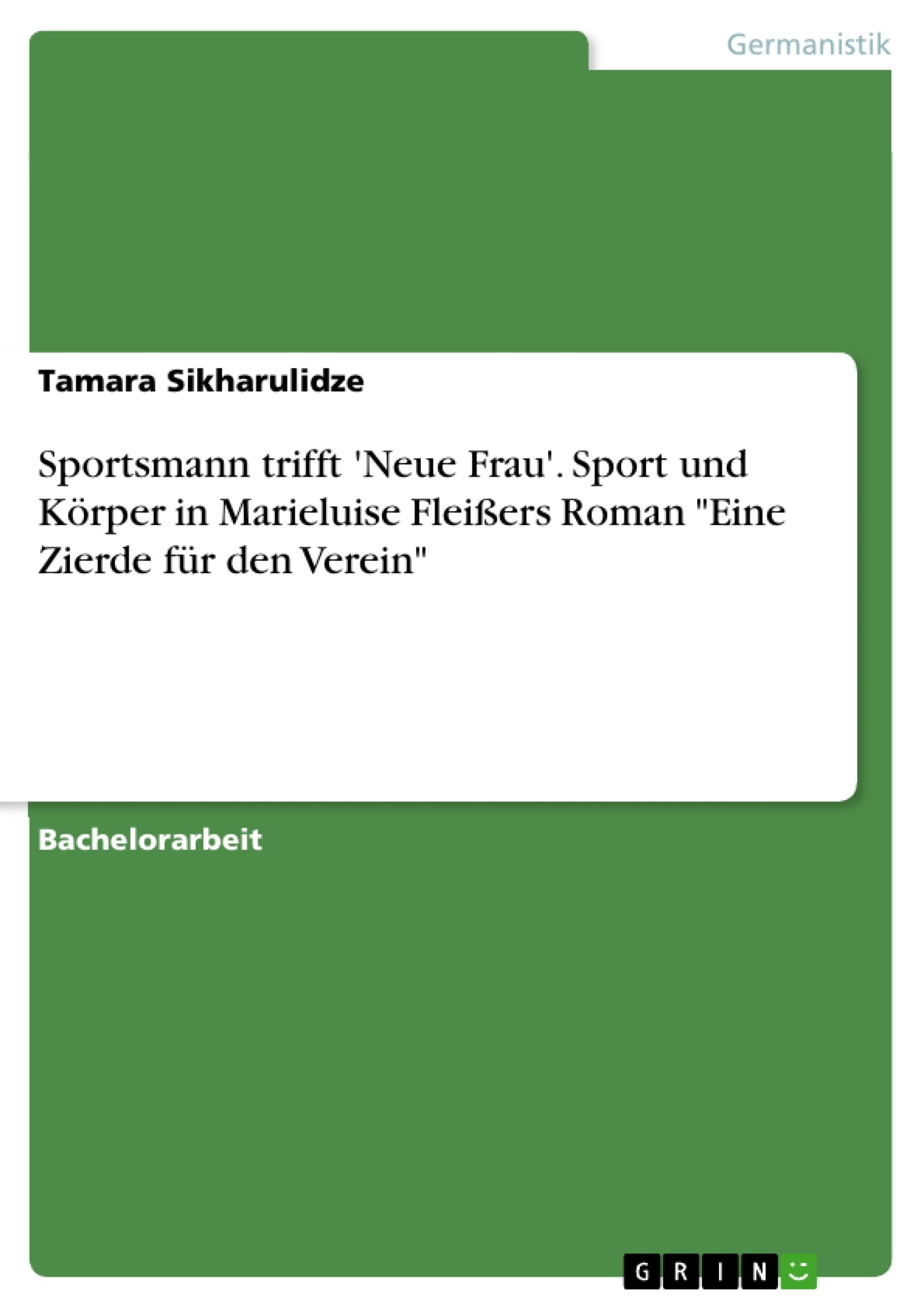Die vorliegende Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Sport- und
Körperthematik im Roman. Bei der Sportthematik greifen die Interpreten immer
wieder die Biographie von Marieluise Fleißer selbst auf, und zwar ihre Ehe mit dem
Ingolstädter Tabakwarenhändler und Schwimmsportler Bepp Heindl. Diesen
biographischen Aspekt möchte ich an dieser Stelle ausklammern und die
Aufmerksamkeit auf die Sportbegeisterung in der Zeit der Weimarer Republik lenken.
Die Gründung der Weimarer Republik 1918 geht mit Veränderungen der
gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen sowie sozialen und kulturellen Prozesse
einher. In diesen Modernisierungsprozessen nimmt die Sport- und Körperkultur in den
Zwanziger Jahren eine wichtige Stellung ein. Die Ausübung einer Sportart gehörte zu
einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Verschiedene Sportarten, vor allem die,
die einen ausgeprägten Wettkampfcharakter besaßen, sorgten für massenhafte
Zuschauererlebnisse. Der große Aufschwung der Sportbewegung führte langsam zum
Massenphänomen. „Wir leben nicht nur in der Zeit der Mechanisierung, sondern auch
in der Versportlichung“. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass der Frauenanteil im Sport zunahm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sport und Moderne
- Der Sportsmann als „,moderner Menschentyp"
- Sport im Roman
- Sport und Männlichkeit
- Sport und Religion
- Sport und Liebe
- Die Neue Frau der Zwanziger Jahre
- Die Mode der Neuen Frau
- Die Neue Frau und die neue Sexualmoral
- Frieda Geier als Neue Frau im Roman
- Die Mehlreisende
- ...und so fing die Liebe an“.
- Sportkritik oder Kritik am, Alten Mann'
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Analyse der Sport- und Körperthematik im Roman „Eine Zierde für den Verein“ von Marieluise Fleißer. Ziel ist es, die Darstellung des Sports und des Sportlers im Kontext der Weimarer Republik zu untersuchen und die Kritik am Sportsmann, die Fleißer in ihrem Roman formuliert, zu beleuchten.
- Die Rolle des Sports in der Weimarer Republik und seine Bedeutung für die moderne Gesellschaft
- Die Darstellung des Sports im Roman und die Kritik am Sportsmann als „moderner Menschentyp“
- Die Beziehung zwischen Sport und Männlichkeit, Religion und Liebe im Roman
- Die Neue Frau der Zwanziger Jahre und ihre Rolle im Roman
- Der Geschlechterkonflikt im Roman und die Kritik am Patriarchat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und stellt den Roman „Eine Zierde für den Verein“ von Marieluise Fleißer vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Sports in der Weimarer Republik und die Kritik am Sportsmann, die Fleißer in ihrem Roman formuliert.
Das zweite Kapitel widmet sich der Beziehung zwischen Sport und der modernen Zeit der Zwanziger Jahre. Es werden die zeitgenössischen Reflexionen zum Sport und die Bedeutung des Sportlerkörpers in der Weimarer Republik beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird Fleißers Essay „Sportgeist und Zeitkunst - Essay über den modernen Menschentyp“ analysiert. Es wird gezeigt, dass Fleißer nicht weniger von den Sportereignissen fasziniert war als ihre Zeitgenossen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle des Sports im Roman, insbesondere das Wechselspiel von Sport und Körper zu Männlichkeit, Religion und Liebe. Es werden unterschiedliche Aspekte des Sports und Sportsmanns, wie das Zusammenspiel von Disziplinierung, Askese und Erotik, zur Sprache gebracht.
Das fünfte Kapitel analysiert das Phänomen der Neuen Frau der Zwanziger Jahre im Hinblick auf die Mode und die veränderte Weiblichkeit. Die Untersuchung der Mode vermag in signifikanter Weise auch den Geschlechterkonflikt aufzuzeigen.
Das sechste Kapitel betrachtet die weibliche Protagonistin im Roman, Frieda Geier, als Neue Frau. Es wird ihre Rolle als rauchende, sich städtisch gebende, Moped fahrende Handelsreisende mit kurzgeschnittenen Haaren beleuchtet.
Das siebte Kapitel befasst sich mit der Kritik am Sportsmann und dem „Alten Mann“ im Roman. Es wird untersucht, ob der Roman eine Kritik am Phänomen des Massensportes in der Weimarer Republik beinhaltet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sport in der Weimarer Republik, den Sportsmann als „modernen Menschentyp“, die Neue Frau, den Geschlechterkonflikt, die Kritik am Patriarchat, Marieluise Fleißer, „Eine Zierde für den Verein“, „Sportgeist und Zeitkunst“, Männlichkeit, Religion, Liebe, Mode, Körperkultur.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Marieluise Fleißers Roman "Eine Zierde für den Verein"?
Der Roman thematisiert Sport, Körperkultur und Geschlechterkonflikte in der Zeit der Weimarer Republik.
Wer ist Frieda Geier?
Frieda Geier ist die Protagonistin und verkörpert den Typus der "Neuen Frau" – unabhängig, berufstätig und modern.
Welche Rolle spielte der Sport in der Weimarer Republik?
Sport wurde zum Massenphänomen und galt als Ausdruck der Modernisierung und Mechanisierung der Gesellschaft.
Was kritisiert Fleißer am "Sportsmann"?
Sie kritisiert den Sportsmann als "modernen Menschentyp", der oft durch eine Verbindung von Askese, Disziplinierung und mangelnder emotionaler Tiefe geprägt ist.
Wie wird die "Neue Frau" im Roman dargestellt?
Durch Merkmale wie kurze Haare (Bubikopf), Mopedfahren, Rauchen und eine neue Sexualmoral, die im Konflikt mit traditionellen Werten steht.
- Arbeit zitieren
- Tamara Sikharulidze (Autor:in), 2011, Sportsmann trifft 'Neue Frau'. Sport und Körper in Marieluise Fleißers Roman "Eine Zierde für den Verein", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279946