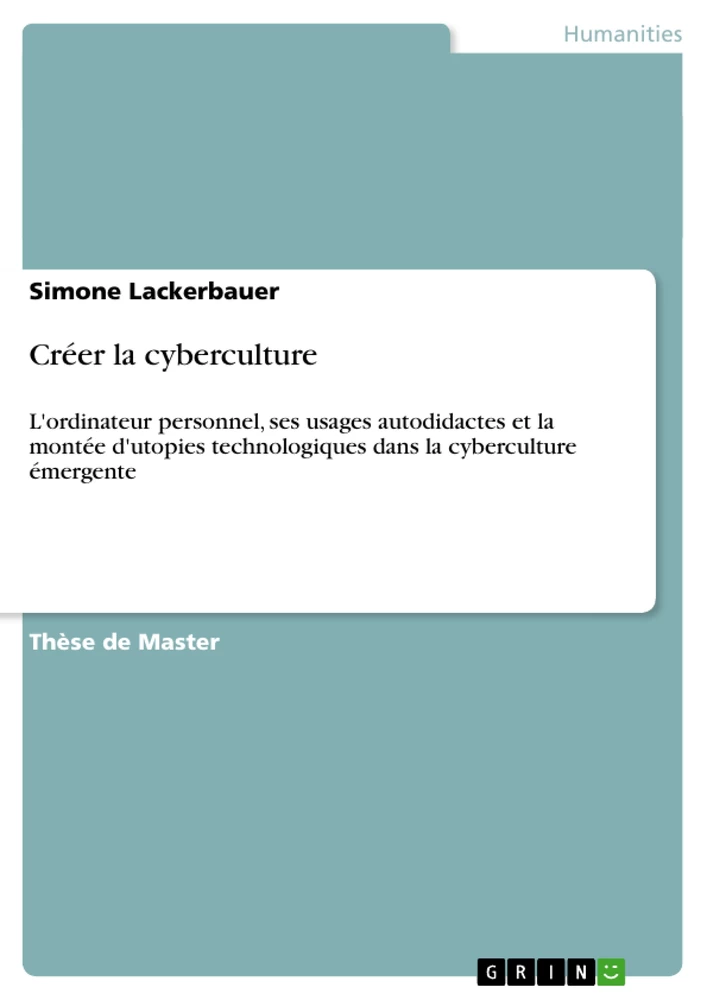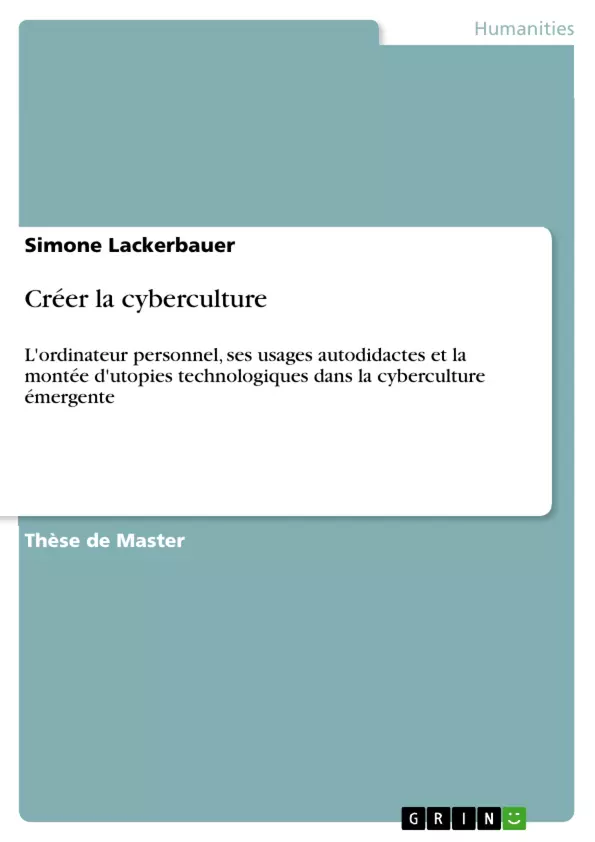Les mouvements contreculturels, la cyberculture et la révolution de l’ordinateur personnel à partir des années 1970 sont des périodes pleines de changements, de paradoxes et d’imaginaires. Non seulement l’identité et les apprentissages personnels, mais aussi le rapport à la créativité et aux imaginaires utopiques du devenir de la société sont bouleversés, au moment où le cyberespace devient accessible ; d’abord pour les pionniers de la cyberculture, et ensuite pour le grand public. Ce travail pose la question suivante : comment est-ce que l’invention de l’ordinateur personnel par les premiers informaticiens, son emploi, et l’émergence de la cyberculture, ont modifié les pratiques individuelles d’autodidaxie et de créativité ; et pourquoi est-ce que cela a éveillé la montée d’utopies technologiques, pendant les années 1980-1990 ?
L’exploration de l’émergence de la cyberculture autour de l’ordinateur professionnel commence avec une approche centrée sur l’individu : « Apprendre l’outil : l’individu et ses pratiques dans la cyberculture émergente ». L’intérêt de cette partie est de présenter le terrain des pratiques individuelles dans la cyberculture.
Dans une deuxième partie, on dépasse l’échelle des pratiques individuelles et on s’intéresse à la cyberculture : « Gouverner les médiations : les terrains de la “cybersocial reality” ». L’objectif de cette partie n’est pas seulement de raconter l’histoire de la cyberculture du point de vue des pionniers et de l’ordinateur personnel, mais aussi de savoir en quoi la pénétration technologique et le cyberespace bouleversent les relations sociales dans la réalité.
Avec une troisième partie – « Comprendre les usages : de l’imagination aux utopies technologiques » – on abandonne même les terrains de la réalité dans l’histoire de la cyberculture et les tensions sociotechniques autour d’elle. Partant d’une exploration logique des concepts traités, on essaie de manœuvrer dans les sphères utopiques en dehors de la cyberculture, où les frontières entre le temps et l’espace sont bouleversées et ouvrent la voie pour les imaginaires.
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- I. Apprendre l'outil. L'individu et ses pratiques dans la cyberculture émergente
- 1) La digitalisation de l'individu
- 2) La transformation de l'autodidaxie autour de l'ordinateur personnel
- 3) La créativité, un moteur d'innovations et d'utopies
- II. Gouverner les médiations. Les terrains de la «< cybersocial reality >>
- 4) Un regard rétrospectif : l'histoire culturelle de la révolution « cyber »
- 5) Des observations : les médias et les pionniers sur la cyberculture
- 6) Les tensions sociotechniques de la pénétration technologique
- III. Comprendre les anticipations. De l'imagination aux utopies technologiques
- 7) Un carré techno-logique (aristotélicien) de la cyberculture émergente
- 8) La dilution des frontières
- 9) Des utopies d'une société transformée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Personalcomputers auf die Entstehung der Cyberkultur in den 1970er und 1980er Jahren. Sie beleuchtet, wie die Entwicklung und der Gebrauch des PCs die individuellen Praktiken des autodidaktischen Lernens und der Kreativität verändert haben und wie dies zur Entstehung technologischer Utopien beigetragen hat.
- Die Digitalisierung des Individuums und die veränderten Lernmethoden
- Der Einfluss von Gegenkulturbewegungen auf die Entwicklung der Cyberkultur
- Die Rolle von Kreativität und Innovation in der Entstehung neuer Technologien
- Die soziotechnischen Spannungen durch die zunehmende Technologisierung
- Die Entstehung und Entwicklung technologischer Utopien
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Personalcomputers und der entstehenden Cyberkultur auf individuelle Lernpraktiken und die Entstehung technologischer Utopien. Sie betont die Bedeutung des PCs als Werkzeug sowohl des Konsums als auch der Produktion immaterieller Güter und die Rolle von Vorläufern und Pionieren in der Entwicklung der Cyberkultur.
I. Apprendre l'outil. L'individu et ses pratiques dans la cyberculture émergente: Dieses Kapitel untersucht die Digitalisierung des Individuums und die damit verbundenen Veränderungen im autodidaktischen Lernen und der Kreativität. Es analysiert, wie der Personalcomputer neue Möglichkeiten der Wissensaneignung und -produktion eröffnet und zu innovativen und utopischen Vorstellungen führt. Die Transformation der Autodidaxie wird im Kontext der neuen Technologien beleuchtet, die Kreativität als Motor von Innovationen und Utopien dargestellt.
II. Gouverner les médiations. Les terrains de la «< cybersocial reality >>: Kapitel II befasst sich mit der kulturellen Geschichte der „Cyber-Revolution“, der Rolle von Medien und Pionieren in der Cyberkultur und den soziotechnischen Spannungen, die durch die zunehmende Technologisierung entstehen. Es analysiert die Herausforderungen und die Veränderungen sozialer Strukturen durch die neue Technologie und den neu entstehenden virtuellen Raum. Die Kapitelteile beleuchten die Rolle der Medien, sowie der Vordenker und Entwickler der neuen Technologien.
III. Comprendre les anticipations. De l'imagination aux utopies technologiques: Das abschließende thematische Kapitel untersucht die Entwicklung technologischer Utopien im Kontext der entstehenden Cyberkultur. Es analysiert ein „techno-logisches Quadrat“, die Auflösung von Grenzen durch die neuen Technologien und die Entstehung von Visionen einer durch Technologie transformierten Gesellschaft. Es fokussiert sich auf die imaginierten Möglichkeiten und die damit verbundenen Hoffnungen und Ängste einer neuen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Cyberkultur, Personalcomputer, Autodidaxie, Kreativität, Technologische Utopien, Digitalisierung, Soziotechnik, Medien, Gegenkultur, Innovation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss des Personalcomputers auf die Entstehung der Cyberkultur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Personalcomputers auf die Entstehung der Cyberkultur in den 1970er und 1980er Jahren. Der Fokus liegt auf der Veränderung individueller Praktiken (insbesondere autodidaktisches Lernen und Kreativität) und der Entstehung technologischer Utopien durch die Entwicklung und den Gebrauch des PCs.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Digitalisierung des Individuums und veränderte Lernmethoden, den Einfluss von Gegenkulturbewegungen, die Rolle von Kreativität und Innovation, soziotechnische Spannungen durch die zunehmende Technologisierung und die Entstehung und Entwicklung technologischer Utopien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: I. "Apprendre l'outil. L'individu et ses pratiques dans la cyberculture émergente" (Das Werkzeug erlernen: Individuum und Praktiken in der entstehenden Cyberkultur), II. "Gouverner les médiations. Les terrains de la «< cybersocial reality >>" (Die Vermittlungen steuern: Die Gebiete der „Cyber-sozialen Realität“) und III. "Comprendre les anticipations. De l'imagination aux utopies technologiques" (Die Erwartungen verstehen: Von der Imagination zu den technologischen Utopien). Jedes Kapitel ist in mehrere Unterkapitel gegliedert.
Was wird im ersten Kapitel behandelt?
Kapitel I analysiert die Digitalisierung des Individuums und die damit verbundenen Veränderungen im autodidaktischen Lernen und der Kreativität. Es untersucht, wie der Personalcomputer neue Möglichkeiten der Wissensaneignung und -produktion eröffnet und zu innovativen und utopischen Vorstellungen führt.
Was ist der Inhalt des zweiten Kapitels?
Kapitel II befasst sich mit der kulturellen Geschichte der „Cyber-Revolution“, der Rolle von Medien und Pionieren in der Cyberkultur und den soziotechnischen Spannungen durch die zunehmende Technologisierung. Es analysiert die Herausforderungen und Veränderungen sozialer Strukturen durch die neue Technologie und den entstehenden virtuellen Raum.
Worum geht es im dritten Kapitel?
Kapitel III untersucht die Entwicklung technologischer Utopien im Kontext der entstehenden Cyberkultur. Es analysiert ein „techno-logisches Quadrat“, die Auflösung von Grenzen durch neue Technologien und die Entstehung von Visionen einer durch Technologie transformierten Gesellschaft. Es konzentriert sich auf die imaginierten Möglichkeiten und die damit verbundenen Hoffnungen und Ängste.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cyberkultur, Personalcomputer, Autodidaxie, Kreativität, Technologische Utopien, Digitalisierung, Soziotechnik, Medien, Gegenkultur, Innovation.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist der Einfluss des Personalcomputers und der entstehenden Cyberkultur auf individuelle Lernpraktiken und die Entstehung technologischer Utopien. Die Bedeutung des PCs als Werkzeug des Konsums und der Produktion immaterieller Güter sowie die Rolle von Vorläufern und Pionieren werden hervorgehoben.
- Quote paper
- Simone Lackerbauer (Author), 2012, Créer la cyberculture, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279963