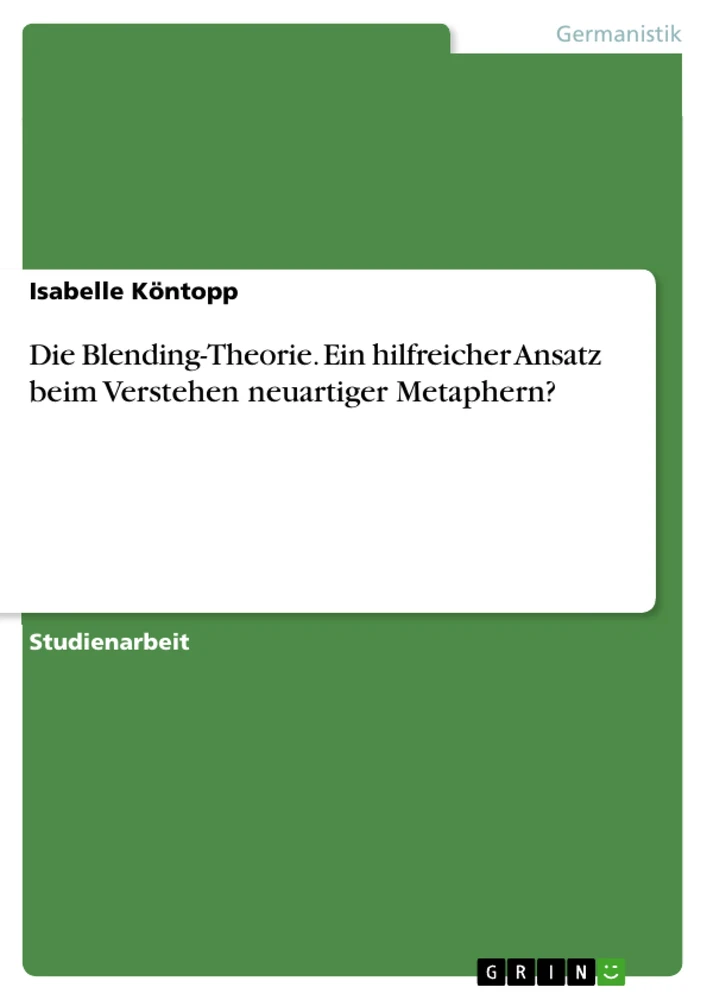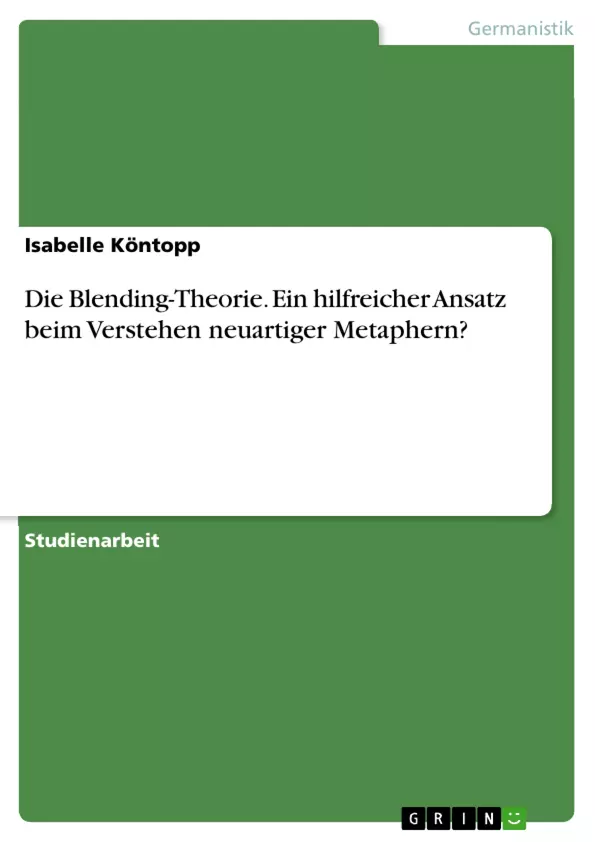Die Blending-Theorie wurde von Fauconnier und Turner (1996, 2002) im Rahmen der (holistischen) kognitiven Linguistik entwickelt. Sie geht aus der mental space theory von Fauconnier hervor. In der Blending-Theorie wird das Metaphernverstehen dadurch erklärt, dass die Bedeutung durch die Interaktion mentaler Bereiche vom Rezipienten konstruiert wird. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Emergenz-Begriff. Die Blending-Theorie wird als eine Ergänzung der konzeptuellen Metapherntheorie von Lakoff und Johnson (1980) betrachtet.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst ein Überblick über die Blending-Theorie gegeben werden. Anhand eines selbstgewählten Korpus wird anschließend ihre Anwendbarkeit an
einigen Beispielen neuartiger Metaphern erprobt. Dies soll eine Einschätzung darüber erlauben, ob die Blending-Theorie einen hinreichenden Ansatz zur Erklärung des Metaphernverstehens bietet. Die Ergebnisse der Analyse werden abschließend diskutiert und mit Kritikpunkten der bestehenden Literatur verknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 0.1 Fragestellung und These
- 0.2 Korpus
- 1 Die Blending-Theorie
- 1.1 Die mentalen Bereiche
- 1.1.1 Input-Bereiche
- 1.1.2 Generischer Bereich
- 1.1.3 Blending-Bereich
- 1.2 Beschränkungen der Blending-Theorie: Optimalitätsprinzipien
- 2 Korpus-Analyse
- 2.1 Metaphernverstehen ohne Kotextualisierung
- 2.2 Metaphernverstehen mithilfe von Ko- und Kontext
- 3 Diskussion
- 4 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Blending-Theorie auf das Verstehen neuartiger Metaphern. Das Hauptziel ist es, zu evaluieren, ob die Theorie ein ausreichendes Modell zur Erklärung dieses Prozesses bietet. Die Arbeit prüft die Theorie anhand eines selbst zusammengestellten Korpus innovativer Metaphern.
- Die Blending-Theorie als Erklärungsmodell für Metaphernverständnis
- Analyse des Metaphernverstehens mit und ohne Kontextualisierung
- Untersuchung der Grenzen der Blending-Theorie bei neuartigen Metaphern
- Bedeutung von Kontext für das Verständnis neuartiger Metaphern
- Vergleich der Blending-Theorie mit anderen Metapherntheorien
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Metaphernverständnisses innerhalb der kognitiven Linguistik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit der Blending-Theorie auf neuartige Metaphern. Sie formuliert die These, dass die Blending-Theorie keinen hinreichenden Ansatz zur Erklärung bietet und beschreibt das verwendete Korpus von 15 sprachlichen Äußerungen, bestehend aus innovativen und kreativen Metaphern sowie nicht-metaphorischem Sprachgebrauch. Die Herausforderungen bei der Bestimmung des Grades der Neuartigkeit einer Metapher werden angesprochen. Die Einleitung legt den Grundstein für die Untersuchung, indem sie die Forschungsfrage präzisiert und den methodischen Ansatz umreißt.
1 Die Blending-Theorie: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Blending-Theorie von Fauconnier und Turner, indem es die zentralen Komponenten wie mentale Bereiche (Input-Bereiche, generischer Bereich, Blending-Bereich) und die Optimalitätsprinzipien erläutert. Es werden die Verbindungen zur mental space theory und zur Interaktionstheorie der Metapher hergestellt und der Unterschied zur konzeptuellen Metapherntheorie von Lakoff und Johnson herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Erklärung des Metaphernverständnisses durch die Interaktion mentaler Bereiche und dem Konzept der Emergenz. Das Kapitel betont den holistischen Ansatz der kognitiven Linguistik, der keine strikte Trennung zwischen sprachlichen und konzeptuellen Strukturen vornimmt. Es bereitet den Leser auf die spätere Anwendung der Theorie auf konkrete Beispiele vor.
2 Korpus-Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die Analyse des ausgewählten Korpus, das sowohl neuartige als auch kreative Metaphern umfasst. Es untersucht das Metaphernverstehen in unterschiedlichen Kontexten, um aufzuzeigen, wie kontextuelle Faktoren das Verständnis beeinflussen. Durch die Gegenüberstellung von metaphorischem und nicht-metaphorischem Sprachgebrauch soll die Anwendbarkeit der Blending-Theorie empirisch geprüft werden. Die Kapitel analysiert wie die verschiedenen Beispiele von Metaphern und ihrem jeweiligen Kontext zum Verständnis beitragen und ob und wie die Blending-Theorie diese Fälle erklären kann.
Schlüsselwörter
Blending-Theorie, Metaphernverstehen, konzeptuelle Integration, neuartige Metaphern, Kontextualisierung, kognitive Linguistik, mentale Räume, Emergenz, Korpusanalyse, Optimalitätsprinzipien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anwendbarkeit der Blending-Theorie auf neuartige Metaphern
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Blending-Theorie auf das Verstehen neuartiger Metaphern. Das Hauptziel ist die Evaluierung, ob die Theorie ein ausreichendes Modell zur Erklärung dieses Prozesses bietet.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Bietet die Blending-Theorie einen hinreichenden Ansatz zur Erklärung des Verständnisses neuartiger Metaphern?
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Korpusanalyse. Es wird ein selbst zusammengestellter Korpus innovativer Metaphern analysiert, um die Anwendbarkeit der Blending-Theorie empirisch zu prüfen. Der Korpus besteht aus 15 sprachlichen Äußerungen, die sowohl innovative und kreative Metaphern als auch nicht-metaphorischen Sprachgebrauch enthalten.
Was ist die Blending-Theorie?
Die Arbeit beschreibt die Blending-Theorie von Fauconnier und Turner. Die zentralen Komponenten der Theorie, wie mentale Bereiche (Input-Bereiche, generischer Bereich, Blending-Bereich) und die Optimalitätsprinzipien, werden erläutert. Die Verbindungen zur mental space theory und zur Interaktionstheorie der Metapher werden hergestellt, und der Unterschied zur konzeptuellen Metapherntheorie von Lakoff und Johnson wird herausgearbeitet.
Welche Aspekte des Metaphernverständnisses werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das Metaphernverstehen mit und ohne Kontextualisierung. Sie untersucht die Grenzen der Blending-Theorie bei neuartigen Metaphern und die Bedeutung von Kontext für das Verständnis dieser Metaphern. Ein Vergleich der Blending-Theorie mit anderen Metapherntheorien wird angedeutet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Blending-Theorie, einem Kapitel zur Korpusanalyse, einer Diskussion und einer Zusammenfassung/einem Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Das Kapitel zur Blending-Theorie erklärt die Theorie. Das Kapitel zur Korpusanalyse präsentiert die Ergebnisse der Analyse. Die Diskussion bewertet die Ergebnisse im Kontext der Theorie. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Blending-Theorie, Metaphernverstehen, konzeptuelle Integration, neuartige Metaphern, Kontextualisierung, kognitive Linguistik, mentale Räume, Emergenz, Korpusanalyse, Optimalitätsprinzipien.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit evaluiert, ob die Blending-Theorie ein ausreichendes Modell für das Verständnis neuartiger Metaphern darstellt. Die Ergebnisse der Korpusanalyse sollen zeigen, inwieweit die Theorie die analysierten Beispiele erklären kann und welche Grenzen sie aufweist.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler*innen und Studierende der kognitiven Linguistik und verwandter Gebiete bestimmt, die sich mit Metaphern und deren Verständnis auseinandersetzen.
- Quote paper
- MA Isabelle Köntopp (Author), 2013, Die Blending-Theorie. Ein hilfreicher Ansatz beim Verstehen neuartiger Metaphern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280051