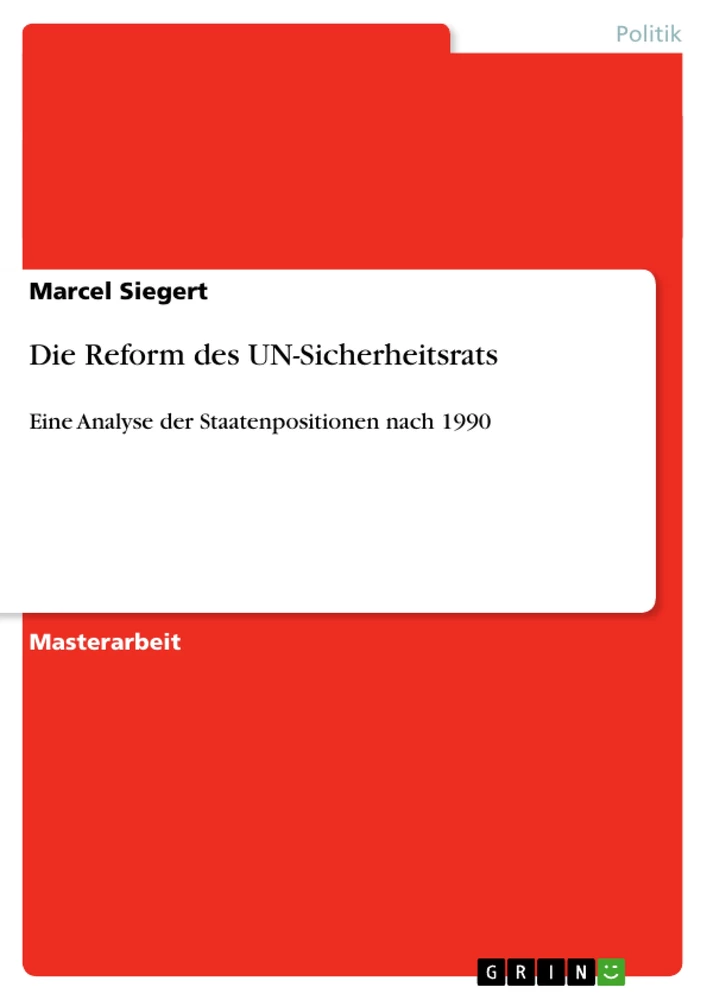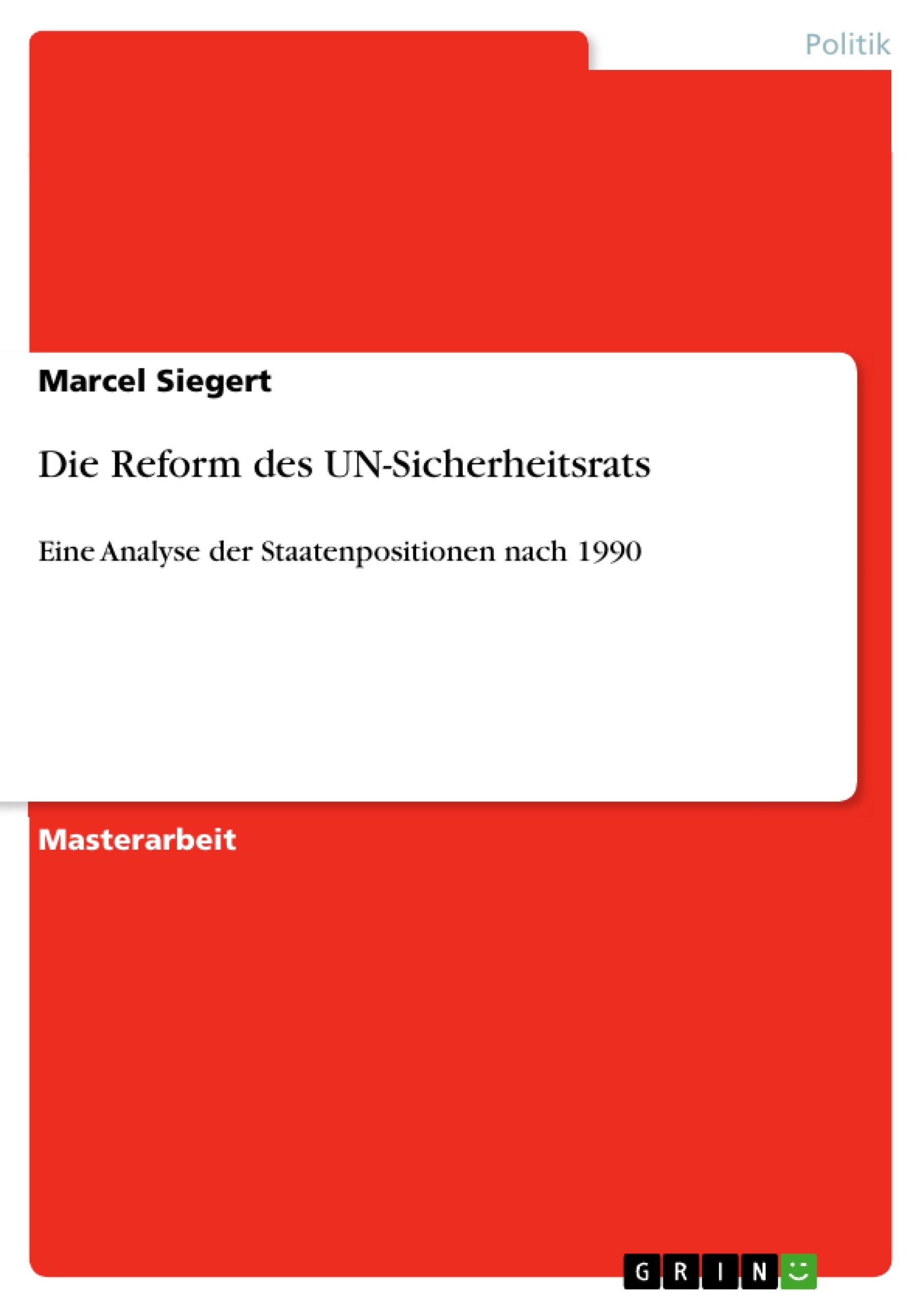Diese Arbeit stellt die Mehrheitsverhältnisse der verschiedenen Meinungslager in der Diskussion nach der Debattenintensivierung 1990 dar und zeigt deren Veränderungen im Zeitverlauf auf. Die zugrundeliegende Fragestellung lautet: "Wie haben sich die Mehrheitsverhältnisse der Staatenpositionen seit den 1990ern geändert?" Unter „Position“ wird die Haltung eines Staates zu Reformvorschlägen verstanden.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer eigenen, umfassenden Analyse der Positionen. Als Quellenmaterial dienen die offiziellen Protokolle der Plenarsitzungen zum Agendapunkt „Question of equitable representation on and increase in the membership of the security council” der Generalversammlung. Auf Grundlage eines Kategoriensystems werden die Stellungnahmen der UN-Mitgliedsstaaten analysiert. Die Abhandlung legt nach einer Betrachtung der Reformdiskussion drei Untersuchungszeitpunkte fest: 1996/1997, 2004/2005 und 2013/2014. Diagramme stellen die Auswertungsergebnisse grafisch gegenüber. Die Auffälligkeiten in den Darstellungen werden angesprochen und durch Erklärungsversuche gestützt.
Das beschriebene Vorgehen wird nicht nur für alle UN-Staaten durchgeführt, sondern auch speziell für die "einflussreichsten Staaten der UN" (Stand 2013). Welche Staaten zu den einflussreichsten der UN gezählt werden, wird in dieser Arbeit durch fünf Indikatoren ermittelt: Bevölkerung, Flächengröße, Bruttoinlandsprodukt, Anteile am UN-Gesamtbudget sowie Abstellen von UN-Truppen.
Die Ergebnisse der Arbeit liefern eine Grundlage, Reformvorschläge zu entwickeln, die für den Großteil der Staaten annehmbar wären. Zumindest ermöglicht die Untersuchung, Tendenzen in der Reformdebatte zu erkennen. Aus der Analyse geht auch hervor, welche Widerstände in den einzelnen Kategorien vorherrschen. Nicht nur auf Grund des einheitlichen Analysematerials bietet sie sich als Grundlage für Folgeforschungen an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Fragestellung und Ziele der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Literaturüberblick
- Monografien, Aufsätze, etc.
- Internetplattformen
- Vorangegangene Erhebungen von Staatenpositionen
- Grundlegendes zum UN-Sicherheitsrat
- Aufgaben des Sicherheitsrats
- Zusammensetzung des Sicherheitsrats
- Abstimmungsverfahren im Sicherheitsrat
- Zusammenfassung
- Reform des UNSC: Gründe, Ziele & Probleme
- Sicherheitsratsreform als Kern der UN-Reform
- Mangel an Repräsentativität, Effektivität und Legitimität
- Hindernisse einer Reform des UNSC
- Zusammenfassung
- Kategorisierung der Diskussion um den UNSC
- Größe eines erweiterten Sicherheitsrats
- Kategorien der Mitgliedschaft
- Regionale Repräsentation
- Das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder
- Arbeitsmethoden und Beziehung zur Generalversammlung
- Zusammenfassung
- Schlussfolgerungen für die Analyse
- Reformgeschichte des Sicherheitsrats
- Die Reformdiskussion bis 1990
- Wiederaufleben der Diskussion in den 1990ern
- Neue Weltordnung benötigt neuen Sicherheitsrat
- Der Razali-Plan von 1997
- Hohe Erwartungen an den Weltgipfel 2005
- Auftakt zum Gipfel
- Reformmodelle vor dem Weltgipfel
- Neue Gespräche zwischen 2008 und 2013
- Das Ende der OEWG
- Neue Verhandlungen und eine neue Staatengruppe
- Erneuter Abbruch der Verhandlungen und aktuelle Situation
- Zusammenfassung
- Schlussfolgerungen für die Analyse
- Analyse der Staatenpositionen
- Einleitende Bemerkungen
- Aufbau des Kapitels
- Auswahl des Untersuchungsmaterials
- Überblick über die heute einflussreichsten UN-Staaten
- Untersuchungszeitpunkt 1996/1997 (51. GV)
- Kategorie Erweiterung
- Kategorie Vetorecht
- Kategorie Arbeitsmethoden
- Positionen der heute einflussreichsten UN-Staaten
- Zwischenfazit
- Untersuchungszeitpunkt 2004/2005 (59. GV)
- Kategorie Erweiterung
- Kategorie Vetorecht
- Kategorie Arbeitsmethoden
- Positionen der heute einflussreichsten UN-Staaten
- Zwischenfazit
- Untersuchungszeitpunkt 2013/2014 (68. GV)
- Kategorie Erweiterung
- Kategorie Vetorecht
- Kategorie Arbeitsmethoden
- Positionen der heute einflussreichsten UN-Staaten
- Zwischenfazit
- Vergleich der Untersuchungszeitpunkte
- Kategorie Erweiterung
- Kategorie Vetorecht
- Kategorie Arbeitsmethoden
- Positionen der heute einflussreichsten UN-Staaten
- Zwischenfazit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Positionen von Staaten in der Debatte um eine Reform des UN-Sicherheitsrats seit den 1990er Jahren. Ziel ist es, die Entwicklung der Diskussion und die wichtigsten Streitpunkte zu identifizieren und zu verstehen, welche Faktoren die Reformbemühungen beeinflussen.
- Entwicklung der Diskussion um eine Reform des UN-Sicherheitsrats
- Analyse der Positionen verschiedener Staatengruppen
- Die Rolle des Vetorechts in der Reformdebatte
- Die Bedeutung regionaler Repräsentation
- Zusammenhang zwischen Sicherheitsratsreform und UN-Reform insgesamt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, die Fragestellung und die Ziele der Arbeit. Sie skizziert den Aufbau und bietet einen Überblick über den verwendeten Literaturbestand, inklusive Monografien, Internetquellen und vorherige Untersuchungen zu Staatenpositionen.
Grundlegendes zum UN-Sicherheitsrat: Dieses Kapitel erläutert die Aufgaben, die Zusammensetzung, die Abstimmungsverfahren und die grundlegende Funktionsweise des UN-Sicherheitsrats. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der späteren Reformdebatte.
Reform des UNSC: Gründe, Ziele & Probleme: Dieser Abschnitt beleuchtet die Notwendigkeit einer Sicherheitsratsreform, die Gründe dafür, die angestrebten Ziele und die bestehenden Hindernisse. Es werden die zentralen Probleme wie mangelnde Repräsentativität, Effektivität und Legitimität thematisiert.
Kategorisierung der Diskussion um den UNSC: Dieses Kapitel strukturiert die Diskussion um den UN-Sicherheitsrat in verschiedene Kategorien, darunter die Größe eines erweiterten Rates, die Kategorien der Mitgliedschaft, regionale Repräsentation, das Vetorecht, und die Arbeitsmethoden sowie die Beziehung zur Generalversammlung. Es legt die analytischen Kategorien für die anschließende Untersuchung der Staatenpositionen fest.
Reformgeschichte des Sicherheitsrats: Hier wird die Geschichte der Reformbemühungen chronologisch dargestellt, von der Diskussion bis 1990, über das Wiederaufleben in den 1990ern (inkl. Razali-Plan), die hohen Erwartungen an den Weltgipfel 2005, bis hin zu den Verhandlungen zwischen 2008 und 2013 und der aktuellen Situation. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der Debatte und deren Entwicklung.
Analyse der Staatenpositionen: Dieses Kapitel ist das Kernstück der Arbeit und analysiert die Positionen verschiedener Staaten zu den oben genannten Kategorien zu verschiedenen Zeitpunkten (1996/97, 2004/05, 2013/14). Es vergleicht die Positionen der einflussreichsten UN-Staaten und identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Schlüsselwörter
UN-Sicherheitsrat, Sicherheitsratsreform, Vetorecht, Repräsentativität, Legitimität, Effektivität, Staatenpositionen, Reformdebatte, regionale Repräsentation, Weltgipfel, Generalversammlung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Reform des UN-Sicherheitsrats
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Positionen von Staaten in der Debatte um eine Reform des UN-Sicherheitsrats (UNSC) seit den 1990er Jahren. Das Ziel ist es, die Entwicklung der Diskussion und die wichtigsten Streitpunkte zu identifizieren und zu verstehen, welche Faktoren die Reformbemühungen beeinflussen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Diskussion um eine UNSC-Reform, die Analyse der Positionen verschiedener Staatengruppen, die Rolle des Vetorechts, die Bedeutung regionaler Repräsentation, den Zusammenhang zwischen Sicherheitsratsreform und UN-Reform insgesamt, sowie die Geschichte der Reformbemühungen von den 1990ern bis zur aktuellen Situation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, Fragestellung und Ziele definiert. Es folgt ein Kapitel zu den Grundlagen des UNSC. Ein weiterer Abschnitt beleuchtet die Gründe, Ziele und Probleme einer Reform. Die Diskussion um den UNSC wird kategorisiert (Größe, Mitgliedschaft, Vetorecht etc.). Ein Kapitel widmet sich der Geschichte der Reformbemühungen. Der Kern der Arbeit ist die Analyse der Staatenpositionen zu verschiedenen Zeitpunkten (1996/97, 2004/05, 2013/14), verglichen und zusammengefasst.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Analyse der Staatenpositionen konzentriert sich auf drei Zeitpunkte: 1996/1997 (51. Generalversammlung), 2004/2005 (59. Generalversammlung) und 2013/2014 (68. Generalversammlung). Diese Zeitpunkte ermöglichen einen Vergleich der Entwicklung der Positionen im Laufe der Zeit.
Welche Kategorien werden zur Analyse der Staatenpositionen verwendet?
Die Analyse der Staatenpositionen erfolgt anhand der Kategorien Erweiterung des Sicherheitsrats, Vetorecht, Arbeitsmethoden und regionale Repräsentation. Diese Kategorien strukturieren die Untersuchung und ermöglichen einen systematischen Vergleich.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf einen Literaturüberblick, der Monografien, Aufsätze, Internetplattformen und vorherige Erhebungen von Staatenpositionen umfasst.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Entwicklung der Diskussion um die Reform des UN-Sicherheitsrats, die wichtigsten Streitpunkte und die Faktoren, die die Reformbemühungen beeinflussen. Die detaillierten Schlussfolgerungen sind im letzten Kapitel der Arbeit dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: UN-Sicherheitsrat, Sicherheitsratsreform, Vetorecht, Repräsentativität, Legitimität, Effektivität, Staatenpositionen, Reformdebatte, regionale Repräsentation, Weltgipfel, Generalversammlung.
- Arbeit zitieren
- Marcel Siegert (Autor:in), 2014, Die Reform des UN-Sicherheitsrats, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280108