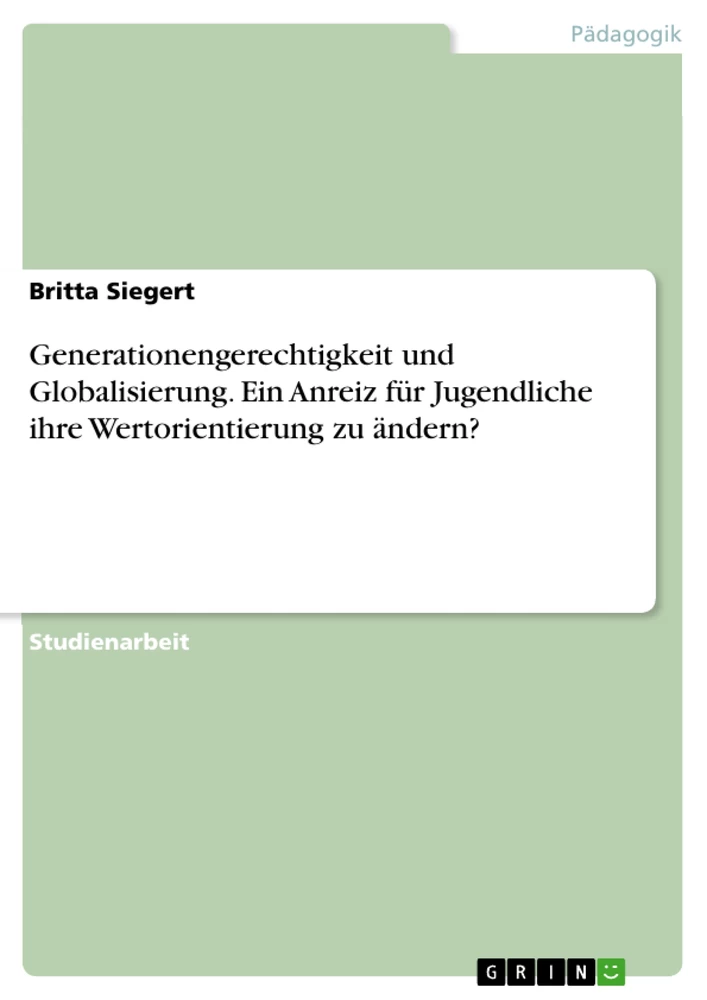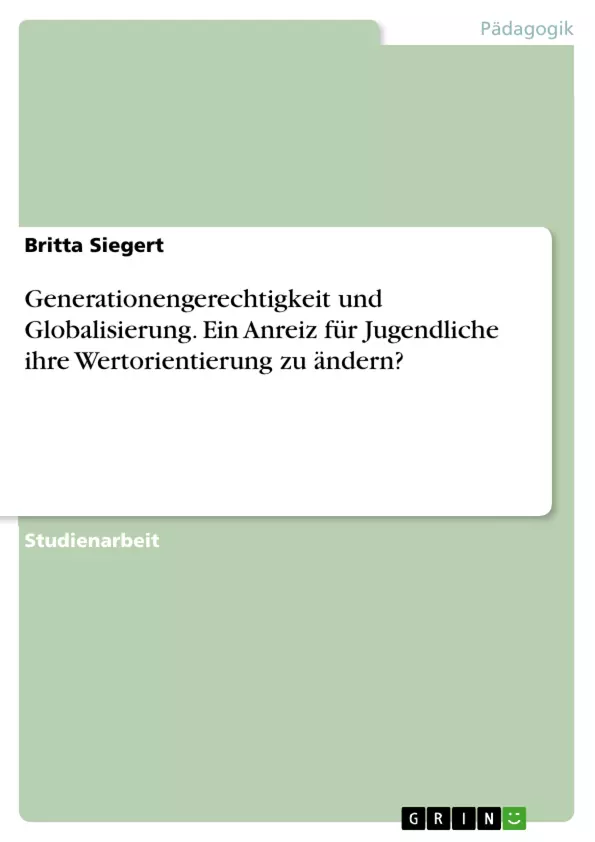Seit Langem ist die Jugendphase ein sehr beliebtes Thema, über welches in vielen Bereichen diskutiert wird. Dabei werden die Jugendlichen pädagogisch, sorgenvoll und kritisch in den Blick genommen. Doch dieses Interesse korrespondiert leider nicht immer mit dem wesentlichen Engagement für Interessen, Belange oder auch Bedürfnisse der jungen Heranwachsenden. Obwohl Jugendliche grundsätzlich einen besonderen gesetzlichen Schutz genießen und gegenüber Erwachsenen eingeschränkte Rechte haben, ist gerade diese Altersgruppe von strukturellen Veränderungen betroffen, das heißt, dass die Risiken moderner Gesellschaften, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, vor ihnen keinen Halt machen. Die strukturellen Veränderungen wirken sich auf den gesamten Lebensstil der Jugendlichen aus. Ihre Einstellungen und Bedürfnisse haben sich grundlegend geändert. Heutzutage stehen Zukunftsängste und Zeitmangel im Vordergrund. Wertorientierungen und deren Funktionen, welche das menschliche Verhalten und Handeln beeinflussen, haben sich geändert. Auch wenn diese Phase durch eine Erhöhte Veränderlichkeit von Werten gekennzeichnet ist, reagieren sie trotzdem mittlerweile ziemlich sensibel auf die gesellschaftlichen Wertewandelprozesse.
Diese Hausarbeit befasst sich daher mit dem Thema „Generationengerechtigkeit und Globalisierung. Ein Anreiz für Jugendliche zur Veränderung der Wertorientierungen?“ und soll somit einen Überblick über einzelne Gebiete, die mit dieser Thematik in Verbindung gebracht werden können, geben. Der Entschluss für diese Themenwahl ist darin begründet, dass vor allem Globalisierung und der demografischer Wandel ein immer wieder aufgegriffenes Thema sind und auch über die Jugendphase immer häufiger angeregt diskutiert wird. Aufgrund dessen wurde das Interesse für dieses Thema geweckt. Die Fragestellung dieser Arbeit richtet sich dementsprechend darauf, wie sich die Megatrends auf die Wertvorstellungen und das Leben der Jugendlichen auswirken. Daher liegen die Ziele darin, einen Einblick über die jeweiligen Megatrends, wie auch über die Phase Jugend zu gewähren. Zudem werden die Wertorientierungen näher beleuchtet und anschließend sollen die Auswirkungen der strukturellen Veränderungen auf die Jugendlichen in den Blick genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Generationengerechtigkeit
- Globalisierung
- Die Phase Jugend
- Wertorientierungen
- Allgemeine Wertorientierungen
- Wertorientierungen Jugendlicher
- Auswirkungen von Wertorientierungen auf das Leben der Jugendlichen
- Generationengerechtigkeit und Globalisierung als Anreiz für die Veränderung von Wertorientierungen der Jugendlichen
- Auswirkungen der Megatrends auf das Leben der Jugendlichen
- Auswirkungen der Megatrends auf die Wertorientierungen von Jugendlichen
- Zukunft des Wertewandels in einem Szenario
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Generationengerechtigkeit und Globalisierung als Anreize für Jugendliche zur Veränderung ihrer Wertorientierungen dienen. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Megatrends auf das Leben und die Wertvorstellungen junger Menschen.
- Definition und Analyse der Begriffe Generationengerechtigkeit, Globalisierung und Jugendphase
- Untersuchung der Wertorientierungen von Jugendlichen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Bewertung der Auswirkungen von Generationengerechtigkeit und Globalisierung auf die Wertorientierungen von Jugendlichen
- Szenarioanalyse zur zukünftigen Entwicklung des Wertewandels bei Jugendlichen
- Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Generationengerechtigkeit und Globalisierung als Anreize für den Wertewandel bei Jugendlichen ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage sowie die Ziele der Arbeit dar.
Das Kapitel „Begriffsdefinitionen“ erläutert die zentralen Begriffe Generationengerechtigkeit, Globalisierung und Jugendphase. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Generationsbegriff und die Bedeutung von Gerechtigkeit im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen.
Das Kapitel „Wertorientierungen“ befasst sich mit den Werten von Jugendlichen und deren Bedeutung für ihr Leben. Es analysiert die allgemeinen Wertorientierungen in der Gesellschaft und untersucht, wie sich diese auf die Wertvorstellungen von Jugendlichen auswirken.
Das Kapitel „Generationengerechtigkeit und Globalisierung als Anreiz für die Veränderung von Wertorientierungen der Jugendlichen“ untersucht die Auswirkungen der Megatrends auf das Leben und die Wertorientierungen von Jugendlichen. Es analysiert die Auswirkungen der strukturellen Veränderungen auf den Lebensstil und die Wertvorstellungen junger Menschen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Generationengerechtigkeit, Globalisierung, Jugendphase, Wertorientierungen, Wertewandel, Megatrends, strukturelle Veränderungen, Lebensstil, Zukunftsängste, Zeitmangel, gesellschaftliche Entwicklungen, demografischer Wandel, Shell-Studien, Generationenlagerung, historisch-soziologischer Generationsbegriff.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Globalisierung und demografischer Wandel die Jugend?
Diese Megatrends führen zu strukturellen Veränderungen im Lebensstil, erhöhen Zukunftsängste und verändern die Wertorientierungen der Jugendlichen grundlegend.
Was versteht man unter Generationengerechtigkeit?
Es bezeichnet die faire Verteilung von Ressourcen, Chancen und Lasten zwischen heutigen und zukünftigen Generationen, insbesondere im Hinblick auf soziale Sicherungssysteme.
Warum reagieren Jugendliche sensibel auf den gesellschaftlichen Wertewandel?
Da die Jugendphase durch eine hohe Veränderlichkeit von Werten geprägt ist, spiegeln sich gesellschaftliche Krisen und Trends unmittelbar in ihren persönlichen Einstellungen wider.
Welche Rolle spielen die Shell-Studien in dieser Analyse?
Die Shell-Studien dienen als wichtige Datenbasis, um die Einstellungen, Bedürfnisse und den Wandel der Wertvorstellungen über verschiedene Generationen hinweg zu vergleichen.
Führt Zeitmangel zu einer Veränderung der Werte bei jungen Menschen?
Ja, durch den gestiegenen Leistungsdruck und die Beschleunigung in einer globalisierten Welt rücken pragmatische Werte und Effizienz oft stärker in den Vordergrund.
- Quote paper
- Britta Siegert (Author), 2012, Generationengerechtigkeit und Globalisierung. Ein Anreiz für Jugendliche ihre Wertorientierung zu ändern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280144