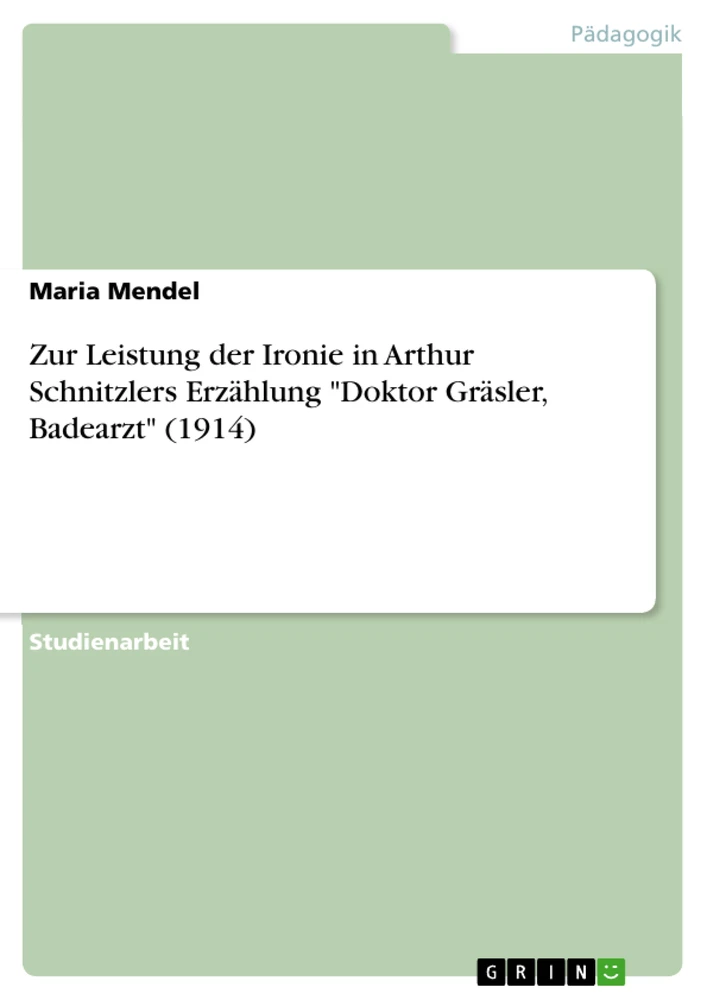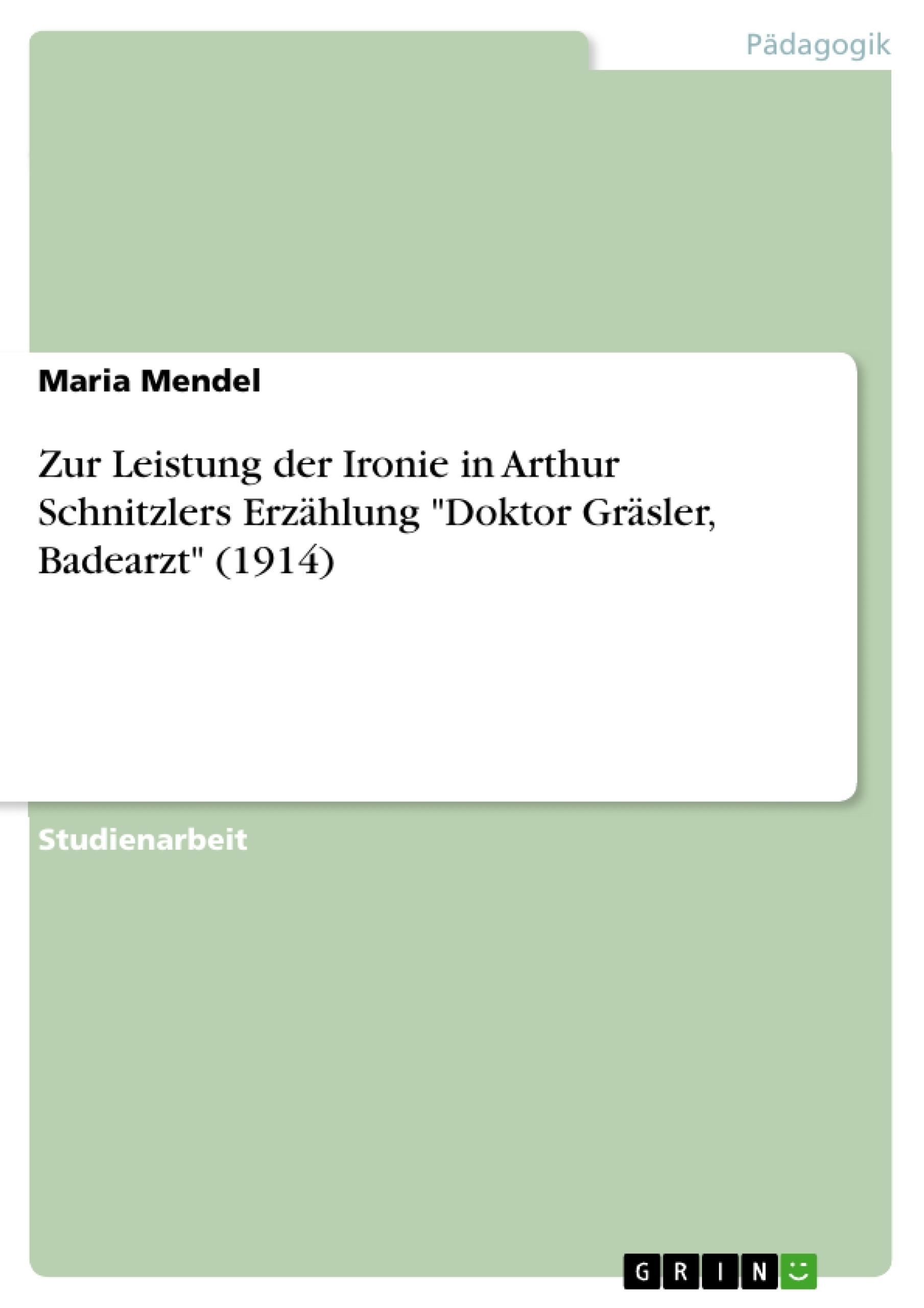Wenn Uwe Johnson fragt: „Wo ist der Erzähler auffindbar?“ so wird das Problem der Verortung der erzählenden Instanz im epischen Text thematisiert. Die Strukturelemente des Erzählens, und die Methoden, sie zu bestimmen, beschäftigen die Forschung seit langem. So untersucht Lämmert unterschiedliche View-point-Theorien und Fragen der Erzählergegenwart. Zeitgleich geht Stanzel von „Erzählern im Sinne erschaffener Figuren aus“, wobei laut Stanzel bei der Kategorie des personalen Erzählens die Erzählerfigur fehle. Lämmert bevorzugt im Rückgriff auf den Begriff des view-point die Bezeichnung „Standort“: Der Ich-Erzähler (oder der Berichterstatter) sieht als einer (meist) an der Handlung beteiligter die Dinge aus begrenzter Perspektive. Für ihn ist die Zukunft logischerweise ungewiss. Lämmert verweist darauf, dass der Erzähler natürlich den gesamten Ablauf des Geschehens überblickt: „Er führt als Akteur und Vermittler eine Doppelexistenz, indem er dem Leser die reale Spannung und Zukunftserwartung des handelnden Ich suggeriert.“ (Lämmert, 72) Für den inneren Monolog bedeutet dies im Gegensatz dazu, dass er sich völlig vom mitteilenden Erzähler emanzipiert. (Lämmert, 236) „Die Person macht sich mit ihren Gedanken selbständig und (…) isoliert sich, und man muß sich geradezu gewaltsam darauf zurückbesinnen, daß sie vom Erzähler `gemacht´ ist!“
Inhaltsverzeichnis
- I. Standort: point-of-view oder Nullfokalisierung
- II. Interne Fokalisierung: Selbstschutz
- Sentimentalität: Reduktion von Verantwortlichkeit
- Standessatire
- III.
- IV.
- V. Selektion: Kontrastierung........
- VI.
- Zusammenfassung
- VII. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktion von Ironie in Arthur Schnitzlers Erzählung „Doktor Gräsler, Badearzt“ (1914). Dabei werden die erzähltechnischen Mittel wie die Fokalisierung und Vorausdeutung analysiert, um die Wirkungsabsicht des Textes zu verstehen. Die Arbeit beleuchtet, wie die narrative Vermittlung mit der dominanten Funktion des ironischen Gestus in der Erzählung korreliert.
- Analyse der Erzählperspektive in „Doktor Gräsler, Badearzt“
- Untersuchung der Rolle der Ironie in der Darstellung der Figuren
- Erforschung der Beziehung zwischen Ironie und Sentimentalität
- Analyse der Bedeutung von Vorausdeutungen für die Ironie
- Deutung der Wirkungsabsicht des Textes durch die Verwendung der Ironie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Standort: point-of-view oder Nullfokalisierung
Dieses Kapitel untersucht die Frage der erzählenden Instanz im epischen Text und beleuchtet verschiedene Theorien zur Verortung der Erzählperspektive. Es wird der Begriff des „Standortes“ eingeführt und in Bezug auf die Erzählformen „Ich-Erzählung“ und „innerer Monolog“ erläutert. Lämmerts Konzept des „psychologischen Standorts“ wird vorgestellt und auf die Analyse der Ironie in Schnitzlers Erzählung bezogen.
II. Interne Fokalisierung: Selbstschutz
Dieses Kapitel analysiert die interne Fokalisierung in „Doktor Gräsler, Badearzt“ und beleuchtet die Rolle des Selbstschutzes in der Figur des Doktor Gräsler. Es wird gezeigt, wie die Sentimentalität Gräsler vor Verantwortung und Schuldgefühlen bewahrt. Außerdem wird die Bedeutung der Standessatire in der Erzählung untersucht.
III. Sentimentalität: Reduktion von Verantwortlichkeit
Dieses Kapitel vertieft die Analyse der Sentimentalität in „Doktor Gräsler, Badearzt“ und zeigt, wie sie dazu dient, Gräsler von moralischen Verantwortungsgefühlen zu befreien. Es wird untersucht, wie Gräsler mit den erotischen Abenteuern umgeht und welche Rolle die Sentimentalität dabei spielt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte der Arbeit sind: Ironie, Fokalisierung, Vorausdeutung, Sentimentalität, Selbstschutz, Standessatire, Arthur Schnitzler, Doktor Gräsler, Badearzt, Erzählperspektive, Wirkungsabsicht.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Ironie in Schnitzlers „Doktor Gräsler, Badearzt“?
Die Ironie dient als dominanter Gestus, um die Distanz des Erzählers zu den Figuren zu markieren und gesellschaftliche Fassaden zu entlarven.
Was ist der "psychologische Standort" des Erzählers?
Der Begriff nach Lämmert beschreibt die Perspektive, aus der der Erzähler das Geschehen betrachtet, was die Wahrnehmung von Zeit und Spannung beeinflusst.
Wie nutzt die Hauptfigur Sentimentalität als Selbstschutz?
Doktor Gräsler flüchtet sich in Sentimentalität, um moralische Verantwortung für sein Handeln und seine Beziehungen zu vermeiden.
Was versteht man unter Standessatire in diesem Werk?
Die Erzählung persifliert die bürgerlichen Werte und das Verhalten des ärztlichen Standes der Jahrhundertwende durch ironische Kontrastierung.
Was bewirkt der innere Monolog im Text?
Der innere Monolog lässt die Gedanken der Figur selbstständig erscheinen und isoliert sie vom vermittelnden Erzähler, was die psychologische Tiefe verstärkt.
- Quote paper
- Maria Mendel (Author), 2011, Zur Leistung der Ironie in Arthur Schnitzlers Erzählung "Doktor Gräsler, Badearzt" (1914), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280245