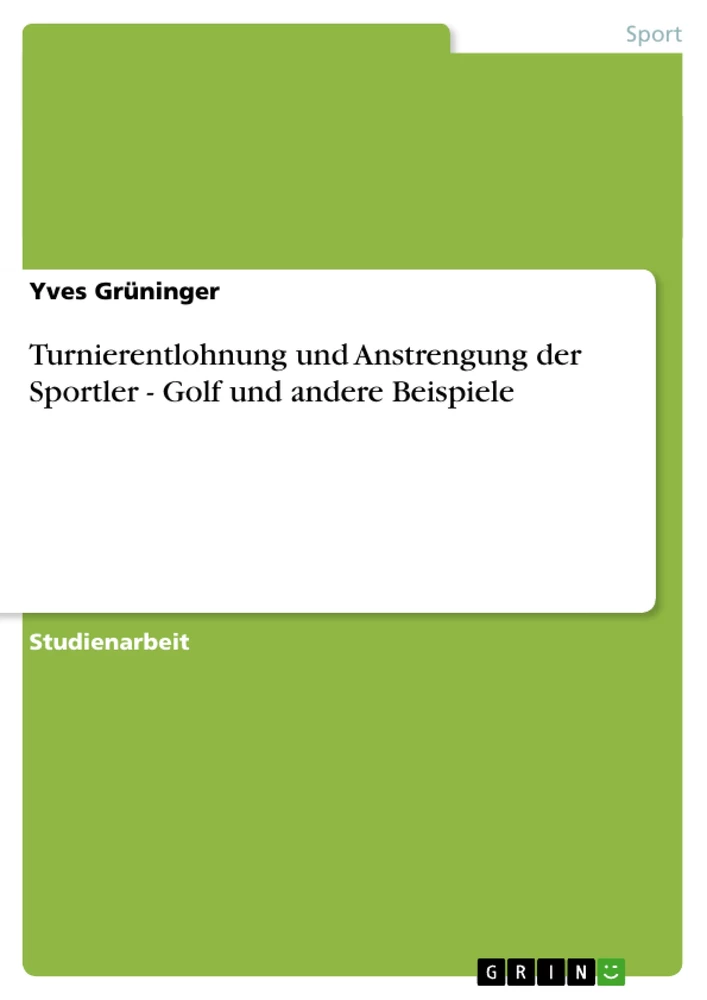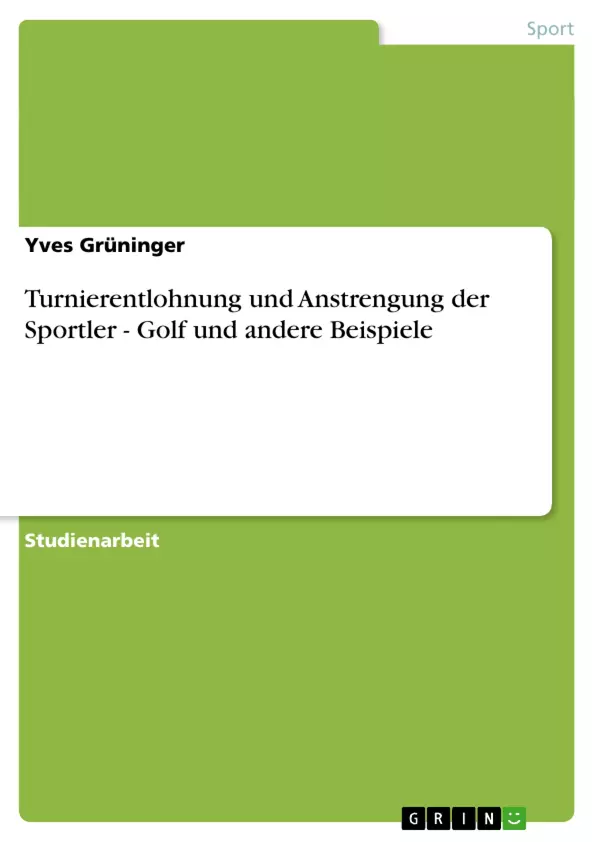Inwiefern das Entlohnungssystem von Arbeitskräften eine Auswirkung auf deren Produktivität hat, war schon oft Gegenstand von empirischen Untersuchungen. Lazear (2000) beispielsweise dokumentiert den Unterschied der Produktivität der Arbeitskräfte vor und nach dem Übergang von Stundenlöhnen zu Stücklöhnen und stellt eine signifikante Zunahme der Produktivität fest.1 Der Turnierentlohnung als Spezialform der Leistungsentlohnung hingegen, wurde bislang deutlich weniger Gewicht verliehen. Die vorliegende Arbeit befasst sich denn auch genau mit dieser Form der Entlohnung und untersucht die Wirkung der gesetzten Anreize auf die Anstrengung der Turnierteilnehmer. Dabei bietet sich der Sport als Untersuchungsgebiet an, weil Daten über die Anreize für die Teilnehmer (Preisverteilung) vorhanden sind und unter gewissen Bedingungen die Anstrengung über den erzielten Output (Rang) messbar ist.2 Zudem existieren gute Angaben über individuelle Attribute der einzelnen Arbeitnehmer (Sportler), die Gehälter sind recht transparent und die gesamte Karriere der Sportler kann vollständig verfolgt werden.3 Da diese Statistiken auch durchgehend detaillierter und genauer sind als typische mikroökonomische Daten, erachte ich es als sinnvoll, verschiedene Analysen aus dem Sport miteinander zu vergleichen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Turnierentlohnung auf ihre Anreizwirkungen hin zu untersuchen und im besten Fall allgemeingültige Erkenntnisse zu erhalten. (...)
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER HINTERGRUND
- Basiswerk der Turniertheorie von Lazear/Rosen (1981)
- Anreiztheorie und das Prinzipal-Agent Modell
- Erkenntnisse aus den bisherigen Überlegungen
- Direkte Anwendung auf den Sport
- Weiterentwicklungen der klassischen Turniertheorie
- Grenzen der Anwendbarkeit der Turniertheorie
- EVIDENZ AUS DEM SPORT
- Das Beispiel Golf
- Aufbau und Hypothesen
- Empirische Analyse
- Kritische Würdigung
- Zusätzliche Erkenntnisse aus dem Marathon Sport
- Aufbau und Hypothesen
- Empirische Analyse
- Kritische Würdigung
- Zusätzliche Erkenntnisse aus dem Autorennsport
- Aufbau und Hypothesen
- Empirische Analyse
- Kritische Würdigung
- SCHLUSSFOLGERUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Turnierentlohnung auf die Anstrengung von Sportlern. Das Ziel ist es, Erkenntnisse über die Anreizwirkungen dieser Form der Entlohnung zu gewinnen und im besten Fall allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen.
- Theoretische Grundlagen der Anreiz- und Turniertheorie
- Anwendung der Turniertheorie auf den Sport
- Empirische Studien in verschiedenen Sportarten (Golf, Marathon, Autorennen)
- Analyse der Anreizwirkungen von Turnierentlohnung
- Kritische Betrachtung der Methoden und Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt den Zusammenhang zwischen Entlohnungssystem und Produktivität von Arbeitskräften dar. Es wird die Besonderheit der Turnierentlohnung und deren Relevanz im Sportbereich aufgezeigt.
Kapitel 2 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Anreiz- und Turniertheorie. Dabei werden die zentralen Elemente des Prinzipal-Agent Modells erläutert, die in der Analyse der Turnierentlohnung im Sport relevant sind.
Kapitel 3 widmet sich der empirischen Analyse. Es werden verschiedene Sportarten untersucht, darunter Golf, Marathon und Autorennen, um die Anreizwirkungen von Turnierentlohnung zu erforschen.
Schlüsselwörter
Turnierentlohnung, Anreiztheorie, Prinzipal-Agent Modell, Sportökonomie, Golf, Marathon, Autorennen, empirische Analyse, Anstrengung, Leistung, Motivation, Preisverteilung, Preisgelder.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Prinzip der Turnierentlohnung?
Bei der Turnierentlohnung richtet sich die Bezahlung nicht nach der absoluten Leistung, sondern nach der relativen Platzierung im Vergleich zu anderen Teilnehmern (z. B. Preisgelder im Sport).
Warum eignet sich der Sport besonders gut für ökonomische Analysen der Leistung?
Im Sport sind Daten über Anreize (Preisgelder) und Output (Ranglisten/Ergebnisse) sehr transparent und detailliert verfügbar, was präzise Messungen der Anstrengung ermöglicht.
Welche Sportarten werden in dieser Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert empirische Daten aus dem Golfsport, dem Marathonlauf und dem Autorennsport.
Was besagt das Prinzipal-Agent-Modell im Kontext der Turnierentlohnung?
Es beschreibt das Verhältnis zwischen dem Auftraggeber (Prinzipal) und dem Ausführenden (Agent) und wie Anreizsysteme gestaltet sein müssen, um die gewünschte Anstrengung zu erzielen.
Führt eine ungleiche Preisverteilung zu mehr Anstrengung?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, ob größere Abstände zwischen den Preisgeldern (z. B. 1. vs. 2. Platz) die Motivation und damit die erbrachte Leistung der Teilnehmer steigern.
- Arbeit zitieren
- lic. rer. pol. Yves Grüninger (Autor:in), 2004, Turnierentlohnung und Anstrengung der Sportler - Golf und andere Beispiele, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28033