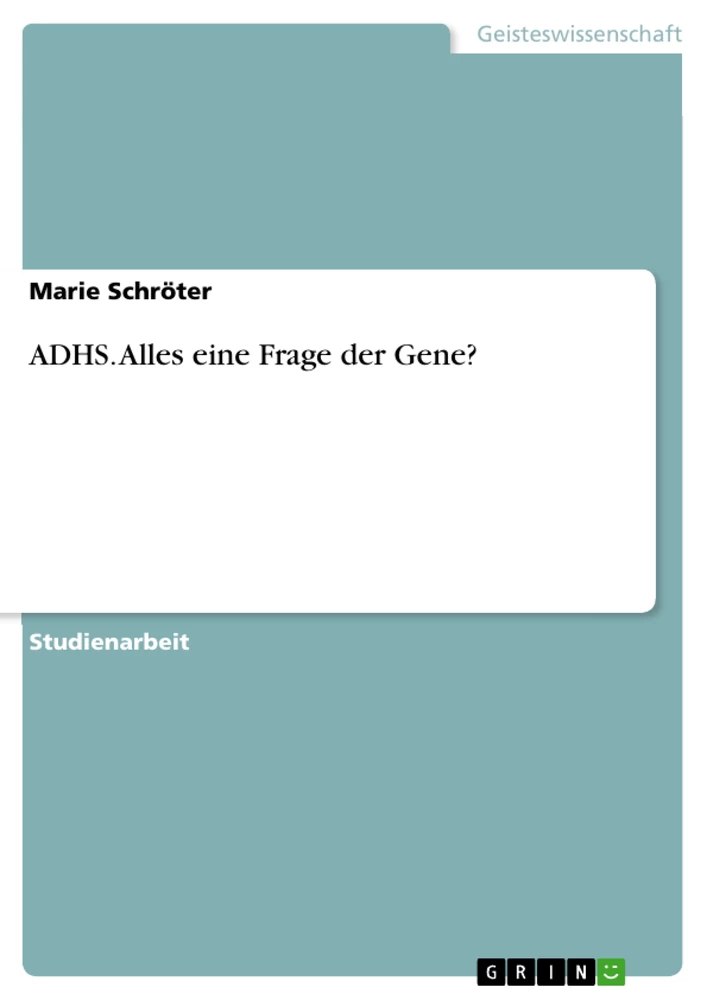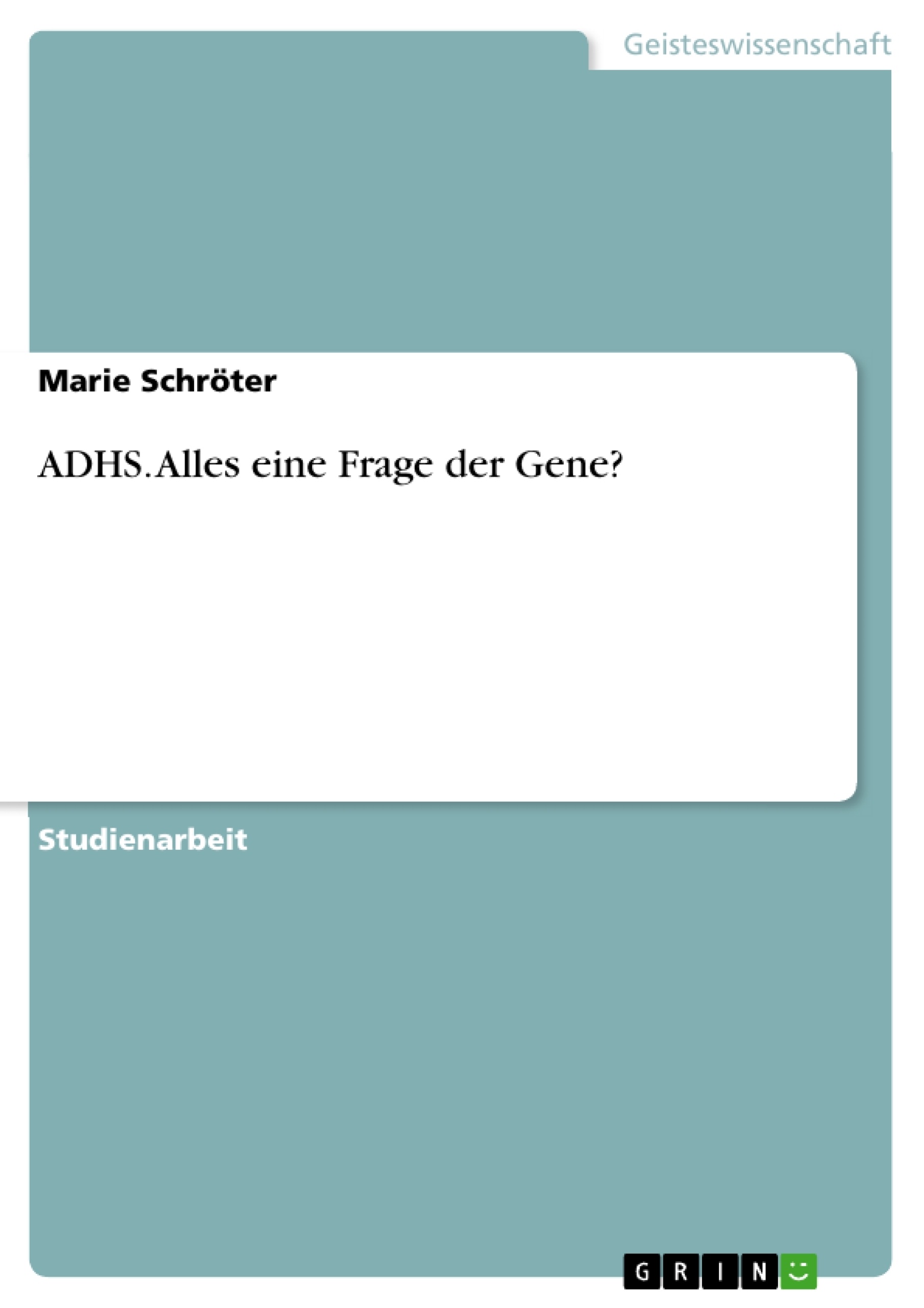Herumzappeln, Stören, keine Ruhe geben, das Gegenteil von dem tun, was ihnen aufgetragen wird, und dieses „in die Luft gehen“, wenn sie nicht sofort bekommen, was sie möchten, soll das die Generation sein, welche durch antiautoritäre Erziehung hervorgebracht wurde? Soll das ein Produkt unserer Erziehung sein? Haben wir das geschaffen und wird uns nun das Resultat dessen präsentiert in Form von Unaufmerksamkeit und Impulsivität?
Unterforderte Kinder, weil wir keine Zeit haben, um sie effektiv zu beschäftigen oder/und überforderte Eltern, weil ihr hyperaktiver Spross nach Aufmerksamkeit buhlt und sie ihm nicht gegeben werden kann?
Kinder, mit all ihren Eigenheiten, die nicht einfach nur liebenswert und angenehm sind, sondern auch Arbeit und Unverständnis hervorbringen; sind sie AUSSCHLIEßLICH das Produkt unsrer Erziehung und alle anderen Faktoren nur sekundär?
„Kein Wunder, daß das Kind so ist, bei den Eltern!“ Soll das alles sein, worauf sich zentriert werden muss? „Was habe ich falsch gemacht?“ Ratlosigkeit und Hilflosigkeit manövrieren beide Parteien, Eltern wie Kinder, in eine Ecke, aus der sich bald ein Beziehungsschlachtfeld ergeben kann, in welchem beide Parteien in ihrer Position verharren und das womöglich irreversibel.
Schuldgefühle bei Kindern und bei Eltern, aus dem Grund des einfachen Kausalprinzips? Falsche Erziehung als Ursache und die Wirkung dessen zeigt sich im hyperaktiven, impulsiven oder aufmerksamkeitsgestörten Verhalten des Kindes?
Dass solch eine kausale Aufstellung zu einfach ist und auch falsch sein kann, versucht diese Arbeit aufzudecken. Falsch dann, wenn es um Kinder mit einer Störung geht, die zwar häufig, aber nicht immer rechtzeitig, gar nicht oder falsch diagnostiziert wird. Die Rede ist hier von ADHS. Oft gehört, doch was genau beinhaltet dieses Kürzel? ADHS steht für: AufmerksamkeitsDefizitHyperaktivitätssydrom. Die einfach Entschlüsselung dieses Wortes läßt ein Defizit der Aufmerksamkeit erkennen und ein Hyperaktivitätsvorkommen. Syndrom heißt, dass es sich um einen Komplex von Symptomen handelt, also um ein sich komplexes Äußern von sogenannten Krankheitszeichen.
Die Kernsymptomatik dieser Störung liegt im exzessiven Vorkommen von Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität und geht oft mit einer daraus resultierenden komorbiden Störung einher.
ADHS gehört zu der häufigsten psychischen Störung im Kindes- und Jugendalter unter 18 Jahren und wird auch mittlerweile häufig diagnostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Diagnose von ADHS
- Erscheinungsbild und Symptome
- Diagnostik und Komorbidität
- Klassifikation nach ICD-10 und DSM IV Kriterien
- Ursachen und Einflußfaktoren von ADHS
- Ätiologie
- Neuroanatomische Faktoren
- Neurochemische Faktoren
- Genetische Faktoren
- Multifaktorelle Entwicklungsfaktoren
- Therapie und Hilfe bei ADHS
- Behandlung
- Psychologische Behandlung
- Pharmakotherapie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema ADHS und versucht, die Ursachen und Einflussfaktoren dieser Störung zu beleuchten. Sie analysiert die Kernsymptome, die Diagnostik und die Klassifikation von ADHS sowie die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit genetische Faktoren eine Rolle bei der Entstehung von ADHS spielen.
- Definition und Diagnose von ADHS
- Ursachen und Einflussfaktoren von ADHS
- Genetische Faktoren bei ADHS
- Therapie und Hilfe bei ADHS
- Kritik an gängigen Erklärungen für ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ADHS ein und stellt die Relevanz der Thematik heraus. Sie beleuchtet die gängigen Vorurteile und Missverständnisse, die mit ADHS verbunden sind, und verdeutlicht die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Störung.
Kapitel 2 definiert ADHS und beschreibt die Kernsymptome der Störung. Es werden die verschiedenen Erscheinungsformen von ADHS erläutert, sowie die Diagnostik und die Komorbidität mit anderen Störungen. Die Klassifikation von ADHS nach ICD-10 und DSM IV Kriterien wird ebenfalls dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit den Ursachen und Einflussfaktoren von ADHS. Es werden verschiedene Theorien zur Entstehung der Störung vorgestellt, darunter neuroanatomische, neurochemische und genetische Faktoren. Die Rolle multifaktorieller Entwicklungsfaktoren wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich den Therapie- und Hilfeangeboten für Menschen mit ADHS. Es werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wie die medikamentöse Therapie und die psychologische Behandlung, vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Symptome, Diagnostik, Komorbidität, Ursachen, Einflussfaktoren, Genetik, Neuroanatomie, Neurochemie, Therapie, Behandlung, Psychotherapie, Pharmakotherapie, Kritik, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen
Ist ADHS nur eine Folge falscher Erziehung?
Nein, die Arbeit stellt klar, dass ADHS eine komplexe Störung ist, bei der genetische, neurobiologische und neurochemische Faktoren eine zentrale Rolle spielen.
Was sind die Kernsymptome von ADHS?
Die Symptomatik umfasst ein exzessives Vorkommen von Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität und Impulsivität.
Wie wird ADHS medizinisch klassifiziert?
Die Diagnose erfolgt nach den Kriterien des ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation) oder des DSM-IV (amerikanisches Klassifikationssystem).
Welche Rolle spielen die Gene bei ADHS?
Genetische Faktoren gelten als wesentlicher Bestandteil der Ätiologie, was die Arbeit im Gegensatz zu rein psychosozialen Erklärungsmodellen hervorhebt.
Welche Behandlungsmöglichkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert sowohl psychologische Behandlungsansätze als auch die Pharmakotherapie (medikamentöse Behandlung).
- Arbeit zitieren
- Marie Schröter (Autor:in), 2012, ADHS. Alles eine Frage der Gene?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280346