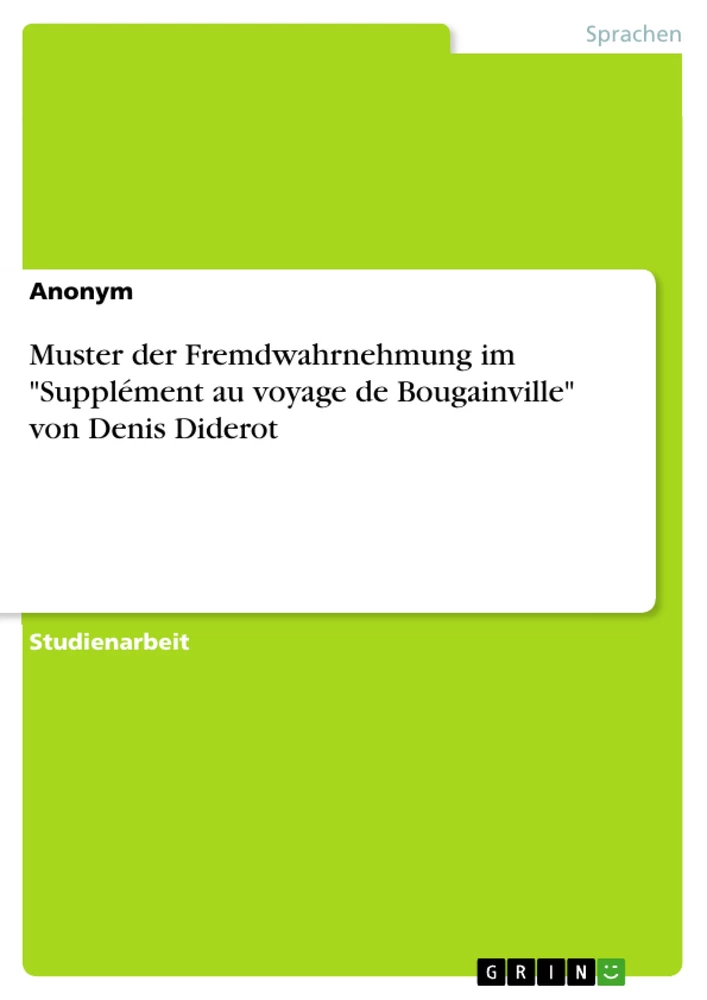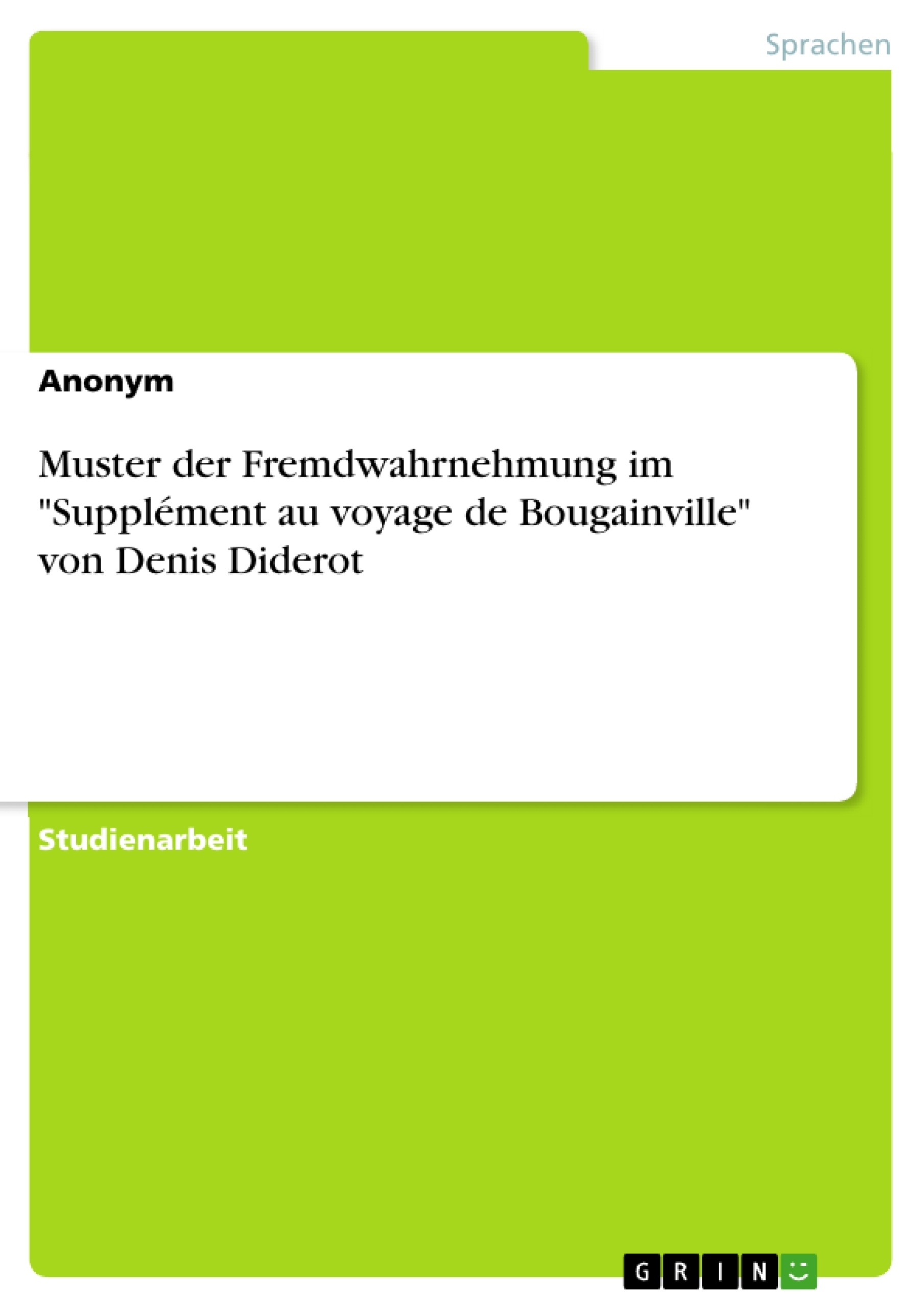1798, vor mehr als zweihundert Jahren, wurde Denis Diderots Supplément au voyage de Bougainville veröffentlicht. Bougainville, der Verfasser des authentischen Reiseberichts auf den Diderot sich bezieht, strebte danach, das Tahiti, das er auf seiner Weltumsegelung kennengelernt hatte, zu beschreiben und in die Debatte um die Existenz des Naturzustandes einzubringen. Diderot fokussierte sich auf genau diese ideologische Debatte und den damit verbundenen Diskurs und deckte die darin formulierten Wahrnehmungsmuster der Identität und der Alterität auf. Warum beschäftigt uns dieses Werk Diderots nachhaltig?
Die Begegnung mit fremden Kulturen war für Diderots Zeitgenossen ein außergewöhnliches und spektakuläres Erlebnis, dass sich im Rahmen von Forschungsexpeditionen und im Kontext eines imperialistischen Expansionsstrebens ereignete. Heute haftet der Begegnung mit fremden Kulturen kaum noch etwas Ungewöhnliches oder Exotisches an. Europa ist geprägt durch eine hohe Mobilität und Immigrationsprozesse. Die Begegnung mit anderen Kulturen ist ein Teil unseres Alltags, doch die von Diderot beschriebenen Wahrnehmungsmuster lassen sich heute genauso wie früher erkennen. So ist die Frage, wie man mit dem Fremden umgehen soll, noch immer aktuell. Vorurteile und Stereotype beeinflussen vordergründig unsere Wahrnehmung. Die Staatsräson und unsere Ethik fordern das Ideal einer toleranten und offenen Gesellschaft. In der konkreten Begegnung mit Vertretern anderer Kulturen stellt sich die Umsetzung dieser Wertvorstellung aber als sehr komplex und konfliktreich dar. Sie ist Gegenstand wiederkehrender Diskussionen und Grundsatzerklärungen. Unsere Gesellschaft und unsere Ethik und Moral müssen sich daran messen lassen, wie sie mit dem Fremden umgehen. Immer schwieriger ist es, die eigene Identität zu definieren. Rufe nach einer Leitkultur werden laut und die Angst vor Überfremdung äußert sich gewalttätig wie zuletzt in den sog. Dönermorden. Die folgende Arbeit untersucht, wie es Diderot gelingt in seinem Text einen konstruktiven Umgang mit dem Fremden aufzuzeigen, der das Selbstbild beeinflussen und das Konzept von Identität bereichern und vorantreiben kann. Anhand der vier Kapitel des Suppléments sollen die Methode und die Thesen dieses Erkenntnisfindungsprozesses nachvollzogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die Begegnung mit dem Fremden als Herausforderung für die Identität
- - Historischer Rückblick – Diderot in der Tradition von Montaigne und Rousseau...
- Entstehungskontext und Aufbau des Suppléments
- Jugement au voyage de Bougainville.
- Les Adieux du vieillard.
- L'entretien de l'aumônier et d' Orou...
- Suite du dialogue entre A et B
- Dialektik als Methode der Reflexion über Identität und Alterität..
- Bibliographie...........
- Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Denis Diderots Supplément au voyage de Bougainville und analysiert die darin dargestellten Muster der Fremdwahrnehmung. Ziel ist es, Diderots Methode der Reflexion über Identität und Alterität anhand der Dialektik im Text zu beleuchten und seine Kritik an den gängigen Wahrnehmungsmustern seiner Zeit aufzuzeigen.
- Die Begegnung mit dem Fremden als Herausforderung für die eigene Identität
- Die Rolle der Dialektik in Diderots Analyse der Fremdwahrnehmung
- Die Kritik an ethnozentrischen und primitivistischen Sichtweisen
- Die Bedeutung von Toleranz und Offenheit im Umgang mit dem Fremden
- Die Relevanz von Diderots Werk für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Begegnung mit dem Fremden als Herausforderung für die eigene Identität. Es wird die historische Entwicklung der Fremdwahrnehmung im Kontext der europäischen Expansion und die damit verbundenen Wahrnehmungsmuster wie Ethnozentrismus und Primitivismus dargestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich Diderots Positionierung in der Tradition von Montaigne und Rousseau. Es werden die zentralen Thesen und Argumente dieser beiden Denker im Hinblick auf die Fremdwahrnehmung und die Kritik an der eigenen Gesellschaft beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert den Entstehungskontext und den Aufbau des Suppléments. Es wird die Rolle des Reiseberichts als literarisches Medium und die Bedeutung der Aufklärung für die Auseinandersetzung mit kultureller Eigenheit und Fremdheit untersucht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Jugement au voyage de Bougainville. Es werden die zentralen Argumente und Thesen Diderots im Hinblick auf die Kritik an der europäischen Kolonialisierung und die Notwendigkeit einer toleranten und offenen Gesellschaft dargestellt.
Das fünfte Kapitel analysiert die Les Adieux du vieillard. Es werden die zentralen Argumente und Thesen Diderots im Hinblick auf die Kritik an der europäischen Kolonialisierung und die Notwendigkeit einer toleranten und offenen Gesellschaft dargestellt.
Das sechste Kapitel analysiert L'entretien de l'aumônier et d' Orou. Es werden die zentralen Argumente und Thesen Diderots im Hinblick auf die Kritik an der europäischen Kolonialisierung und die Notwendigkeit einer toleranten und offenen Gesellschaft dargestellt.
Das siebte Kapitel analysiert Suite du dialogue entre A et B. Es werden die zentralen Argumente und Thesen Diderots im Hinblick auf die Kritik an der europäischen Kolonialisierung und die Notwendigkeit einer toleranten und offenen Gesellschaft dargestellt.
Das achte Kapitel analysiert die Dialektik als Methode der Reflexion über Identität und Alterität. Es werden die zentralen Argumente und Thesen Diderots im Hinblick auf die Kritik an der europäischen Kolonialisierung und die Notwendigkeit einer toleranten und offenen Gesellschaft dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fremdwahrnehmung, die Identität, die Alterität, die Dialektik, die Kritik an Ethnozentrismus und Primitivismus, die Toleranz, die Offenheit, die Kolonialisierung, die Aufklärung, die Reiseberichte, die Tradition von Montaigne und Rousseau, das Supplément au voyage de Bougainville, Denis Diderot.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Diderots „Supplément au voyage de Bougainville“?
Es ist eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Reisebericht von Bougainville über Tahiti, die den Naturzustand gegen die europäische Zivilisation abwägt.
Was versteht Diderot unter „Identität“ und „Alterität“?
Identität bezeichnet das Selbstbild der eigenen Kultur (Europa), während Alterität das Bild des „Fremden“ (Tahiti) beschreibt, das oft durch Stereotype verzerrt ist.
Welche Methode nutzt Diderot zur Erkenntnisfindung?
Diderot nutzt die Dialektik in Form von Dialogen (z.B. zwischen A und B oder dem Missionar und Orou), um verschiedene Perspektiven gegenüberzustellen.
Welche Kritik übt Diderot an der Kolonialisierung?
Er kritisiert den Ethnozentrismus und die gewaltsame Aufdrängung europäischer Moralvorstellungen auf fremde Kulturen.
Warum ist das Werk heute noch relevant?
Die beschriebenen Wahrnehmungsmuster des Fremden lassen sich auch in modernen Debatten über Integration, Leitkultur und Toleranz wiederfinden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Muster der Fremdwahrnehmung im "Supplément au voyage de Bougainville" von Denis Diderot, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280390