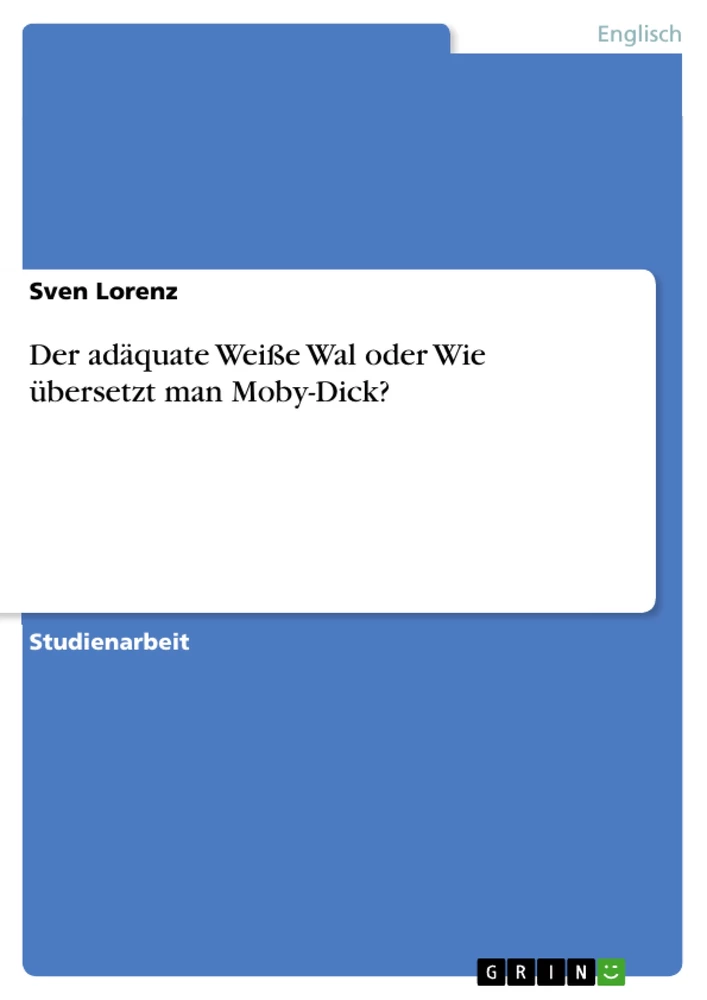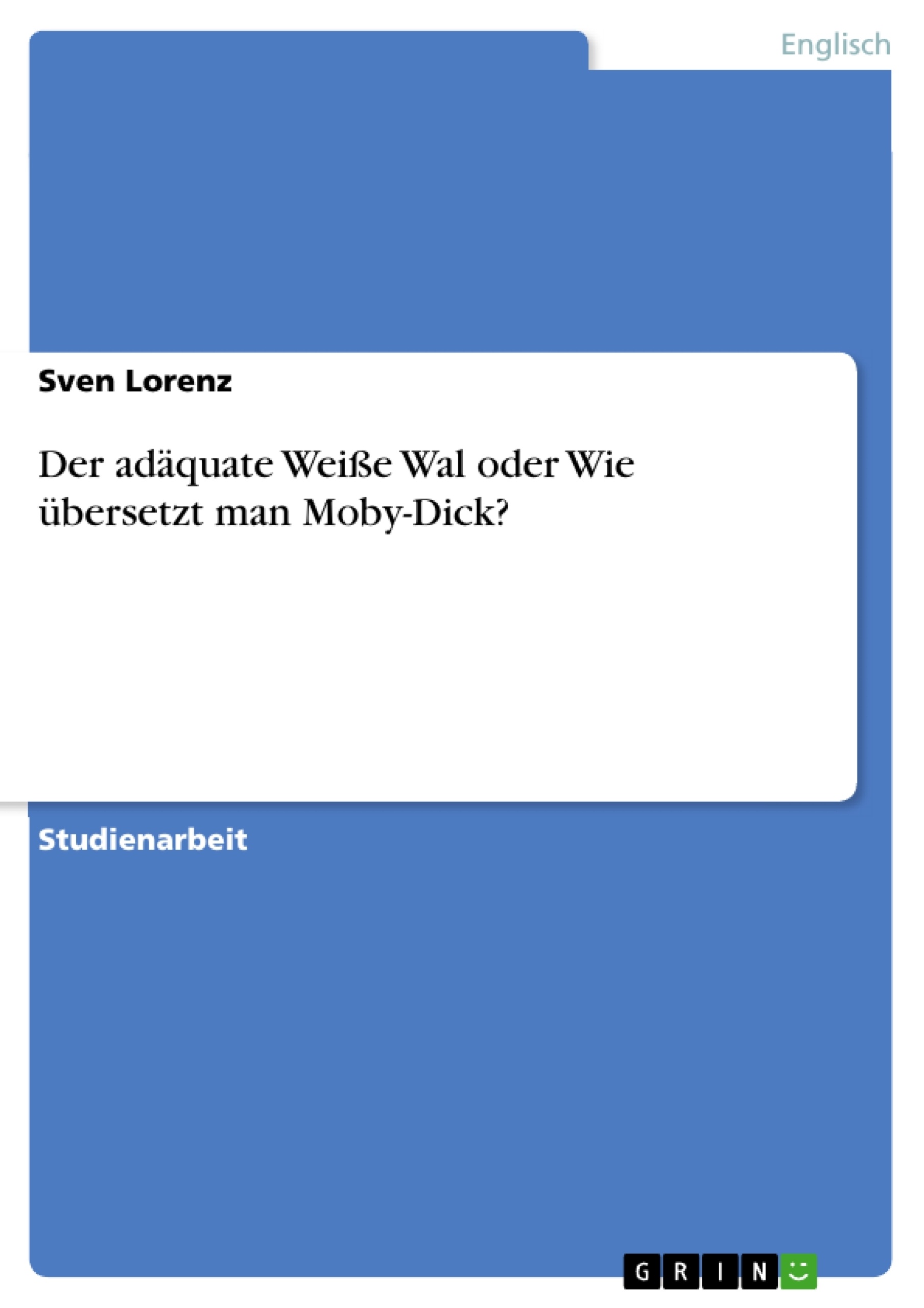Seit 1927 sind acht Übersetzungen von Herman Melvilles Roman „Moby-Dick“ ins Deutsche unternommen worden. Shakespeares Werke werden in der Regel auch heute noch in den Übersetzungen von Schlegel, welche 1797-1801 erschienen sind, gelesen. Was macht also „Moby-Dick“ zu einem Problemfall? Wieso und woran sind diese Übersetzer gescheitert? Denn in der einen oder anderen Form müssen sie alle gescheitert sein – wieso sonst sollten es die Verlage immer wieder für nötig ha lten, neue Übersetzungen in Auftrag zu geben? Den Anstoß zu dieser Arbeit hat mir der Ende 2001, mit der Veröffentlichung einer neuen Übersetzung im Carl-Hanser-Verlag und der Parallelveröffentlichung einer anderen Übersetzung im „Schreibheft“, seinen Höhepunkt erreichenden Streit um die Neuübersetzung von Moby-Dick gegeben. Wie kann es sein das ein Verlag sich weigert eine Neuübersetzung, für die er viel Geld bezahlt hat, zu veröffentlichen? Und wie kann es sein das ein Übersetzer, der viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt hat, seine Übersetzung lieber ganz zurückzieht, als diese von einem anderen Übersetzer überarbeiten zu lassen? Um dies zu klären werde ich in der folgenden Arbeit zunächst sehr kurz versuchen die beiden grundlegenden Begriffe der Übersetzungswissenschaft – Äquivalenz und Adäquatheit – zu definieren, und eine Übersicht über die Techniken der Textübersetzung zu geben.
Dann werde ich die sechs alten Übersetzungen, die zwischen 1927 und 1956 entstanden sind, vorstellen – dies wird leider in den meisten Fällen nur anhand von Sekundärliteratur möglich sein, da es mir nicht möglich war, Ausgaben der sehr alten Übersetzungen zu bekommen. Der Entstehungsgeschichte der beiden Neuübersetzungen werde ich mich dann im nächsten Teil widmen, bevor ich mich dann ausführlich, anhand der im ersten Teil erarbeiteten Grundlagen der Übersetzungswissenschaft, mit ihnen beschäftigen werde. Hier werde ich hauptsächlich Kommentare und Kritiken aus diversen Literaturteilen von Zeitungen und Zeitschriften verwenden. Abschließend werde ich mich dann der Frage, welche der beiden Übersetzungen die bessere ist, widmen – oder besser gesagt, welche der beiden Übersetzungen äquivalenter oder adäquater ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungstheorie
- Äquivalenz
- Adäquatheit
- Techniken der Textübersetzung
- Die frühen Übersetzungen
- 1927 Wilhelm Strüver
- 1942 – Margarete Möckli von Seggern
- 1944 - Fritz Güttinger
- 1954 Richard Mummendey
- 1946- Thesi Mutzenbecher und Ernst Schnabel
- 1956 Alice und Hans Seiffert
- Schreibheft 37 – Der Anstoß zur Neuübersetzung
- Die Jendis Übersetzung
- Analyse der Übersetzung
- Die Kritik an der Übersetzung
- Die Verteidigung der Übersetzung
- Die Rathjen Übersetzung
- Analyse der Übersetzung
- Die Kritik an der Übersetzung
- Die Verteidigung der Übersetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Übersetzung von Herman Melvilles "Moby-Dick" ins Deutsche anhand der Analyse verschiedener Übersetzungen. Die Arbeit beleuchtet die Gründe für die zahlreichen Neuübersetzungen und analysiert die kontroversen Diskussionen um zwei aktuelle Übersetzungen.
- Definition und Anwendung der Übersetzungskonzepte Äquivalenz und Adäquatheit
- Analyse der frühen Übersetzungen von "Moby-Dick" und deren Stärken und Schwächen
- Vergleichende Betrachtung zweier aktueller Übersetzungen hinsichtlich ihrer Übersetzungsstrategien
- Untersuchung der Kritik und Verteidigung der jeweiligen Übersetzungen
- Bewertung der Äquivalenz und Adäquatheit der analysierten Übersetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Problematik der Übersetzung von Melvilles "Moby-Dick" ins Deutsche dar. Sie begründet die Notwendigkeit der Arbeit durch die zahlreichen Übersetzungen und die damit verbundenen Kontroversen, insbesondere im Hinblick auf zwei aktuelle Übersetzungen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Konzepte der Äquivalenz und Adäquatheit zu definieren und anhand der Analyse verschiedener Übersetzungen zu untersuchen.
Übersetzungstheorie: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Übersetzungswissenschaft, Äquivalenz und Adäquatheit, anhand verschiedener theoretischer Ansätze. Es wird zwischen denotativer, konnotativer und formal-ästhetischer Äquivalenz unterschieden und die Bedeutung der Kontextualisierung im Übersetzungsprozess betont. Die Adäquatheit wird als Angemessenheit der Übersetzung in Bezug auf die Funktion des Ausgangstextes erläutert. Abschließend werden verschiedene Techniken der Textübersetzung vorgestellt, die als Grundlage für die spätere Analyse der Übersetzungen von "Moby-Dick" dienen.
Die frühen Übersetzungen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die frühen deutschen Übersetzungen von "Moby-Dick" (1927-1956). Aufgrund von Schwierigkeiten beim Zugang zu den Originaltexten, stützt sich der Überblick hauptsächlich auf Sekundärliteratur. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Übersetzer, die bereits in diesen frühen Übersetzungen deutlich wurden und auf die spätere Kontroverse um die Neuübersetzungen vorausweisen.
Schreibheft 37 – Der Anstoß zur Neuübersetzung: Dieses Kapitel beschreibt den Streit um die Neuübersetzung von Moby-Dick, der durch die Veröffentlichung einer neuen Übersetzung im Carl-Hanser-Verlag und einer Parallelveröffentlichung im „Schreibheft“ seinen Höhepunkt erreichte. Der Fokus liegt auf den Ursachen und dem Verlauf dieses Streits, der den Anstoß für die vorliegende Arbeit bildet.
Die Jendis Übersetzung: Dieses Kapitel analysiert eine der Neuübersetzungen von "Moby-Dick", die Jendis-Übersetzung. Es werden sowohl die analytischen Aspekte der Übersetzung als auch die Kritik und Verteidigung derselben eingehend betrachtet. Die Analyse zielt darauf ab, die Übersetzungsstrategien und Entscheidungen des Übersetzers zu untersuchen und im Kontext der Übersetzungstheorie zu bewerten.
Die Rathjen Übersetzung: Ähnlich wie das vorherige Kapitel, widmet sich dieses Kapitel der Analyse einer weiteren Neuübersetzung, der Rathjen-Übersetzung. Es untersucht die Übersetzungsstrategien, die Kritik und die Verteidigung dieser Übersetzung und setzt sie in Bezug zu den theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel. Die Zusammenfassung wird den Fokus darauf legen, die Stärken und Schwächen dieser Übersetzung im Vergleich zur Jendis-Übersetzung und den frühen Übersetzungen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Moby-Dick, Herman Melville, Übersetzungswissenschaft, Äquivalenz, Adäquatheit, Textübersetzung, Literaturvergleich, Übersetzungsstrategien, Übersetzungskritik, Neuübersetzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu "Moby-Dick"-Übersetzungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene deutsche Übersetzungen von Herman Melvilles "Moby-Dick", fokussiert auf die Herausforderungen der Übersetzung und die Kontroversen um zwei aktuelle Übersetzungen. Sie untersucht die angewandten Übersetzungsstrategien und bewertet diese anhand der Übersetzungstheorien der Äquivalenz und Adäquatheit.
Welche Übersetzungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl frühe Übersetzungen von "Moby-Dick" (von 1927 bis 1956, u.a. von Wilhelm Strüver, Margarete Möckli von Seggern, Fritz Güttinger, Richard Mummendey, Thesi Mutzenbecher und Ernst Schnabel, Alice und Hans Seiffert) als auch zwei aktuelle Übersetzungen (die Jendis- und die Rathjen-Übersetzung). Der Streit um die Neuübersetzung im Carl-Hanser-Verlag und im "Schreibheft 37" bildet einen zentralen Aspekt.
Welche theoretischen Konzepte werden angewendet?
Die zentralen Konzepte sind Äquivalenz (denotativ, konnotativ, formal-ästhetisch) und Adäquatheit. Die Arbeit definiert diese Begriffe und wendet sie auf die Analyse der verschiedenen Übersetzungen an, um deren Angemessenheit und Genauigkeit zu beurteilen.
Wie werden die Übersetzungen analysiert?
Für jede analysierte Übersetzung wird eine detaillierte Analyse der Übersetzungsstrategien durchgeführt. Die Arbeit berücksichtigt sowohl die Stärken und Schwächen der jeweiligen Übersetzung als auch die Kritik und die Verteidigung, die diese Übersetzungen hervorgerufen haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Übersetzungstheorie (mit den Unterpunkten Äquivalenz, Adäquatheit und Techniken der Textübersetzung), Die frühen Übersetzungen, Schreibheft 37 – Der Anstoß zur Neuübersetzung, Die Jendis Übersetzung (mit Analyse, Kritik und Verteidigung), Die Rathjen Übersetzung (mit Analyse, Kritik und Verteidigung) und Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen bei der Übersetzung von "Moby-Dick" aufzuzeigen, die verschiedenen Übersetzungsansätze zu vergleichen und die Konzepte der Äquivalenz und Adäquatheit anhand konkreter Beispiele zu illustrieren. Sie beleuchtet auch die Gründe für die zahlreichen Neuübersetzungen und die damit verbundenen Kontroversen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Moby-Dick, Herman Melville, Übersetzungswissenschaft, Äquivalenz, Adäquatheit, Textübersetzung, Literaturvergleich, Übersetzungsstrategien, Übersetzungskritik, Neuübersetzung.
- Quote paper
- Sven Lorenz (Author), 2003, Der adäquate Weiße Wal oder Wie übersetzt man Moby-Dick?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28043