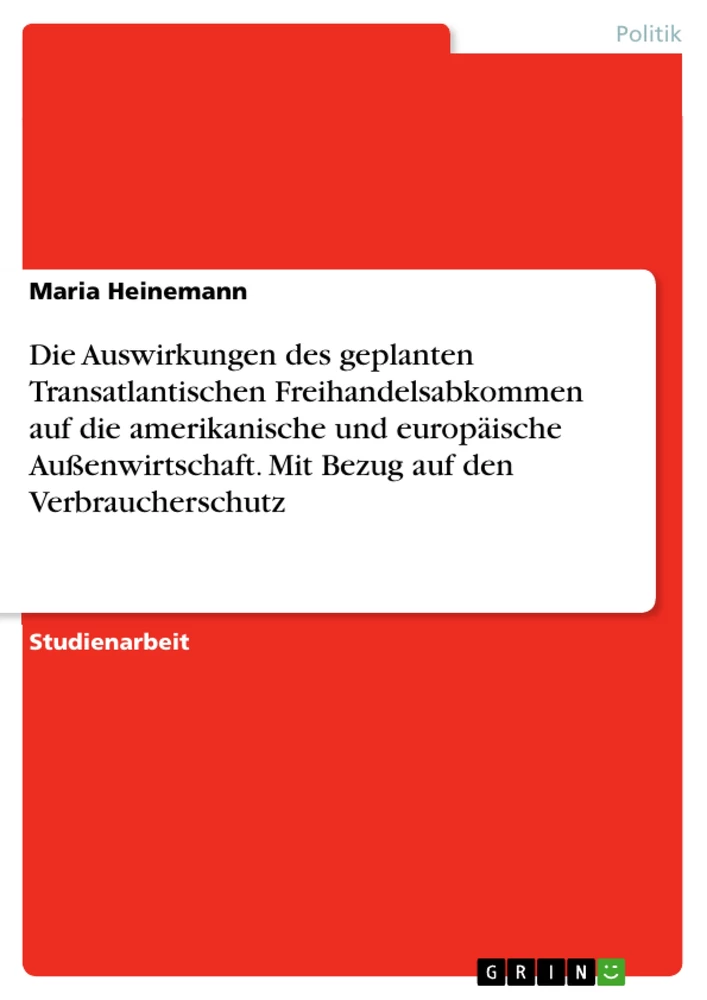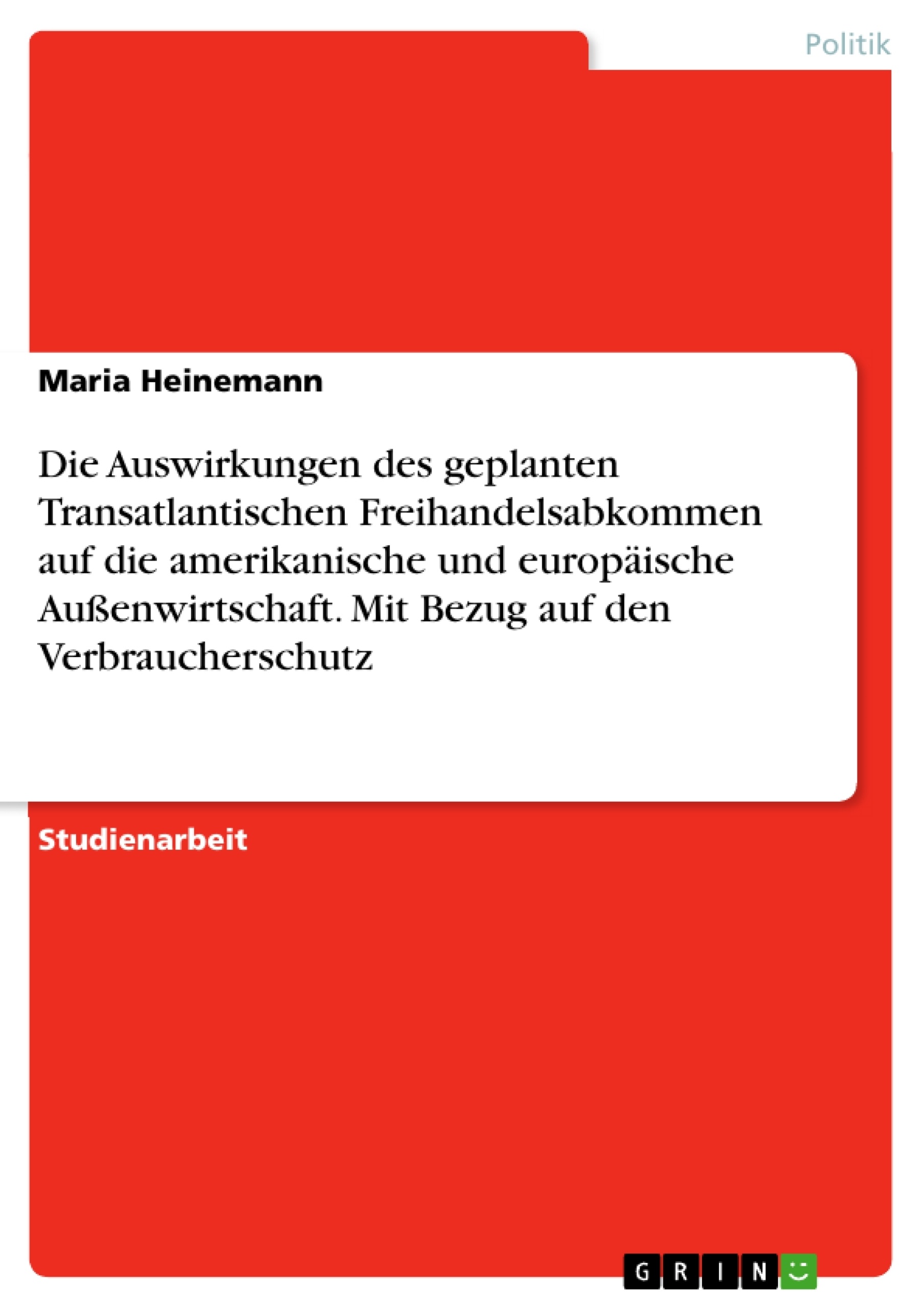Es gibt momentan kaum ein außenwirtschaftliches Thema, dass so kontrovers diskutiert wird, wie die Verhandlungen zu der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union. Viele Studien wurden durchgeführt, noch mehr Berichte geschrieben und mediale Diskussionen inszeniert. Es wurde zu einem der Hauptthemen des Europawahlkampfes der SPD und Schreckgespenst für europäische Verbraucherschützer.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den außenwirtschaftlichen Entwicklungen der Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union. Im Mittelpunkt steht dabei das Transatlantische Freihandelsabkommen, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes genauer betrachtet werden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Außenwirtschaft
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Außenhandelspolitik
- 2.2.1 Ausmaß und Struktur des Handels
- 2.2.2 Wirtschaftliche Integration
- 2.2.2.1 Freihandel und Protektionismus
- 2.2.2.2 Motive
- 2.2.2.3 Die Freihandelszone
- 3 Außenwirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
- 3.1 Die Stellung der USA in der Weltwirtschaft
- 3.1.1 Entwicklung
- 3.1.2 Weltwährungssystem
- 3.1.3 Aktuelle Wirtschaftskraft der USA
- 3.1.4 Multinationale Unternehmen
- 3.2 Wirtschaftliche Integrationspolitik
- 3.2.1 Freihandelsabkommen der USA
- 3.2.1.1 Die Nordamerikanische Freihandelszone
- 3.2.1 Freihandelsabkommen der USA
- 3.1 Die Stellung der USA in der Weltwirtschaft
- 4 Außenwirtschaft der Europäischen Union
- 4.1 Entwicklung
- 4.2 Außenhandelspolitik
- 4.2.1 Autonome Handelspolitik
- 4.2.2 Vertragliche Handelspolitik
- 4.4 Wirtschaftliche Integrationspolitik
- 4.4.1 Bestehende Handelsabkommen
- 5 Das Transatlantische Freihandelsabkommen
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Die Handelspartnerschaft zwischen den USA und der EU
- 5.3 Das Abkommen
- 5.3.1 Die Verhandlungen
- 5.3.2 Kritik
- 5.3.3 Verbraucherschutz und TTIP
- 5.3.3.1 Hintergrund
- 5.3.3.2 Die Problematik des Chlorhühnchens
- 5.3.3.3 US-amerikanischer Verbraucherschutz als Vorbild
- 6 Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Außenwirtschaft der USA und der EU im Hinblick auf das geplante Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) mit besonderem Fokus auf den Verbraucherschutz. Ziel ist es, die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für TTIP zu beleuchten und die Auswirkungen des Abkommens auf den Verbraucherschutz in beiden Regionen zu untersuchen.
- Die Bedeutung des Freihandels für die Weltwirtschaft
- Die Rolle von Verbraucherschutz in der Außenhandelspolitik
- Die Herausforderungen und Chancen des TTIP für die USA und die EU
- Die Auswirkungen des TTIP auf den Verbraucherschutz in beiden Regionen
- Die Bedeutung von Transparenz und öffentlicher Beteiligung bei der Gestaltung von Freihandelsabkommen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) ein und erläutert die Relevanz des Themas für die Außenwirtschaft der USA und der EU.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Außenwirtschaft und den verschiedenen Aspekten der Außenhandelspolitik. Es werden die Motive für wirtschaftliche Integration und die verschiedenen Formen des Freihandels beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Außenwirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Es werden die Stellung der USA in der Weltwirtschaft, die Entwicklung des Weltwährungssystems und die aktuelle Wirtschaftskraft der USA betrachtet. Darüber hinaus werden die wichtigsten Freihandelsabkommen der USA, insbesondere die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA), vorgestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit der Außenwirtschaft der Europäischen Union. Es werden die Entwicklung der EU-Außenhandelspolitik, die verschiedenen Formen der Handelspolitik und die wichtigsten bestehenden Handelsabkommen der EU beleuchtet.
Kapitel 5 analysiert das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) im Detail. Es werden die Handelspartnerschaft zwischen den USA und der EU, die Verhandlungen über TTIP und die Kritik an dem Abkommen beleuchtet. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen des TTIP auf den Verbraucherschutz in beiden Regionen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP), die Außenwirtschaft der USA und der EU, Verbraucherschutz, Freihandel, Protektionismus, wirtschaftliche Integration, Chlorhühnchen, Handelspolitik, Weltwährungssystem, NAFTA, WTO, EU-Außenhandelspolitik, und die Bedeutung von Transparenz und öffentlicher Beteiligung bei der Gestaltung von Freihandelsabkommen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das TTIP-Abkommen?
TTIP steht für die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU.
Warum ist TTIP für den Verbraucherschutz umstritten?
Verbraucherschützer befürchten eine Aufweichung europäischer Standards, symbolisiert durch die Diskussion um das sogenannte "Chlorhühnchen".
Welche Rolle spielen Freihandel und Protektionismus in der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Motive für wirtschaftliche Integration und stellt die Konzepte von Freihandelszonen gegenüber protektionistischen Maßnahmen dar.
Gibt es Vorbilder für TTIP in den USA?
Ja, die Arbeit zieht Vergleiche zur Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) und untersucht die US-amerikanische Außenwirtschaftsentwicklung.
Was sind die Hauptkritikpunkte an den TTIP-Verhandlungen?
Kritisiert werden vor allem mangelnde Transparenz, die Bedrohung von Umwelt- und Sozialstandards sowie der Einfluss multinationaler Unternehmen.
- Quote paper
- Maria Heinemann (Author), 2014, Die Auswirkungen des geplanten Transatlantischen Freihandelsabkommen auf die amerikanische und europäische Außenwirtschaft. Mit Bezug auf den Verbraucherschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280490