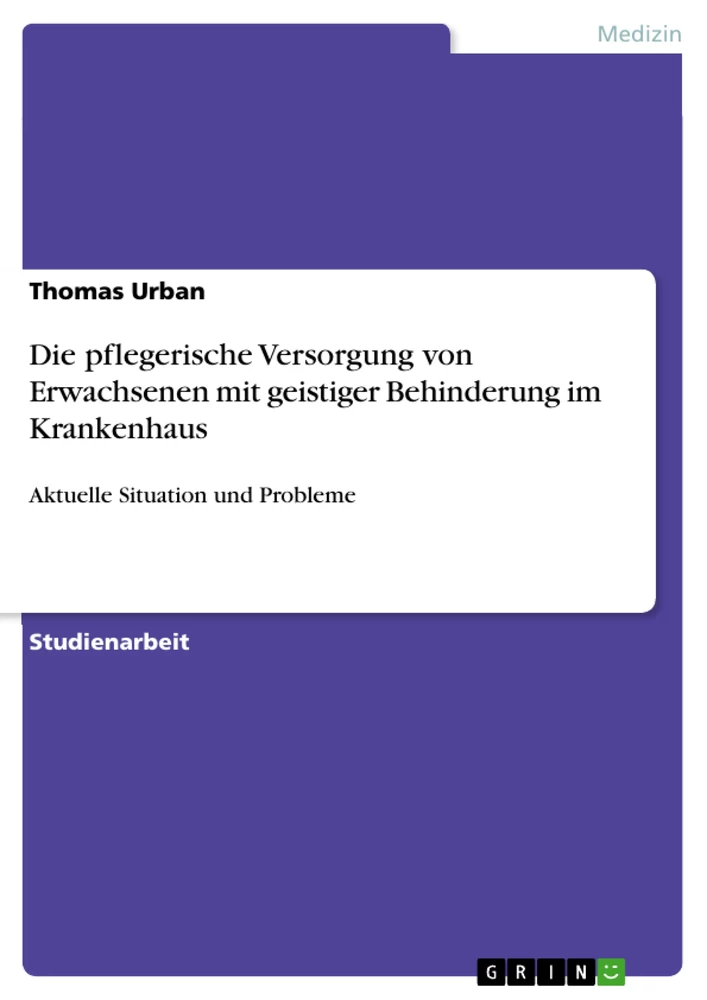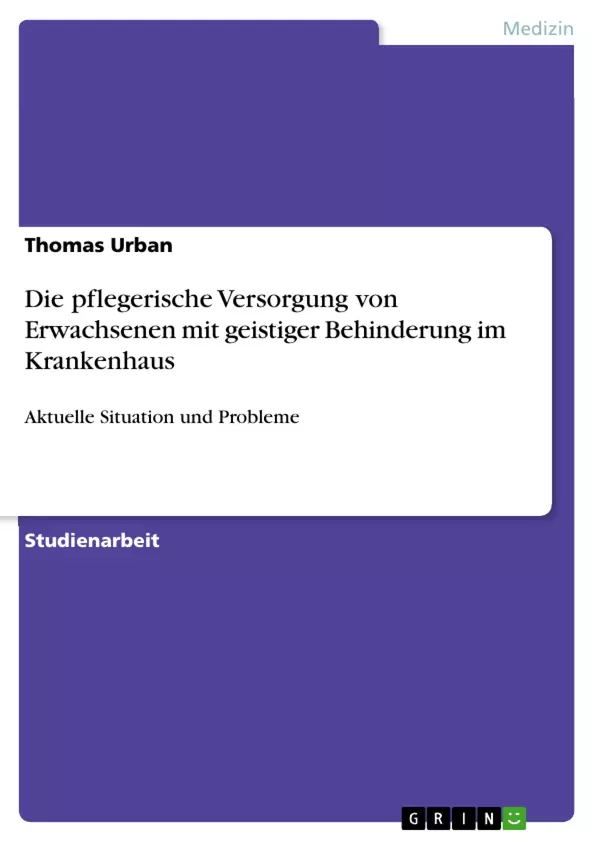In zahlreichen Publikationen der letzten Jahre wurden Defizite in der medizinischen Versorgung von geistig oder mehrfach behinderten Menschen, in der Bundesrepublik Deutschland, beschrieben. Überdies fanden verschiedene Fachtagungen bezüglich dieser Thematik statt. Viele Betroffene, Angehörige, Ärzte und Fachverbände der Behindertenhilfe beklagen die aktuelle Situation von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung hinsichtlich der medizinischen, aber auch pflegerischen Versorgung in Akutkrankenhäusern, mit teils drastischen Formulierungen. So sprach beispielsweise Prof. Dr. Michael Seidel, ärztlicher Direktor des Stiftungsbereichs Bethel.regional, in diesem Zusammenhang von einem „gesundheitspolitischen Skandal“ ) und prangerte unter anderem „erhebliche Pflegemängel“ ) an. Dr. Kai Harenski vom Universtitätsklinikum Regensburg behauptete, geistig behinderte Menschen seien im Krankenhaus „Alles andere als Wunschpatienten“ ). Infolge der öffentlichen Diskussion wurden mehrfach verschiedene Forderungen ) gestellt, mit der Intention, die derzeitige Situation dieser Patientengruppe zu verbessern. Dabei muss berücksichtigt werden, dass, sollte die Versorgung geistig behinderter Menschen in deutschen Krankenhäusern, im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung, tatsächlich deutliche Mängel aufweisen, nicht nur aus ethischen Beweggründen heraus Handlungsbedarf besteht, sondern auch ein Verstoß gegen bestehendes Recht in Deutschland vorliegt. )
Im Folgenden wird die aktuelle Situation von Menschen mit geistigen Behinderungen in Akutkrankenhäusern hinsichtlich ihrer pflegerischen Versorgung dargestellt und die sich hierbei eröffnenden Probleme, sowohl aus Sicht der Patienten als auch aus Sicht der Pflegenden, weiter erörtert. Aufgrund des vorgegebenen Umfangs der Hausarbeit werden nicht alle, sondern nur die schwerwiegendsten Problemfelder behandelt. Eine eigene Datenerhebung, die aufgrund der doch begrenzten Datenlage bezüglich der konkreten Fragestellung eingangs sinnvoll erschien, war angesichts des zeitlichen Rahmens nicht realisierbar. Infolgedessen wurden anhand von Studien und Expertenmeinungen verschiedene Probleme bezüglich der stationären Versorgung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Krankenhaus herausgearbeitet, zu denen weitere Literaturrecherchen durchgeführt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung und Vorgehensweise
- 1.2 Geistige Behinderung
- 1.2.1 Die Bezeichnung geistige Behinderung und ihre Definition
- 1.2.2 Klassifikation und Epidemiologie
- 1.3 Rechtliche Grundlagen
- 1.3.1 Das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe
- 1.3.2 Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus
- 2. Analyse der aktuellen Situation und Problematik
- 2.1 Stationäre Aufnahme
- 2.1.1 Zugang zur Versorgung und Persönliche Assistenz im Akutkrankenhaus
- 2.1.2 Emotionale Situation des Patienten – Unsicherheit und Angst
- 2.1.3 Pflegeanamnese und individueller Hilfebedarf
- 2.2 Betreuung und Pflege während des stationären Aufenthaltes
- 2.2.1 Kommunikation und Interaktion
- 2.2.2 Verhaltensauffälligkeiten
- 2.2.3 Kommunikation
- 2.2.4 Aus- und Fortbildung
- 2.3 Die stationäre Entlassung
- 2.3.1 Entlass-Management
- 2.3.2 Aufwandsgerechte Vergütung
- 3. Ergebnisse und Ausblick
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der pflegerischen Versorgung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus. Sie analysiert die aktuelle Situation und die damit verbundenen Probleme aus der Perspektive der Patienten und der Pflegenden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen und Defizite in der Versorgung dieser Patientengruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze zu diskutieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen und die Bedeutung des Rechts auf Selbstbestimmung und Teilhabe
- Zugang zur Versorgung und die Rolle der Persönlichen Assistenz im Akutkrankenhaus
- Emotionale Bedürfnisse und Herausforderungen in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung
- Sicherung der individuellen Pflege und die Bedeutung der Pflegeanamnese
- Herausforderungen in der Entlassungsplanung und die Notwendigkeit einer aufwandsgerechten Vergütung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Vorgehensweise der Hausarbeit dar. Sie beleuchtet die aktuelle Situation der pflegerischen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus und die damit verbundenen Defizite. Der Begriff der geistigen Behinderung wird definiert und die rechtlichen Grundlagen der Versorgung werden erläutert.
Kapitel 2 analysiert die aktuelle Situation und die Problematik der pflegerischen Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus. Es werden die Herausforderungen bei der stationären Aufnahme, der Betreuung und Pflege während des stationären Aufenthaltes sowie bei der Entlassung beleuchtet. Die Kapitel 2.1 bis 2.3 gehen detailliert auf die einzelnen Phasen des Krankenhausaufenthaltes ein und beleuchten die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, die mit der Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die pflegerische Versorgung, Menschen mit geistiger Behinderung, Krankenhaus, Akutkrankenhaus, Selbstbestimmung, Teilhabe, Assistenzpflege, Kommunikation, Verhaltensauffälligkeiten, Entlassungsplanung, Vergütung, Rechtliche Rahmenbedingungen, Herausforderungen, Defizite, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Welche Probleme gibt es bei der Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus?
Häufig beklagt werden Kommunikationsbarrieren, mangelnde Zeit des Pflegepersonals für individuelle Bedürfnisse sowie unzureichende Vorbereitung auf Verhaltensauffälligkeiten.
Was ist die Aufgabe der "Persönlichen Assistenz" im Krankenhaus?
Persönliche Assistenten begleiten Menschen mit Behinderung, um Unsicherheit und Angst abzubauen und die Kommunikation zwischen Patienten und medizinischem Personal zu unterstützen.
Welche rechtlichen Grundlagen sichern die Teilhabe im Krankenhaus?
Neben dem allgemeinen Recht auf Selbstbestimmung gibt es spezifische Gesetze zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs, die sicherstellen sollen, dass notwendige Begleitpersonen finanziert werden.
Warum ist das Entlass-Management für diese Patientengruppe besonders kritisch?
Eine sorgfältige Planung ist nötig, um den Übergang zurück in die Wohneinrichtung oder die häusliche Pflege sicherzustellen und Brüche in der Versorgung zu vermeiden.
Was wird unter einer "aufwandsgerechten Vergütung" verstanden?
Es ist die Forderung, dass Krankenhäuser für den erhöhten pflegerischen und zeitlichen Aufwand bei Patienten mit Behinderung finanziell besser entschädigt werden.
- Quote paper
- Thomas Urban (Author), 2014, Die pflegerische Versorgung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280580