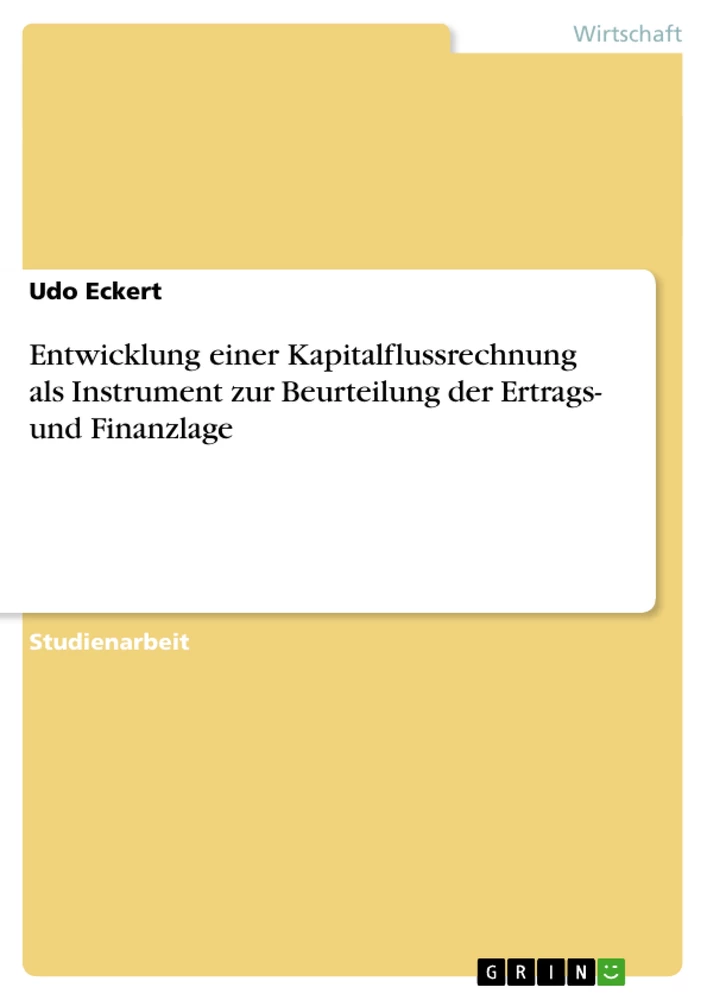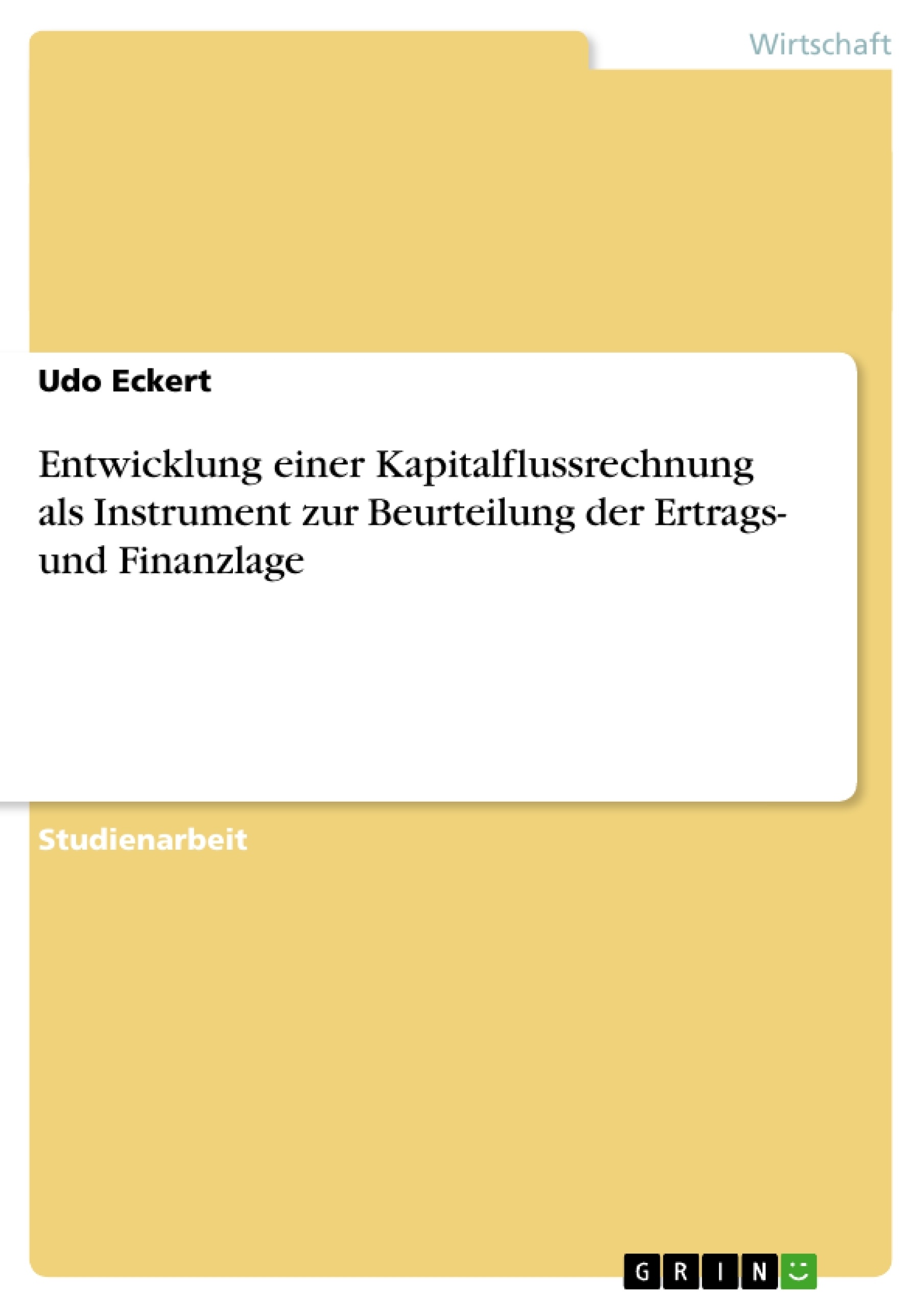Erfordernisse zur Darstellung einer Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnungen (KFR) gewinnen - auch vor dem Hintergrund der Ratinganforderungen - zunehmend an Bedeutung. Sie sind nicht nur für Finanzanalysten, Banken und Kapitalanleger, sondern auch für die Geschäftsleitung des Unter- nehmens ein wichtiges Entscheidungsinstrument. In der Wirtschaftspresse und der Öffentlichkeit wird in diesem Zusammenhang häufig das Schlagwort „Cash is King“ verwendet. Unternehmen können oft nicht hinreichend an ihrer Gewinn- bzw. Verlustsituation beurteilt werden, denn insbesondere Wachstumsunternehmen sind häufig durch Liquiditätsengpässe gefährdet. Der Gewinn als Erfolgsmaßstab wird in diesem Zusammenhang zu- nehmend kritisiert, denn er stellt keine erwirtschaftete Liquidität im eigentlichen Sinne dar. Er kann durch entsprechende bilanzpolitische Maßnahmen manipuliert werden.
Investoren und Kreditgebern kommt es für die Bewertung der finanziellen Verhältnisse des Unternehmens auf die Kenntnis an, ob und inwieweit das Unternehmen Geldmittel generierte und wie diese investiert wurden. Nur so kann eingeschätzt werden, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen könnte und welchen Risiken sie gegenübersteht. Im Rahmen der Kreditprüfung durch Banken und anderen Geldgebern ist die KFR ein zunehmend eingesetztes Instrument. Einerseits für die Vergabe von neuen Fremdmitteln durch Banken, andererseits um bei Herstellern und Lieferanten entsprechende Kredite und Zahlungsziele zu erhalten (vgl. FRANKE 1987, 157). Zu klären ist die Frage, ob das Unternehmen im Rahmen seiner Selbstfinanzierungskraft den Kapitaldienst nachhaltig bedienen kann (vgl. FINGERHUT 1991, 75).
Neben der Gewinnerzielungsabsicht eines Unternehmens folgt zwangsläufig die dauernde Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts. Dass dies nicht unbedingt als Nebenbedingung anzusehen ist, beweist die hohe Anzahl an Insolvenzen der Vergangenheit. Diese entstanden nicht nur wegen Überschuldung oder fehlender Gewinne, sondern vielmehr aus der Tatsache, dass eine plötzlich auftretende Illiquidität zur Zahlungsunfähigkeit führte. Die Ertrags- und Finanzlage steht in einem engen Zusammenhang. Wer über Jahre hinweg eine schlechte Ertragslage vorweist (negativer operativer Cash Flow), ist zunehmend auf Fremd- bzw. Eigenkapitalzuführung angewiesen, um seine Investitionen durchführen zu können.
....
Inhaltsverzeichnis
- Erfordernisse zur Darstellung einer Kapitalflussrechnung
- Grundlagen der Kapitalflussrechnung
- Aufgaben und Anforderungen
- Ziele und Anwendungsbereiche
- Darstellungs- und Ermittlungsmethoden der Kapitalflussrechnung
- Darstellungsmethoden der Kapitalflussrechnung
- Direkte Methode
- Indirekte Methode
- Ermittlungsmethoden der Kapitalflussrechnung
- Originäre Ermittlung
- Derivative Ermittlung
- Beständedifferenzenbilanz
- Veränderungsbilanz
- Bewegungsbilanz
- Integration der Kontenumsätze der Bilanz
- Integration der Aufwendungen und Erträge der GuV
- Kapitalflussrechnung
- Darstellungsmethoden der Kapitalflussrechnung
- Aussagefähigkeit von Kapitalflussrechnungen
- Cash Flow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
- Cash Flow aus der Investitionstätigkeit
- Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
- Grenzen der Aussagefähigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Kapitalflussrechnung als Instrument zur Beurteilung der Ertrags- und Finanzlage eines Unternehmens. Dabei wird auf die grundlegenden Aufgaben und Anforderungen der Kapitalflussrechnung eingegangen sowie verschiedene Darstellungs- und Ermittlungsmethoden vorgestellt. Die Arbeit analysiert die Aussagefähigkeit der Kapitalflussrechnung in Bezug auf die verschiedenen Cashflows und beleuchtet die Grenzen der Aussagefähigkeit dieser Methode.
- Grundlagen und Bedeutung der Kapitalflussrechnung
- Darstellungs- und Ermittlungsmethoden der Kapitalflussrechnung
- Aussagefähigkeit der Kapitalflussrechnung für die Analyse der Ertrags- und Finanzlage
- Grenzen der Aussagefähigkeit der Kapitalflussrechnung
- Praxisrelevanz und Anwendung der Kapitalflussrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Erfordernisse zur Darstellung einer Kapitalflussrechnung. Hier werden die wichtigsten Gründe für die Notwendigkeit einer Kapitalflussrechnung dargelegt, insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung der Ertrags- und Finanzlage eines Unternehmens. Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen der Kapitalflussrechnung. Es werden die Aufgaben und Anforderungen der Kapitalflussrechnung erläutert, sowie die Ziele und Anwendungsbereiche der Methode beleuchtet. Kapitel 3 behandelt verschiedene Darstellungs- und Ermittlungsmethoden der Kapitalflussrechnung. Es werden die direkte und indirekte Methode sowie verschiedene derivative Ermittlungsmethoden wie Beständedifferenzenbilanz, Veränderungsbilanz und Bewegungsbilanz vorgestellt. Kapitel 4 analysiert die Aussagefähigkeit der Kapitalflussrechnung in Bezug auf die drei verschiedenen Cashflows aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Es wird gezeigt, wie die Kapitalflussrechnung zur Beurteilung der Liquidität, Rentabilität und Finanzierungsstruktur eines Unternehmens beitragen kann. Im letzten Kapitel werden die Grenzen der Aussagefähigkeit der Kapitalflussrechnung betrachtet. Es werden verschiedene Faktoren diskutiert, die die Aussagekraft der Kapitalflussrechnung einschränken können, wie zum Beispiel die Schwierigkeit der Prognose zukünftiger Cashflows oder die Möglichkeit der Manipulation der Kapitalflussrechnung. Die Arbeit zeigt auf, dass die Kapitalflussrechnung ein wichtiges Instrument zur Analyse der Ertrags- und Finanzlage eines Unternehmens ist, aber auch ihre Grenzen und Schwächen erkannt werden müssen.
Schlüsselwörter
Kapitalflussrechnung, Cash Flow, Ertragslage, Finanzlage, Liquidität, Rentabilität, Finanzierungsstruktur, direkte Methode, indirekte Methode, Beständedifferenzenbilanz, Veränderungsbilanz, Bewegungsbilanz, Analyse, Beurteilung, Grenzen der Aussagefähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Kapitalflussrechnung (KFR) so wichtig?
Sie dient als Instrument zur Beurteilung der Liquidität, da der reine Bilanzgewinn manipuliert werden kann und keine Auskunft über die tatsächlich verfügbaren Geldmittel gibt.
Was bedeutet der Slogan "Cash is King"?
Er verdeutlicht, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) wichtiger für das Überleben eines Unternehmens ist als der rein buchhalterische Gewinn.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Methode?
Die direkte Methode stellt Ein- und Auszahlungen direkt gegenüber, während die indirekte Methode den Cashflow vom Jahresüberschuss durch Korrekturen ableitet.
Welche Cashflow-Arten werden unterschieden?
Man unterscheidet den Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.
Wo liegen die Grenzen der Kapitalflussrechnung?
Grenzen liegen in der Schwierigkeit der Prognose künftiger Cashflows und der Tatsache, dass sie nur vergangenheitsbezogene Daten abbildet.
- Quote paper
- Udo Eckert (Author), 2004, Entwicklung einer Kapitalflussrechnung als Instrument zur Beurteilung der Ertrags- und Finanzlage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28065