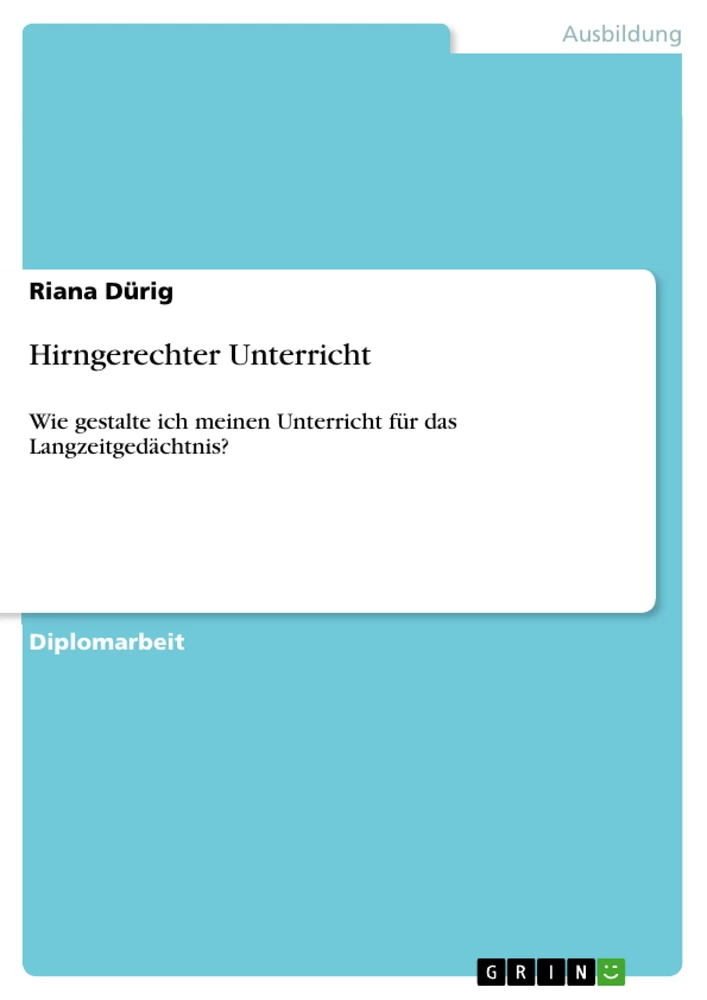Lernen hängt von vielen Faktoren ab. So sind hierfür nicht nur vielfältige Unterrichtsmethoden, Abwechslung der Sozialformen bei Arbeitsaufträgen oder die Fachkompetenz der Lehrperson dafür notwendig, sondern auch die Motivation der Lernenden, das Interesse und der Leistungswille. Um zu wissen, wie ich als Lehrperson diese Faktoren optimieren kann, muss ich über entsprechendes Grundwissen verfügen. Denn gemäß Gasser (2008, S. 12) beruhen alle mentalen (psychischen, geistigen, kognitiven, emotionalen …) Prozesse und Zustände auf Hirnprozessen. Der Mensch lernt immer. Oftmals laufen Lernprozesse automatisch und intuitiv ab. Das Gehirn arbeitet dabei eigenständig und beurteilt, welche Informationen wichtig sind und welche nicht. Manchmal genügt für einen bleibenden Lernerfolg ein einzelner Moment – jedes Kind fasst nur einmal auf eine heisse Herdplatte –, meist benötigt es für eine Abspeicherung im Langzeitgedächtnis jedoch viel Übung und Repetition.
In dieser Arbeit setze ich mich mit den Grundlagen der Hirnforschung und der Neurodidaktik auseinander, welche ich als speziell wichtige Grundlagen für den Lernerfolg in meinem Unterricht ansehe. Weiter werden Massnahmen, die zu hirngerechtem Unterricht führen, in dieser Arbeit erläutert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Fragestellung
2 Das menschliche Gehirn
2.1 Areale des Gehirns
2.1.1 Das Grosshirn (Cerebrum)
2.1.2 Präfrontalhirnrinde
2.1.3 Das limbische System (Archicortex, Paleocortex)
2.1.4 Das Zwischenhirn (Diencephalon)
2.1.5 Das Kleinhirn (Cerebellum)
2.1.6 Das Mittelhirn (Mesencephalon)
2.1.7 Das Stammhirn (Hirnstamm)
2.2 Landkarte des menschlichen Gehirns
2.3 Neuronen
3 Der Begriff „Neuro“ kurz erklärt
3.1 Neuropsychologie
3.2 Neurodidaktik
4 Zuständige Hirnareale für das Lernen
4.1 Das limbische System – „Hauptkontrolleur des Lernerfolges“
4.1.1 Cingulärer Cortex
4.1.2 Das mesolimbische System
4.1.3 Amygdala (Mandelkern)
4.1.4 Hippocampus
5 Hirngerechter Unterricht
5.1 Was bedeutet Lernen aus Sicht des Gehirns?
5.1.1 Das Gedächtnis unterteilt in seine Funktionen
5.1.2 Plastizität
5.2 Berücksichtigung des limbischen Systems beim Lernen – Ein Idealbild
5.3 Was ist hirngerechter Unterricht?
6 Das Hirn in der Adoleszenz
7 Didaktische Massnahmen
7.1 Massnahme 1 – Gedächtnisformen
7.2 Massnahme 2 – Arbeitsatmosphäre
7.3 Massnahme 3 – Anspannung und Entspannung
7.4 Massnahme 4 – Sachzusammenhänge in Strukturen
7.5 Massnahme 5 – Rückmeldungen zu Leistungsergebnissen
8 Fazit
9 Literaturverzeichnis
10 Abbildungsverzeichnis
-
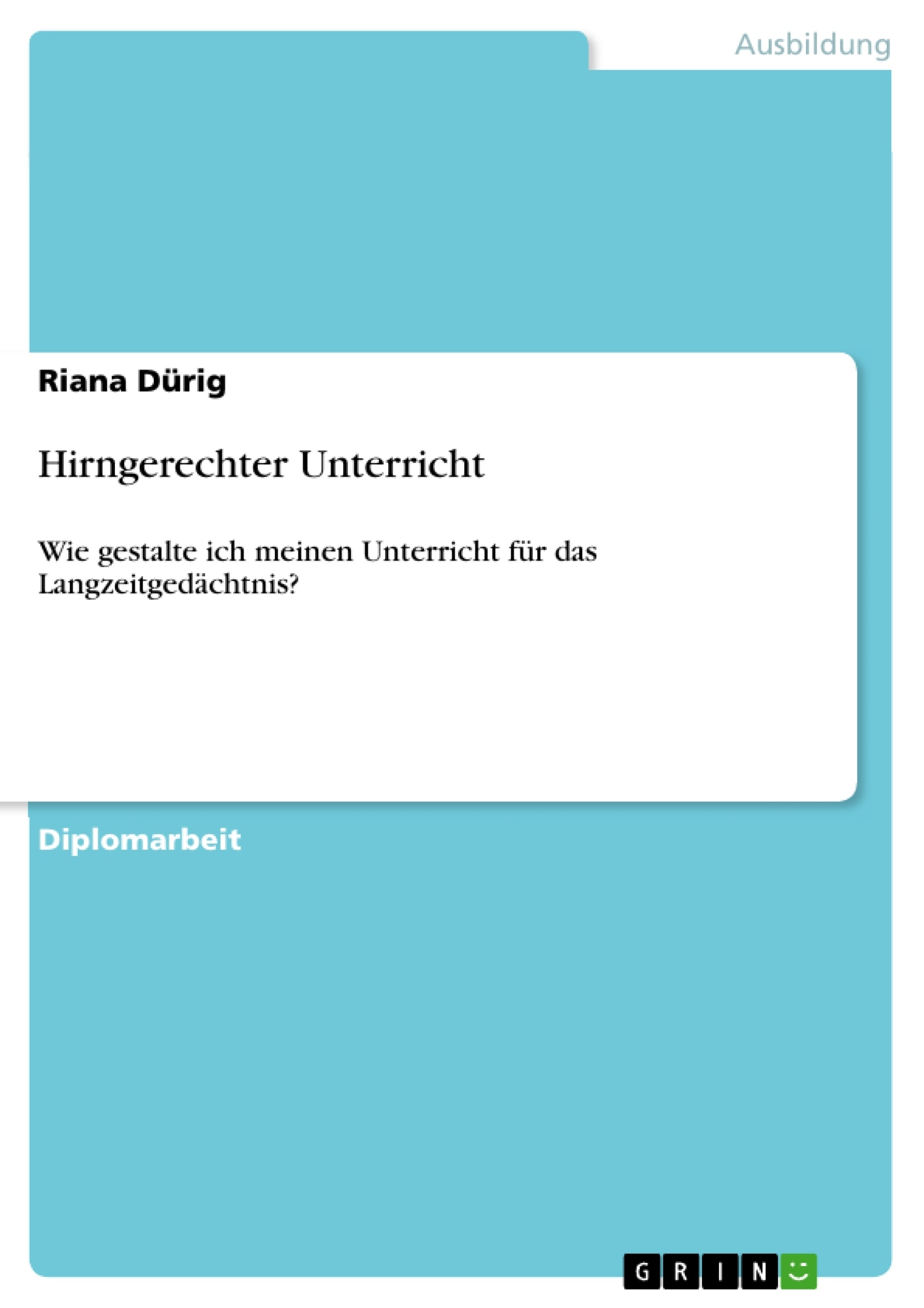
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.