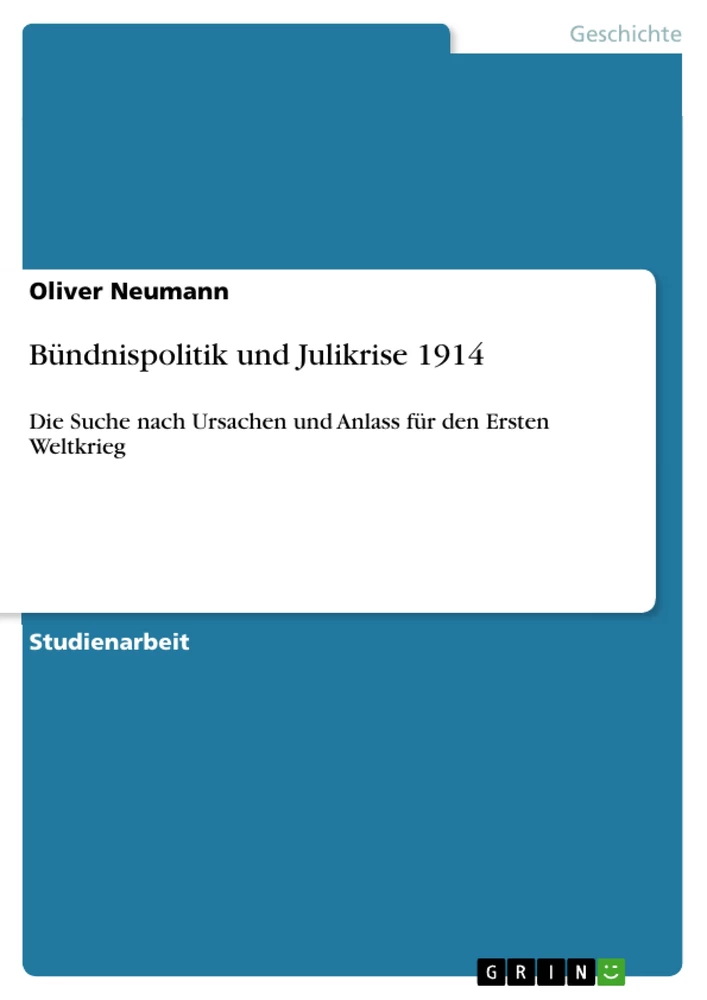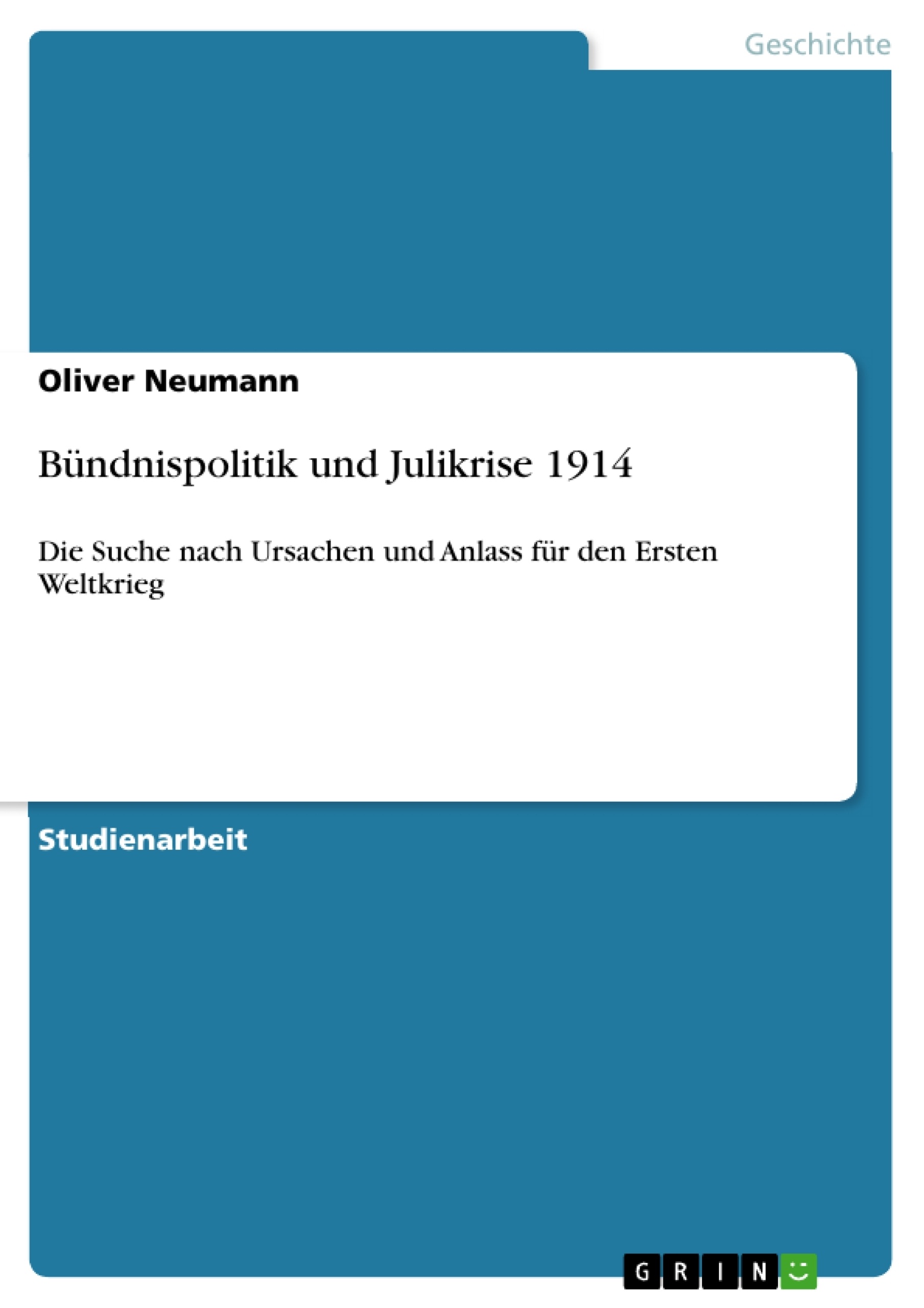Fast das gesamte 20. Jahrhundert wurde von großen internationalen Spannungen und Konflikten geprägt. In den großen Krisen und Kriegen sind Millionen von Menschenleben zu bedauern und neue Regierungssysteme und Weltmächte entstanden. Für Geschichtswissenschaftler stellt das 20. Jahrhundert aber nicht nur einen wichtigen Einschnitt und den Übergang der großen Industrienationen in demokratische Staaten dar, sondern wirft auch immer wieder die Frage auf, welche Zusammenhänge eine solche Geschichte des nunmehr letzten Jahrhunderts überhaupt ermöglichten. In diesem Kontext kommen die Menschen auf die Bedeutung des Ersten Weltkrieges zu sprechen. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Historiker den Ersten Weltkrieg als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts “ bezeichnen. Doch wie kam es dazu, dass im Jahr 1914 die größten und einflussreichsten Nationen rund um den Globus gegeneinander Krieg führten, der mehr als 10 Millionen Menschen das Leben kostete? Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig. Man kann die langfristigen Ursachen nur umreißen und auch nur die Umstände ansprechen, die erst mit dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo am 28. Juni 1914 losgetreten worden sind. Im ersten Teil wird insbesondere auf die Problematik der Bündnissysteme und den Veränderungen innerhalb dieser eingegangen - Im zweiten Teil dann auf die sich nach dem Attentat vom 28. Juni 1914 anbahnende und spätestens am 23. Juli ausbrechende „Julikrise“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vor dem Krieg: Mächte und Machenschaften
- Die Bündnissysteme seit Bismarck
- Der Dreibund
- Englands Bündnispolitik – Die Triple Entente
- Die Bündnissysteme seit Bismarck
- Julikrise und Kriegsausbruch 1914
- Das Attentat von Sarajevo
- Die Julikrise 1914
- Das (unannehmbare) Ultimatum an Serbien
- Die Kriegserklärungen
- Der Kriegsbeginn
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Ursachen des Ersten Weltkrieges, wobei der Fokus auf der Bündnispolitik der europäischen Großmächte und der Julikrise 1914 liegt. Ziel ist es, die langfristigen Ursachen des Krieges zu umreißen und die unmittelbaren Ereignisse, die zum Kriegsausbruch führten, zu analysieren.
- Die Entwicklung der europäischen Bündnissysteme im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
- Die Rolle des Dreibundes und der Triple Entente im Vorfeld des Krieges
- Die Julikrise 1914 und die Reaktion der Großmächte auf das Attentat von Sarajevo
- Die Rolle der Mittelmächte im Ausbruch des Krieges
- Die Frage nach der gezielten Planung oder einer Verkettung von unglücklichen Umständen als Ursache des Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ersten Weltkrieg als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ dar und erläutert die Bedeutung der Bündnissysteme für den Kriegsausbruch. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: den ersten Teil, der sich mit den Bündnissystemen und ihren Veränderungen befasst, und den zweiten Teil, der die Julikrise 1914 beleuchtet.
Kapitel 2 analysiert die Entwicklung der europäischen Bündnissysteme seit Bismarck. Es werden die Entstehung des Dreibundes, die Rolle Englands und die Bildung der Triple Entente dargestellt. Die Bedeutung der Bündnisse für die Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts und die Gefahr, die sie im Falle von Krisen darstellten, werden hervorgehoben.
Kapitel 3 befasst sich mit der Julikrise 1914. Es werden das Attentat von Sarajevo, die Reaktion der Großmächte und das Ultimatum an Serbien analysiert. Die Kriegserklärungen und der Beginn des Ersten Weltkrieges werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bündnispolitik, die Julikrise 1914, den Dreibund, die Triple Entente, das Attentat von Sarajevo, das Ultimatum an Serbien, die Kriegserklärungen, der Kriegsausbruch und die Ursachen des Ersten Weltkrieges.
- Quote paper
- Oliver Neumann (Author), 2014, Bündnispolitik und Julikrise 1914, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280674