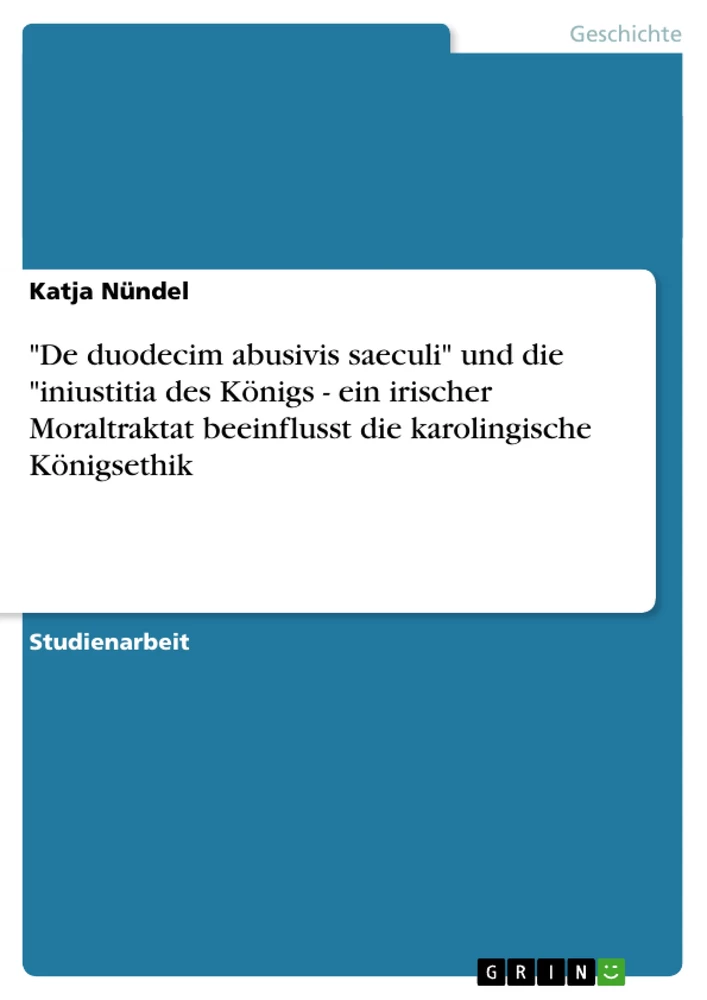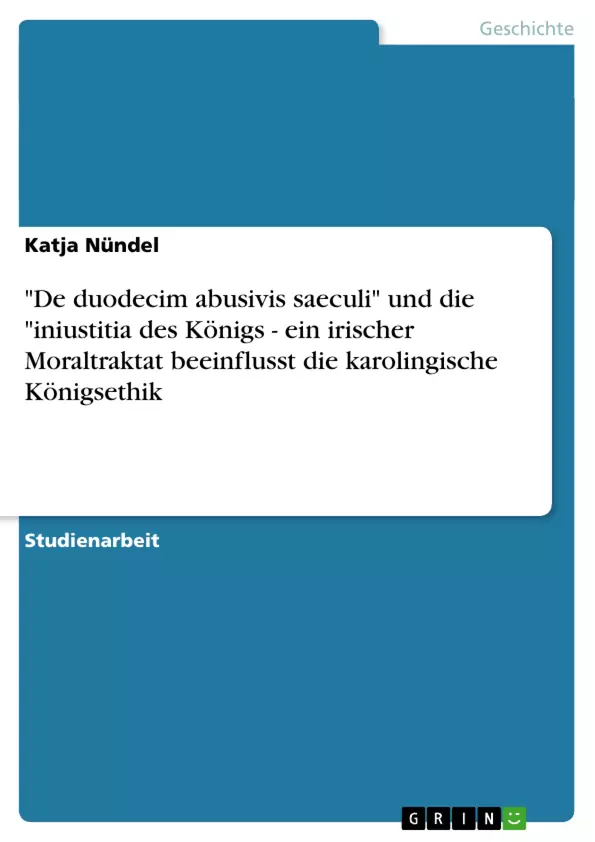„De duodecim abusivis saeculi“ ist ein kleiner gesamtgesellschaftlich angelegter Moraltraktat, der vermutlich in der Mitte des 7. Jahrhunderts in Irland entstand. In zwölf Kapiteln legt er knapp die Grundübel der Welt dar, wobei sich frühchristliche mit heidnischen Einflüssen mischen.
In einem Kapitel über den „ungerechten König“ beschreibt der unbekannte Verfasser des Traktats allerlei Folgen der guten und der schlechten Herrschaft, wobei die schlechte Herrschaft mächtige Naturgewalten zu entfesseln im Stande ist.
„De duodecim abusivis saeculi“ erfuhr durch das ganze Mittelalter hindurch hohe Beachtung und war in ganz West- und Mitteleuropa verbreitet. Seit Beginn der Entwicklung der stark christlich geprägten Fürstenspiegel am Anfang des 9. Jahrhunderts war die Königsethik dieses halb heidnischen Werkes eine Art „Standardquelle“ für die Geistlichen des Kontinents, um unter dem großen Namen des heiligen Cyprianus die Folgen vor allem der schlechten Herrschaft drohend an die Wand zu malen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wieso ausgerechnet ein noch stark von Mythen und Aberglauben geprägtes Schriftstück vom Rande der Christenheit so schnell und unverrückbar ins Zentrum einer neu entstehenden völlig religiös ausgerichteten Herrschaftsethik geraten konnte, namentlich der karolingischen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- De duodecim abusivis saeculi
- Inhalt
- Geografische Herkunft
- Problem der Datierung
- Besonderheiten der irischen Tradition
- Nonus abusionis gradus: rex iniquus
- Die Bedeutung des Terminus iniquus
- Das Fehlverhalten des Königs und das Volkswohl
- Einfluss auf die Karolinger
- Der Weg der abusiva auf den Kontinent
- Die abusiva in den Fürstenspiegeln
- Zusammenfassung
- Literatur/Quellen
- Literatur
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie der Moraltraktat „De duodecim abusivis saeculi“ die Königsethik des frühen Mittelalters beeinflusste. Sie analysiert den Inhalt, die Herkunft und die Besonderheiten des Traktats, insbesondere die im Text dargestellte Königsethik, und beleuchtet den Einfluss, den dieser auf dem europäischen Festland, insbesondere bei den Karolingern, hatte.
- Inhalt und Bedeutung des Moraltraktats „De duodecim abusivis saeculi“
- Geografische Herkunft und Datierung des Traktats
- Die Königsethik in „De duodecim abusivis saeculi“
- Der Einfluss des Traktats auf die Karolinger
- Die Gründe für die weitreichende Verbreitung und Bedeutung des Traktats im frühen Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Traktats „De duodecim abusivis saeculi“ ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Werkes auf die Königsethik der Karolingerzeit dar. Kapitel 2 behandelt den Inhalt, die geografische Herkunft und die Problematik der Datierung des Traktats. Im dritten Kapitel werden Besonderheiten der irischen Tradition im Traktat beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich dem neunten Grad der Übel, dem „ungerechten König“, und analysiert die Bedeutung des Begriffs „iniquus“ sowie die Folgen des Fehlverhaltens des Königs für das Volkswohl. Kapitel 5 untersucht den Einfluss von „De duodecim abusivis saeculi“ auf die Karolinger, insbesondere den Weg der „abusiva“ auf den Kontinent und ihre Verwendung in den Fürstenspiegeln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „De duodecim abusivis saeculi“, „Königsethik“, „Fürstenspiegel“, „irische Tradition“, „Karolinger“, „abusiva“, „iniquus“ und „Volkswohl“. Sie beleuchtet die Bedeutung des Traktats als Quelle für die Entwicklung der Königsethik im frühen Mittelalter und die Verbreitung der „abusiva“ als Leitbild für eine gerechte Herrschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „De duodecim abusivis saeculi“?
Es handelt sich um einen irischen Moraltraktat aus dem 7. Jahrhundert, der die zwölf Grundübel der Welt beschreibt.
Was versteht der Traktat unter einem „ungerechten König“ (rex iniquus)?
Ein König, dessen Fehlverhalten nicht nur dem Volkswohl schadet, sondern der durch seine Ungerechtigkeit sogar mächtige Naturgewalten entfesseln kann.
Wie beeinflusste dieses Werk die Karolinger?
Die karolingische Königsethik nutzte den Traktat als Standardquelle für ihre Fürstenspiegel, um Herrschern die Folgen schlechter Führung drohend vor Augen zu führen.
Warum war ein „halb heidnisches“ Werk im christlichen Mittelalter so erfolgreich?
Obwohl es Mythen und Aberglauben enthielt, wurde es unter dem Namen des heiligen Cyprianus verbreitet und bot eine klare, religiös ausgerichtete Herrschaftsethik.
Was bedeutet der Terminus „iniquus“ in diesem Kontext?
„Iniquus“ steht für die Ungerechtigkeit des Herrschers, die im Gegensatz zur göttlichen Ordnung steht und das Gleichgewicht der Welt stört.
Was sind „Fürstenspiegel“?
Das sind belehrende Schriften des Mittelalters, die einem Herrscher seine Pflichten und die Ideale einer gerechten Regierung aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Diplom Katja Nündel (Autor:in), 2003, "De duodecim abusivis saeculi" und die "iniustitia des Königs - ein irischer Moraltraktat beeinflusst die karolingische Königsethik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28068