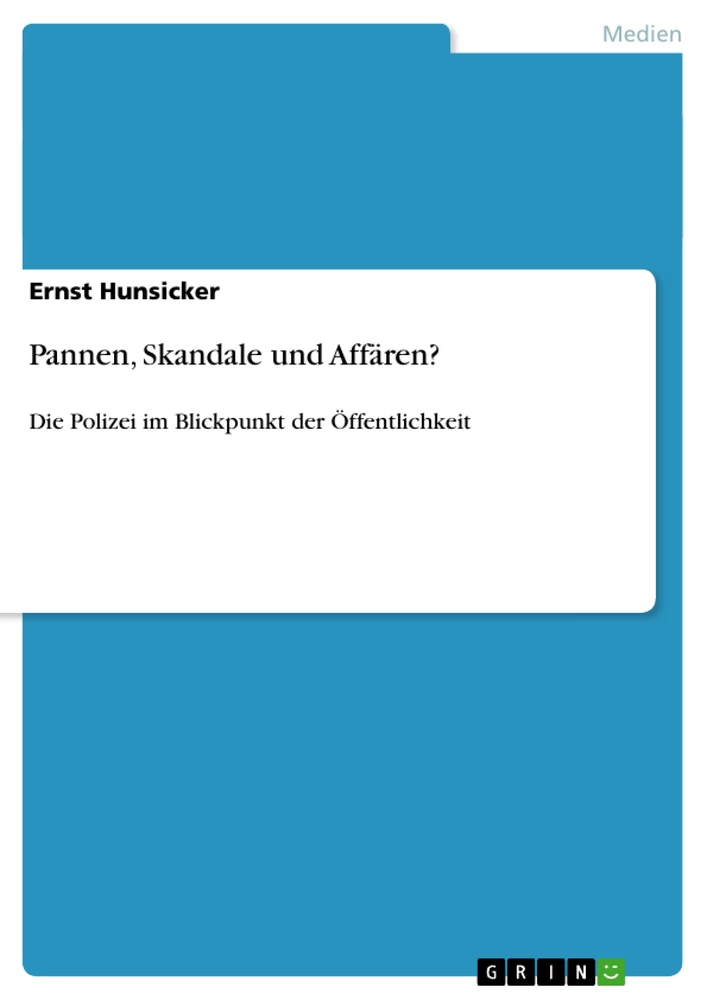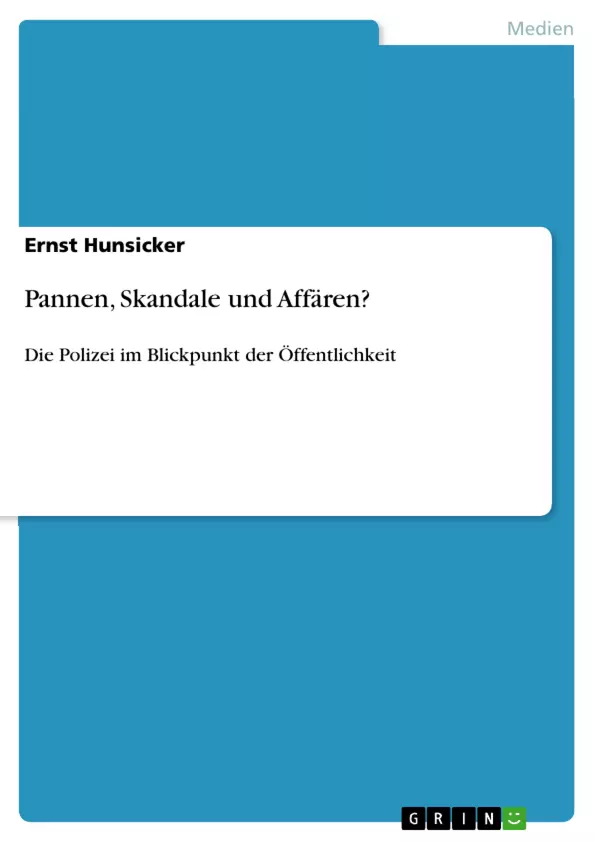Mit der Wortwahl „Polizeipanne“, „Polizeiskandal“ oder auch „Polizeiaffäre“ sind die Medien schnell bei der Hand. Da gibt es zwischen dem seriösen Journalismus und dem Boulevardjournalismus kaum einen nennenswerten Unterschied. Journalisten sind gegenüber der „sensationsgierigen Öffentlichkeit“ kaum bereit, die Untersuchungen zu Vorwürfen, die sich gegen die Polizei (allgemein) oder gegen einzelne Polizeibeschäftigte richten, abzuwarten. Es gilt nicht gerade selten das Prinzip „Vorurteil vor Urteil“. Allerdings: Die Hinweise auf (vermeintlich) strafrechtlich relevantes Verhalten und/oder (vermeintlich) beamten-/disziplinarrechtlich zu würdigendes Fehlverhalten kommen auch aus den Reihen der Polizei (offen, anonym). Über die Motivlage der anzeigenden Person lässt sich mehr oder weniger spekulieren. Bereits nach den ersten Untersuchungen stellt sich oft genug heraus, dass die „Polizeipanne“, der „Polizeiskandal“ oder die „Polizeiaffäre“ lediglich eine voreilige Journalistenschelte war, woran allerdings teils Verantwortliche in vorgesetzten Polizeibehörden und (über-)kritische Experten eine nicht unerhebliche Mitverantwortung tragen. Dieser Personenkreis kann offenbar gar nicht ermessen, welches Unheil er nicht nur für die betroffenen Personen, sondern auch für deren Familien anrichtet. Das Prinzip der Unschuldsvermutung als Teil des Rechtsstaatsprinzips gilt anscheinend nur eingeschränkt für öffentlich Beschäftigte und somit auch für Polizeibeschäftigte. Auch ist festzustellen, dass beschuldigte Polizeibeschäftigte vorschnell „suspendiert“ werden, wobei allerdings – nicht immer nachvollziehbare – Unterscheidungen vorgenommen werden. Denn die Unschuldsvermutung wird mal so und mal so ausgelegt, sodass der Verdacht entstehen kann, dass es eine „Unschuldsvermutung der 1. und der 2. Klasse“ gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Begriffsabgrenzungen und Begriffe
- 1.1 Begriffsabgrenzungen
- 1.2 Begriffe
- 2. Konkrete Beispiele
- 2.1 „Polizeipannen“
- 2.1.1 „Mordfall Lena in Emden“
- 2.1.2 „Polizeipanne“ in Köln: „Polizeiskandal: Nur eine Mordsgaudi?“
- 2.2 „Osnabrücker Abschleppaffäre“
- 2.3 „Dienstwagenaffären“ (noch nicht abgeschlossen)
- 2.4.1 Exkurs „Private Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen“
- 3. Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit
- 3.1 Leserbrief zu der „Polizeipanne“ in Köln
- 3.2 Positive Berichterstattung über die Polizei in den Medien (zur Gewaltbereitschaft junger Männer)
- 3.3 Kundenbefragung Osnabrück
- 3.4 Kriminologische Regionalanalysen in der Stadt Osnabrück
- 3.5 Vertrauensumfrage
- 4. Ergebnis
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Thema der öffentlichen Wahrnehmung der Polizei im Kontext von vermeintlichen Pannen, Skandalen und Affären. Der Autor analysiert die Medienberichterstattung über solche Vorfälle und hinterfragt die Verwendung der Begriffe „Polizeipanne“, „Polizeiskandal“ und „Polizeiaffäre“. Dabei werden konkrete Beispiele aus der Praxis herangezogen, um die Problematik der voreiligen Verurteilung von Polizeibeschäftigten und die Auswirkungen auf deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu beleuchten.
- Begriffsabgrenzung und Definition von „Polizeipanne“, „Polizeiskandal“ und „Polizeiaffäre“
- Analyse von konkreten Beispielen aus der Praxis
- Die Rolle der Medien in der Berichterstattung über Polizeivorfälle
- Die Auswirkungen von Vorwürfen auf das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit
- Die Bedeutung der Unschuldsvermutung im Kontext von Polizeiskandalen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel des Textes befasst sich mit der Begriffsabgrenzung und Definition von „Polizeipanne“, „Polizeiskandal“ und „Polizeiaffäre“. Der Autor stellt fest, dass die Medien in ihrer Berichterstattung über solche Vorfälle nicht immer eine genaue Begriffsabgrenzung vornehmen. Er versucht, die Begriffe mit „Polizei“ in Verbindung zu bringen und definiert sie anhand von Beispielen aus der Praxis.
Das zweite Kapitel des Textes präsentiert konkrete Beispiele für „Polizeipannen“, „Polizeiskandale“ und „Polizeiaffären“. Der Autor analysiert die Vorfälle und hinterfragt die Medienberichterstattung. Er stellt fest, dass die Vorwürfe gegen die Polizei nicht immer gerechtfertigt sind und dass die Medien oft voreilig von „Pannen“, „Skandalen“ und „Affären“ sprechen.
Das dritte Kapitel des Textes befasst sich mit dem Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit. Der Autor analysiert die Auswirkungen von Vorwürfen gegen die Polizei auf deren Ansehen in der Öffentlichkeit. Er stellt fest, dass die Medienberichterstattung über Polizeiskandale das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit negativ beeinflussen kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Polizeipannen, Polizeiskandale, Polizeiaffären, Medienberichterstattung, öffentliche Wahrnehmung, Ansehen der Polizei, Unschuldsvermutung, Vorurteil vor Urteil, Disziplinarrecht, Dienstenthebung, Beamte, Polizei, Rechtstaatsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer Polizeipanne und einem Polizeiskandal?
Eine Panne ist meist ein handwerklicher Fehler in der Ermittlung, während ein Skandal moralisch oder strafrechtlich schwerwiegendes Fehlverhalten bezeichnet, das oft die gesamte Institution diskreditiert.
Wie beeinflussen Medien das Bild der Polizei?
Medien neigen laut Arbeit oft zu voreiliger Sensationsberichterstattung ("Vorurteil vor Urteil"), was das Vertrauen der Öffentlichkeit schädigen kann, bevor Untersuchungen abgeschlossen sind.
Gilt die Unschuldsvermutung auch für Polizisten?
Rechtlich ja, doch die Arbeit kritisiert, dass Polizisten in der Öffentlichkeit oft vorverurteilt und vorschnell suspendiert werden, was weitreichende Folgen für sie und ihre Familien hat.
Was war die "Osnabrücker Abschleppaffäre"?
Ein konkretes Praxisbeispiel der Arbeit, das die Dynamik zwischen polizeilichem Handeln, internen Vorwürfen und medialer Aufarbeitung illustriert.
Wie steht es um das allgemeine Vertrauen in die Polizei?
Trotz negativer Schlagzeilen zeigen Vertrauensumfragen und kriminologische Regionalanalysen oft ein differenziertes Bild mit weiterhin hohen Vertrauenswerten in weiten Teilen der Bevölkerung.
- Arbeit zitieren
- Ernst Hunsicker (Autor:in), 2014, Pannen, Skandale und Affären?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280740