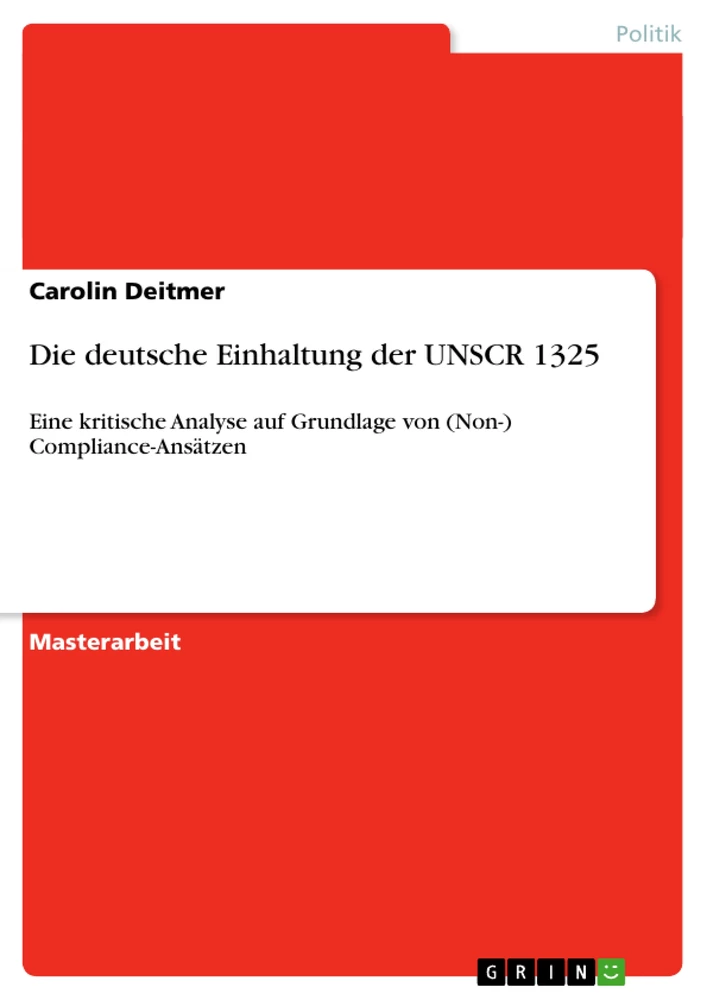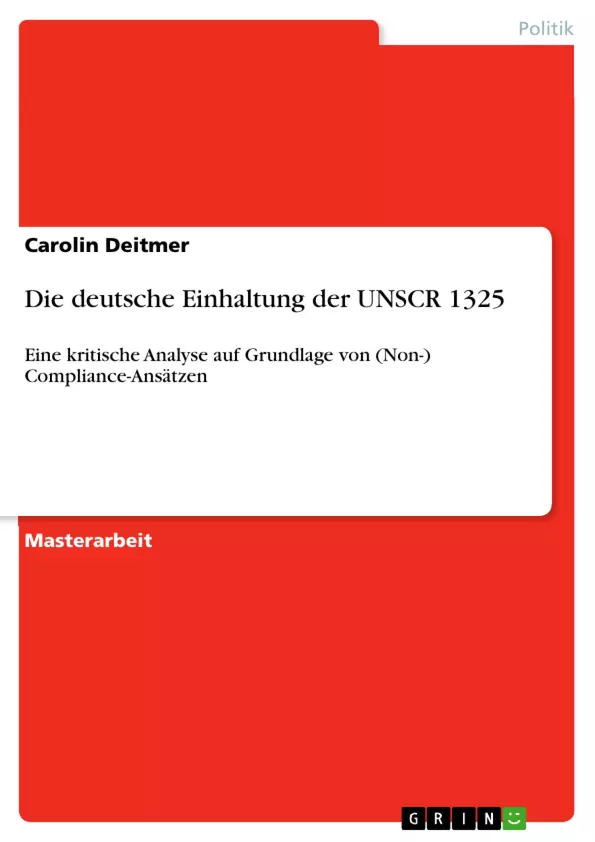Die Master Thesis geht der Frage nach, inwieweit sich die Bundesrepublik Deutschland an die Vorgaben der UN-Resolution 1325 hält bzw. hielt, und versucht, die Motive für Regeleinhaltung oder Regelbruch auf Grundlage interdisziplinärer (Non-) Compliance-Ansätze zu verorten.
Die UNSCR 1325 wurde im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet und sollte den Geschlechtscharakter (inter-) nationaler Sicherheitspolitik verändern und Frauen an sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen teilhaben lassen. Da es zahlreiche Kritik seitens der Zivilgesellschaft und der Oppositionsparteien an der Regeleinhaltung gibt, geht die Arbeit der Frage nach, inwiefern sich die BRD an die Vorgaben aus der Resolution hielt bzw. hält. Theoretischer Unterbau sind interdisziplinäre "Non-Compliance-Ansätze", Compliance wird übersetzt als Regeleinhaltung, Non-Compliance als Regelbruch. Dabei stützt sich die Arbeit auf 2 Thesen:
Erstens wird konstatiert, dass sich die Bundesregierung seit der Verabschiedung der UNSCR in Grundzügen an diese hielt und keinen groben Regelbruch beging, wählt man die SCR 1325 selber als normativen Bezugspunkt. Zweitens wird behauptet, dass die Bundesregierung bis Mitte 2012 keine perfekte Regeleinhaltung verfolgte, wenn man die die SCR 1325 präzisierenden Verhaltensvorschriften der Zivilgesellschaft und der UN einbezieht. Hier erfolgten Regelbrüche, auf die sich die genannte Kritik bezieht. Erst ab Mitte 2012 änderten die Regierungsfraktionen ihr Verhalten hin zu besserer Regeleinhaltung, indem sie einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung verabschiedeten und somit zu einem großen Teil den Verhaltensvorschriften nachkamen.
Vor dem Hintergrund dieser Thesen stellt die Arbeit folgende Fragen, welche auf Grundlage der (Non-) Compliance-Ansätze zumindest in Grundzügen beantwortet werden sollen.
1) Aus welchen Gründen hielt sich Deutschland an die SCR 1325? Diese Frage erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Resolution für die Mitgliedstaaten lediglich als „inhaltlich
verpflichtend“ betrachtet wird und nicht als „völkerrechtlich verbindlich“. 2) Aus welchen Gründen richtet(e) Deutschland bis Mitte 2012 seine Maßnahmen nicht an den Folgedokumenten der UN und der Zivilgesellschaft aus?
3) Woher rührte der Verhaltenswandel hin zur Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans im Jahr 2012?
Die Arbeit betritt Neuland, so bezieht sie Compliance-Ansätze auf rechtlich nicht verbindliche Regeln.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Die deutsche Einhaltung der UNSCR 1325 basierend auf (Non-) Compliance-Ansätzen
- 1.1 Deutschland und die UNSCR 1325: Fragestellung und Thesen
- 1.2 Die Besonderheit dieser Arbeit: Flexible Anwendung der (Non-) Compliance-Forschung
- 1.3 Die Relevanz des Themas und die Forschungslücke
- 1.4 Die Eingrenzung auf die BRD und die damit verfolgten Ziele
- 1.5 Die Methodik
- 1.5.1 (Non-) Compliance-Ansätze als theoretischer Unterbau: Flexible Anwendung und der Versuch einer Ergründung deutscher Motive
- 1.5.2 Ansprüche und Einordnung in politikwissenschaftliche Forschungsansätze
- 1.5.3 Der Aufbau der Arbeit und die dabei verwendete Literatur
- 2 Grundlagen: SCR 1325 und sonstige Vorgaben als Referenzpunkte
- 2.1 SCR 1325: Genese und Einbettung in die UN Agenda,,Frieden Frauen, Sicherheit".
- 2.2 Inhalte der SCR 1325 mit Fokus auf den Vorgaben für die Mitgliedstaaten
- 2.2.1 Partizipation
- 2.2.2 Prävention
- 2.2.3 Protektion
- 2.3 Sonstige Dokumente
- 2.3.1 Die Forderungen der UN nach einem Nationalen Aktionsplan - oder anderen Strategien
- 2.3.2 CSO Position Paper on the Europe-wide Implementation of UNSCR 1325
- 2.3.3 Bündnis 1325: 10 Eckpunkte für einen deutschen NAP und deutsche Umsetzung
- 2.4 Begründung der Referenzpunkte
- 2.4.1 SCR 1325: Inhaltlich verpflichtend
- 2.4.2 Übrige Dokumente: Der Weg zum,,spirit of the treaty“?
- 2.4.2.1 Präsidentielle Erklärungen und Berichte des Generalsekretärs: klare Leitlinien
- 2.4.2.2 Dokumente der Zivilgesellschaft
- 2.4.3 Zusammenfassung I: Unübliche Referenzpunkte
- 3 (Non-) Compliance: Der theoretische Unterbau
- 3.1 Eine Hinführung zur (Non-) Compliance-Forschung
- 3.1.1 Definition von (Non-) Compliance
- 3.1.2 Die Interdisziplinarität des Forschungsstrangs
- 3.1.3 Die Schwierigkeit der Messung
- 3.1.4 (Prozessuale) Kategorien von Compliance
- 3.2 Verschiedene Ansätze zur Erklärung von (Non-) Compliance
- 3.2.1 Gründe für (Non-) Compliance innerhalb instrumenteller Modelle (Enforcement)
- 3.2.1.1 (Non-) Compliance aus Zufall
- 3.2.1.2 (Non-) Compliance als Resultat einer Kosten-Nutzen-Kalkulation
- 3.2.1.3 (Non-) Compliance als Resultat innenpolitischer Prozesse
- 3.2.1.4 Non-Compliance als Resultat subtiler Opposition
- 3.2.2 Gründe für (Non) Compliance innerhalb normativer Modelle (Management)
- 3.2.2.1 (Non-) Compliance als Resultat der Regel selber und Moral
- 3.2.2.2 (Non-) Compliance als Resultat von (Un-) Eindeutigkeit und (mangelnder) Angebrachtheit
- 3.2.2.3(Non-) Compliance als Resultat von (fehlender) Legitimität
- 3.2.2.4 (Non-) Compliance als Resultat von (fehlender) Legalisierung
- 3.2.2.5 (Non-) Compliance als Resultat vorhandener/fehlender Ressourcen/Kapazitäten
- 3.2.3 Zusammenfassung II: Die (Non-) Compliance, ihre Erklärungsansätze und deren Besonderheiten
- 4 Die Einhaltung der SCR 1325 und der Verhaltensvorschriften: Eine kritische Bestandsaufnahme
- 4.1 Plausibilisierung und Ausdifferenzierung der ersten These
- 4.1.1 Das Vorgehen bei der Analyse
- 4.1.2 Generelle Informationen zur deutschen Regeleinhaltung
- 4.1.3 Gesetzliche und administrative Maßnahmen: Der Output-Bereich
- 4.1.3.1 Partizipation
- 4.1.3.2 Prävention
- 4.1.3.3 Protektion
- 4.1.3.4 Fazit Output-Bereich
- 4.1.4 Wirkung der Maßnahmen auf die Zielgruppe: Der Outcome-Bereich
- 4.1.4.1 Partizipation
- 4.1.4.2 Prävention
- 4.1.4.3 Protektion
- 4.1.5 Zusammenfassung III: Plausibilisierung der ersten These und Reflektion
- 4.2 Plausibilisierung und Ausdifferenzierung der zweiten These
- 4.2.1 Der output-Bereich: Bis Mitte 2012
- 4.2.2 Der output-Bereich: Neueste Ereignisse Ende 2012
- 4.2.2.1 Inhalt des NAP
- 4.2.2.2 Der deutsche NAP und die Verhaltensvorschriftenn - ein Abgleich
- 4.2.3 Outcome: noch nicht bestimmbar
- 4.3 Zusammenfassung IV: Die Prozesshaftigkeit deutscher Compliance
- 5 Gründe für Stand der Regeleinhaltung
- 5.1 Gründe für die Compliance der SCR 1325
- 5.1.1 Instrumentelle Erklärungsansätze
- 5.1.1.1 Compliance aus Zufall?
- 5.1.1.2 Compliance aus Reputationsgründen?
- 5.1.1.3 Compliance als Resultat innenpolitischer Prozesse?
- 5.1.2 Normative Erklärungsansätze
- 5.1.2.1 Compliance durch die Kraft der Regel und moralische Bedenken?
- 5.1.2.2 Compliance durch fehlende Präzision und Angebrachtheit?
- 5.1.2.3 Compliance als Resultat von Legitimität?
- 5.1.2.4 Compliance durch Legalisierung?
- 5.1.2.5 Compliance als Resultat ausreichender Kapazitäten und Ressourcen?
- 5.1.3 Zusammenfassung V: Akkumulation von Gründen statt Vorherrschaft eines Einzelnen
- 5.2 Gründe für die Non-Compliance der nicht verpflichtenden Verhaltensvorschriften bis 2012
- 5.2.1 Instrumentelle Erklärungsansätze
- 5.2.1.1 Non-Compliance aus Zufall?
- 5.2.1.2 Non-Compliance als Resultat zu hoher Kosten?
- 5.2.1.3 Non-Compliance als Resultat innenpolitischer Prozesse
- 5.2.2 Normative Erklärungsansätze
- 5.2.2.1 Non-Compliance durch fehlende Kraft der Regel und moralische Bedenken?
- 5.2.2.2 Non-Compliance durch fehlende Präzision und Unangebrachtheit?
- 5.2.2.3 Non-Compliance durch fehlende Legitimität?
- 5.2.2.4 Non-Compliance als Resultat (fehlender) Legalisierung?
- 5.2.2.5 Non-Compliance aus Mangel an Kapazitäten und Ressourcen?
- 5.2.2.6 Non-Compliance als Resultat subtiler Opposition?
- 5.2.3 Zusammenfassung VI: Fehlender Rechtscharakter und mangelnder politischer Wille als Haupterklärungen?
- 5.3 Gründe für den Wandel hin zu Compliance ab 2013
- 5.3.1 Zu verwerfende Erklärungsansätze
- 5.3.2 Mögliche Erklärungen: Reputation und Angst vor Machtverlust, innenpolitische Prozesse und Moral
- 6 Wege zu besserer Regeleinhaltung? Lessons learnt
- 7 Schluss: Kritische Begleitung der Compliance-Prozesse nötig
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der deutschen Einhaltung der UN-Resolution 1325 (UNSCR 1325) im Kontext der (Non-) Compliance-Forschung. Ziel der Arbeit ist es, die deutsche Umsetzung der Resolution auf Grundlage von (Non-) Compliance-Ansätzen kritisch zu analysieren und die Gründe für die (Nicht-)Einhaltung der Resolution zu ergründen. Die Arbeit untersucht dabei die deutsche Umsetzung der Resolution in Bezug auf die drei Säulen Partizipation, Prävention und Protektion.
- Die Rolle der UNSCR 1325 in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik
- Die Anwendung von (Non-) Compliance-Ansätzen zur Analyse der deutschen Umsetzung der UNSCR 1325
- Die Herausforderungen der Umsetzung der UNSCR 1325 in Deutschland
- Die Bedeutung von nationalen Aktionsplänen (NAPs) für die Umsetzung der UNSCR 1325
- Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der UNSCR 1325
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der deutschen Einhaltung der UNSCR 1325 ein und stellt die Fragestellung und die Thesen der Arbeit vor. Es wird die Besonderheit dieser Arbeit im Kontext der (Non-) Compliance-Forschung erläutert und die Relevanz des Themas sowie die Forschungslücke aufgezeigt. Zudem werden die Methodik und der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen der UNSCR 1325 und anderer relevanter Dokumente. Es werden die Genese der Resolution, ihre Einbettung in die UN-Agenda „Frieden Frauen, Sicherheit“ sowie die Inhalte der Resolution mit Fokus auf die Vorgaben für die Mitgliedstaaten dargestellt. Darüber hinaus werden weitere Dokumente wie die Forderungen der UN nach einem Nationalen Aktionsplan, das CSO Position Paper on the Europe-wide Implementation of UNSCR 1325 und das Bündnis 1325 mit seinen 10 Eckpunkten für einen deutschen NAP und deutsche Umsetzung vorgestellt. Abschließend werden die Gründe für die Auswahl dieser Referenzpunkte erläutert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem theoretischen Unterbau der Arbeit, der (Non-) Compliance-Forschung. Es werden die Definition von (Non-) Compliance, die Interdisziplinarität des Forschungsstrangs, die Schwierigkeit der Messung und die verschiedenen Ansätze zur Erklärung von (Non-) Compliance dargestellt. Die Arbeit unterscheidet dabei zwischen instrumentellen und normativen Modellen und beleuchtet die verschiedenen Gründe für (Non-) Compliance innerhalb dieser Modelle.
Kapitel 4 analysiert die deutsche Einhaltung der UNSCR 1325 und der Verhaltensvorschriften. Es werden die generellen Informationen zur deutschen Regeleinhaltung, die gesetzlichen und administrativen Maßnahmen sowie die Wirkung der Maßnahmen auf die Zielgruppe dargestellt. Die Analyse erfolgt anhand der drei Säulen Partizipation, Prävention und Protektion. Die Ergebnisse der Analyse werden zusammengefasst und reflektiert.
Kapitel 5 untersucht die Gründe für den Stand der Regeleinhaltung. Es werden sowohl instrumentelle als auch normative Erklärungsansätze für die Compliance der SCR 1325 und die Non-Compliance der nicht verpflichtenden Verhaltensvorschriften bis 2012 vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Gründe für (Non-) Compliance und analysiert die Gründe für den Wandel hin zu Compliance ab 2013.
Kapitel 6 beleuchtet die Lessons learnt und zeigt Wege zu besserer Regeleinhaltung auf.
Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und betont die Notwendigkeit einer kritischen Begleitung der Compliance-Prozesse.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die UN-Resolution 1325, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, die (Non-) Compliance-Forschung, die Umsetzung der Resolution in Bezug auf die drei Säulen Partizipation, Prävention und Protektion, die Rolle von nationalen Aktionsplänen (NAPs), die Herausforderungen der Umsetzung der Resolution in Deutschland und die Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der UNSCR 1325.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der UN-Resolution 1325?
Die Resolution fordert die stärkere Beteiligung von Frauen an sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen sowie deren Schutz in bewaffneten Konflikten (Säulen: Partizipation, Prävention, Protektion).
Hat Deutschland die Vorgaben der UNSCR 1325 eingehalten?
In Grundzügen ja, jedoch gab es bis 2012 Kritik an der mangelnden Umsetzung präziser Verhaltensvorschriften. Erst mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) Ende 2012 verbesserte sich die Regeleinhaltung.
Warum ist die UNSCR 1325 völkerrechtlich umstritten?
Die Resolution gilt als „inhaltlich verpflichtend“, aber nicht als „völkerrechtlich verbindlich“, was zu Spielräumen bei der nationalen Umsetzung durch die Mitgliedstaaten führt.
Welche Rolle spielt der Nationale Aktionsplan (NAP) für Deutschland?
Der NAP konkretisiert die Maßnahmen der Bundesregierung zur Umsetzung der Resolution und dient als Instrument zur besseren Steuerung und Überprüfung der Ziele.
Was versteht man unter „Non-Compliance“ in diesem Kontext?
Non-Compliance bezeichnet den Regelbruch oder das Ausbleiben erforderlicher Maßnahmen trotz bestehender internationaler Normen oder politischer Verpflichtungen.
- Quote paper
- M.A. Carolin Deitmer (Author), 2013, Die deutsche Einhaltung der UNSCR 1325, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280828