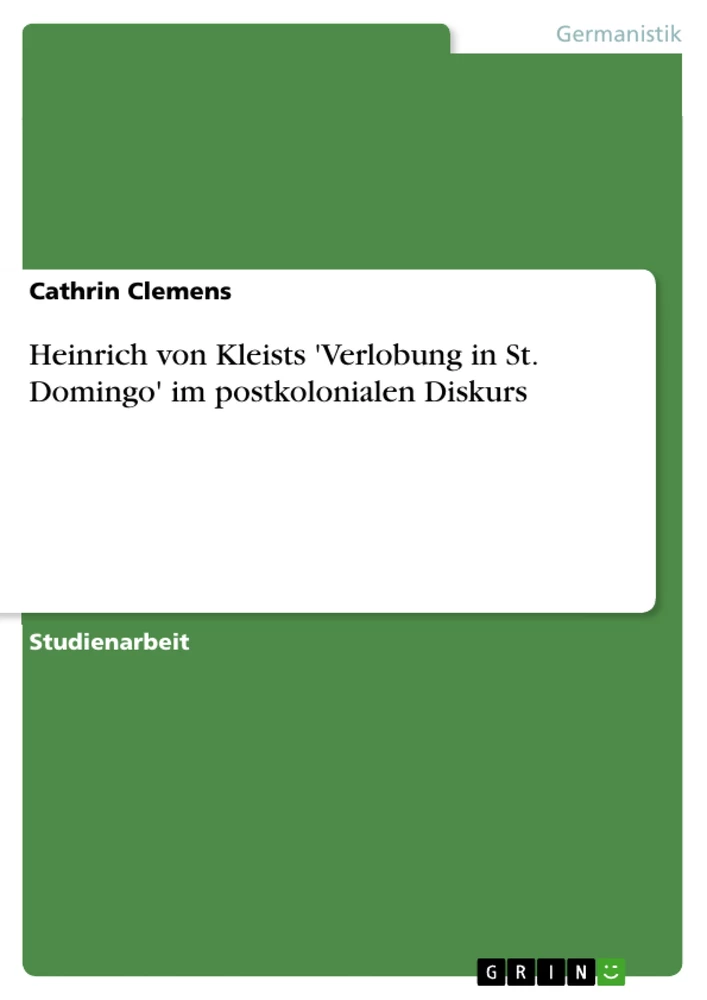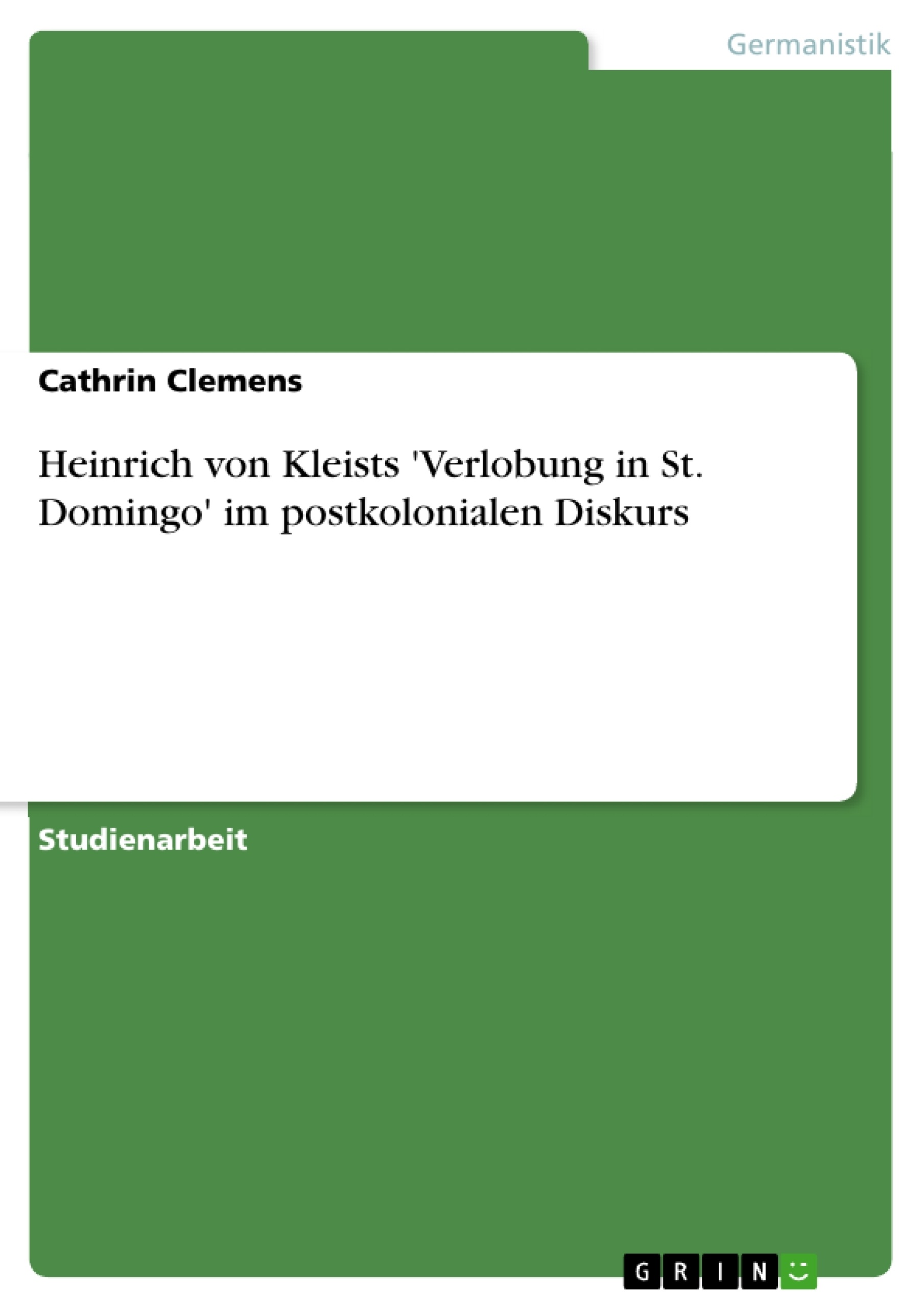„Zu Port au Prince, auf dem französischen Anteil der Insel St. Domingo, lebte zu Anfange dieses Jahrhunderts, als die Schwarzen die Weißen ermordeten, auf der Pflanzung des Herrn Guillaume von Villeneuve, ein fürchterlicher alter Neger, namens Congo Hoango.“ Dieser vielzitierte Einleitungssatz von Heinrich von Kleists Novelle Die Verlobung in St. Domingo legt die Thematik der Erzählung sofort offen: eine französische Kolonie, gebeutelt vom Gegensatz zwischen Schwarzen und Weißen steht im Mittelpunkt. Gewaltakte, die im äußersten Fall bis zum Mord führen, innerhalb dieses Spannungsfeldes werden bereits angedeutet.
Das Wissen um die Existenz von etwas exotisch Anderem hat im europäischen Denken Phantasien von Machtergreifung und/oder Bedrohung hervorgerufen. Der Kolonialismus des 18.-20. Jahrhunderts wurde zu einem globalen Phänomen, welcher sich letztlich auch in der Literatur niederschlug. Die Theoretiker der postcolonial studies setzten sich ausführlicher mit den Zusammenhängen zwischen literarischen Werken und dem (post-)kolonialen Kontext auseinander. In diesen postkolonialen Diskurs möchte diese Hausarbeit Die Verlobung in St. Domingo einordnen.
Hierzu ist es notwendig vorerst einige Grundlagen zu den Postkolonialen Studien zu klären, allen voran deren wichtigste Vertreter zu nennen und dessen Perspektive auf den Forschungsgegenstand mit Bezugnahme auf einige Fachbegriffe zu erläutern.
Daraufhin werde ich untersuchen wie Kleist die unterschiedlichen Kulturen, aufgeteilt in die schwarze und weiße Rasse, darstellt. Ein zentraler Punkt bei dieser Erörterung wird hierbei den Darstellungen des stereotypen Schwarzen, in der Geschichte verkörpert durch Congo Hoango, und der hybriden Mischhäutigen, Babekan und ihrer Tochter Toni Bertrand, welche sich noch im Aushandlungsprozess zwischen den Kulturen befinden, zukommen, um so aufzuzeigen welch ein ambivalenter und dynamischer Vorgang hinter der Definition von Schwarz und Weiß liegt.
Wie bereits angedeutet steckt in diesem Verhältnis der Kolonialmacht zu den Kolonialisierten auch ein erhebliches Machtpotential, welches mit Gewalt verbunden ist. Hier tritt der Gegensatz Gut und Böse zu Tage und die Frage nach der Legitimität sowie Ursachen von Gewalt. Dieses soll in einem zweiten Hauptaspekt, der v.a. auf die von Weißen ausgeführte Gewalt eingeht, näher betrachtet werden und sowohl in diesem, als auch im erst genannten Gesichtspunkt wird die Gender-Frage –und damit der Zusammenhang von biologischem und sozialem
- Quote paper
- Bachelor of Arts Cathrin Clemens (Author), 2013, Heinrich von Kleists 'Verlobung in St. Domingo' im postkolonialen Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280876