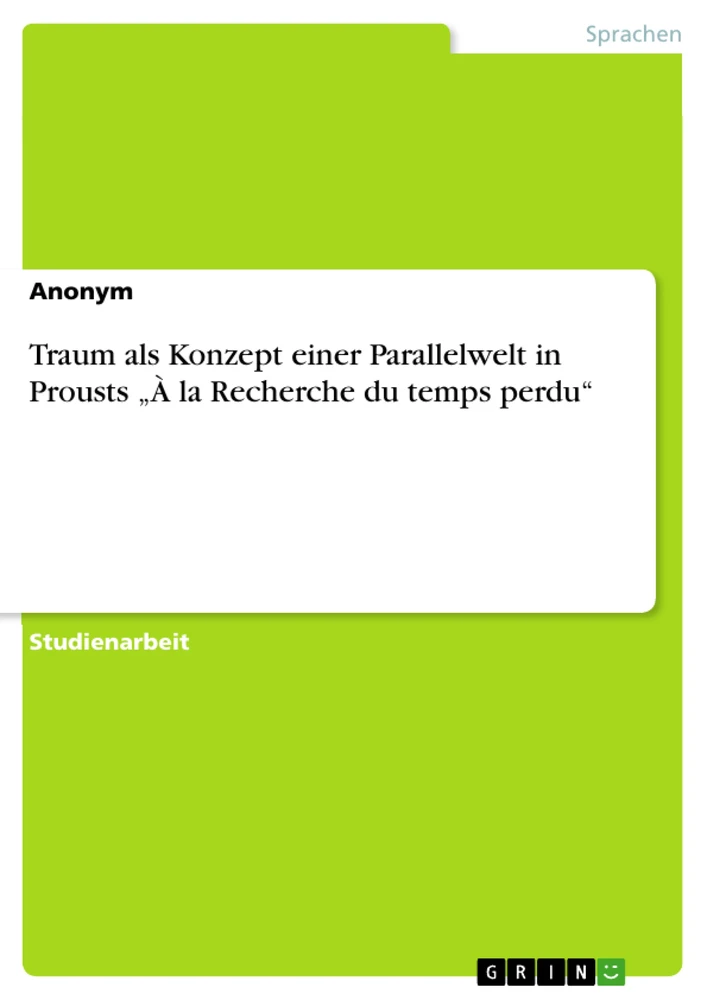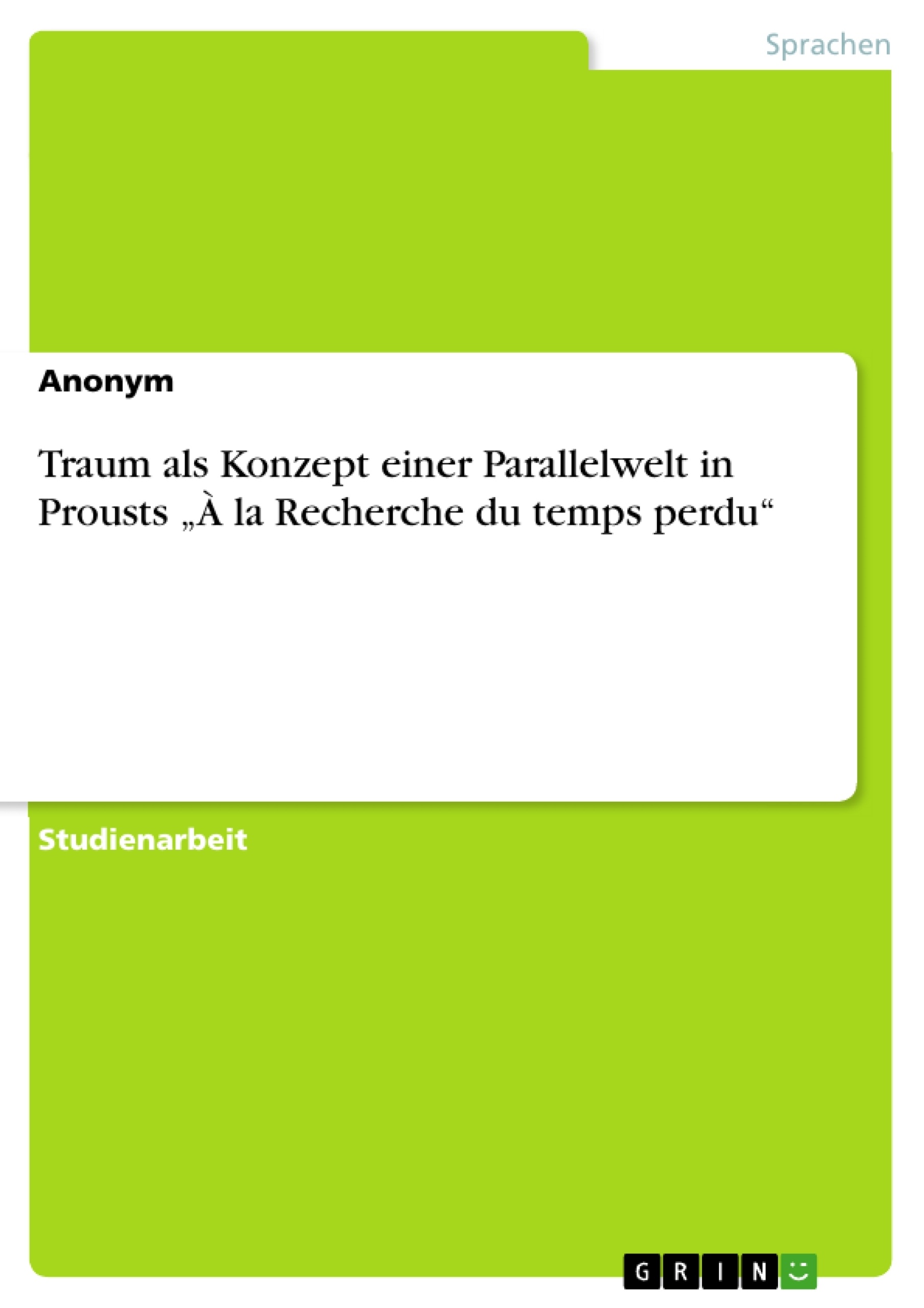Die vorliegende Arbeit ist der Fragestellung gewidmet: Inwieweit kann man in Prousts Romanzyklus „À la Recherche du temps perdu“ vom Traum als eigenständige und diskrepante Parallelwelt zur Außenwelt sprechen?
Die folgende Analyse klärt die werkimmanente Traumästhetik und stellt die Sphären Traum und Erwachen systematisch gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Marcel Prousts Bruch mit der klassischen Erzähltheorie
- Die Welt des Traums
- Marcel als träumender Held
- Zeit- und Raumkonzeptionen in Marcels Traumwelt
- Träumen bedeutet Erinnern
- Die „mémoire involontaire“ als Wegbereiter zum neuen Dasein
- Die Welt des Erwachens
- Das Erwachen als Übergang in eine andere Welt
- Zeit- und Raumkonzeption in der Welt des Erwachens
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung des Traums als Konzept einer Parallelwelt in Marcel Prousts Romanzyklus "À la Recherche du temps perdu". Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, inwiefern der Traum in Prousts Werk als eigenständige und diskrepante Welt zur Außenwelt betrachtet werden kann.
- Die Rolle des Traums in der Gestaltung von Identität und Selbstfindung
- Die Beziehung zwischen Traum und Erinnerung, insbesondere die "mémoire involontaire"
- Die Auswirkungen von Traum und Erwachen auf Zeit- und Raumkonzeptionen
- Prousts Bruch mit der klassischen Erzähltheorie und seine innovative Verwendung der Ich-Perspektive
- Die Parallelen zwischen Prousts Werk und Calderóns "La vida es sueño"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Traums als Konzept einer Parallelwelt ein und stellt den Zusammenhang zwischen Prousts Werk und Calderóns "La vida es sueño" her. Der Traum wird als Ort der Befreiung und Entfaltung des Ichs beschrieben, zugleich aber auch als eine eigene Wirklichkeit mit eigenständiger Zeit- und Raumkonzeption.
Marcel Prousts Bruch mit der klassischen Erzähltheorie
Dieses Kapitel analysiert die spezifische Machart von Prousts Romanzyklus, insbesondere die Verwendung der Ich-Perspektive und die fiktionale Autobiographie. Der Bruch mit der klassischen Erzähltheorie wird anhand der Figuren und des Erzählers erläutert, wobei die besondere Beziehung zwischen dem erlebenden und erzählenden Ich hervorgehoben wird.
Die Welt des Traums
Dieses Kapitel beleuchtet die Welt des Traums in Prousts Werk. Es werden die verschiedenen Aspekte des Traums wie Zeit- und Raumkonzeptionen, die Rolle des erinnernden und vergehenden Traums sowie die "mémoire involontaire" als Wegbereiter zum neuen Dasein untersucht.
Die Welt des Erwachens
In diesem Kapitel wird die Welt des Erwachens im Kontrast zur Welt des Traums betrachtet. Es geht um den Übergang von einer Welt in die andere und um die Auswirkungen von Traum und Erwachen auf die Zeit- und Raumkonzeptionen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Traum, Parallelwelt, "mémoire involontaire", Ich-Erzähler, Zeit- und Raumkonzeption, Erinnerung, Selbstfindung, Proust, "À la Recherche du temps perdu", klassische Erzähltheorie, fiktionale Autobiographie, "La vida es sueño", Calderón de la Barca.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "mémoire involontaire" bei Marcel Proust?
Es bezeichnet das unwillkürliche Erinnern, das durch einen äußeren Reiz (wie den Geschmack einer Madeleine) ausgelöst wird und vergangene Erlebnisse lebendig werden lässt.
Inwiefern ist der Traum bei Proust eine Parallelwelt?
Der Traum besitzt eine eigene Zeit- und Raumkonzeption, die im krassen Gegensatz zur wachen Außenwelt steht und dem Ich eine neue Form des Daseins ermöglicht.
Wie bricht Proust mit der klassischen Erzähltheorie?
Er nutzt eine innovative Ich-Perspektive, die zwischen dem erlebenden und dem erzählenden Ich oszilliert und die lineare Zeitstruktur auflöst.
Welchen Einfluss hat Calderón de la Barca auf das Werk?
Es gibt Parallelen zu Calderóns "Das Leben ein Traum", wobei Proust die Idee des Traums als Ort der Selbsterkenntnis und Befreiung weiterentwickelt.
Was passiert im Moment des Erwachens in Prousts Roman?
Das Erwachen wird als schmerzhafter oder verwirrender Übergang dargestellt, in dem das Ich seine Orientierung in Zeit und Raum erst mühsam wiederfinden muss.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Traum als Konzept einer Parallelwelt in Prousts „À la Recherche du temps perdu“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280967