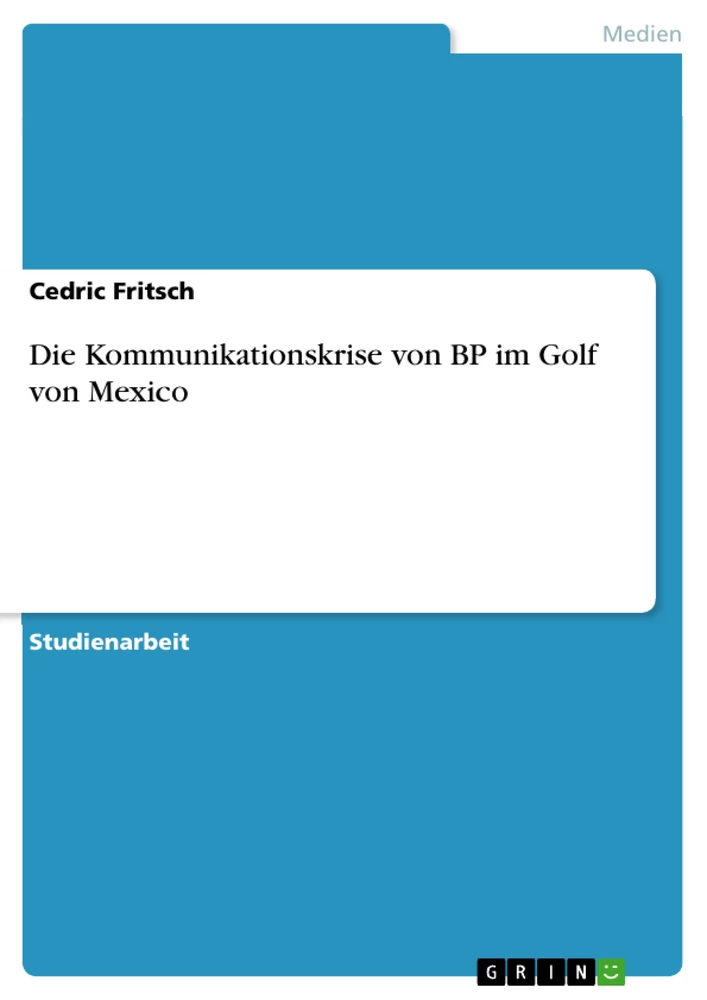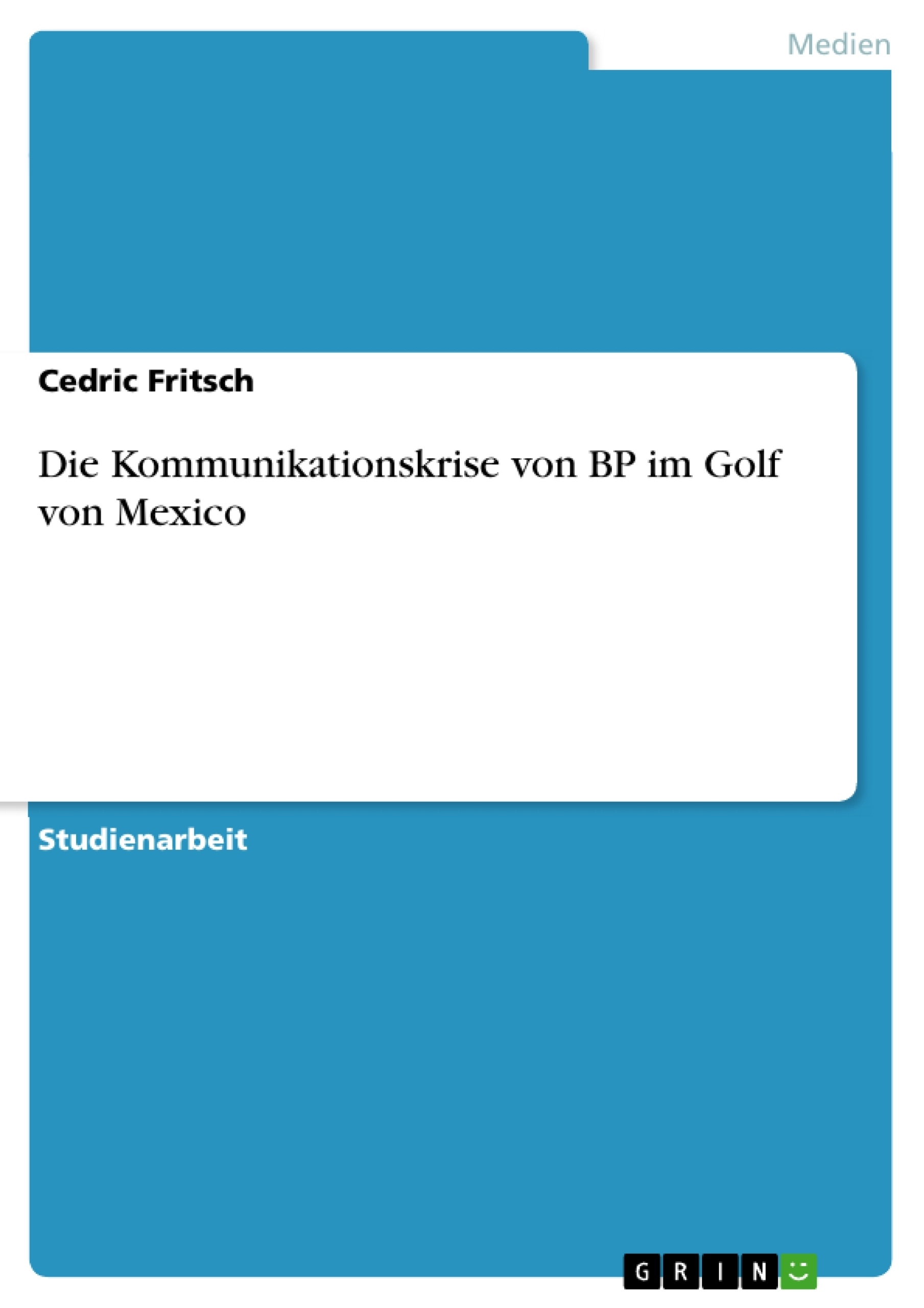Die BP-Krise im Golf von Mexico ist ein Beispiel par excellence für eine Kommunikationskrise – nicht nur natürlich – aber sie spielt wohl die größte Rolle für BP. Doch wie kommt es zu solchen Krisen und wie kam es im Speziellen im Golf von Mexico zu dieser Krise? Wie verlaufen Krisen theoretisch – wie ist sie bei BP verlaufen? Welche Auswirkungen hat eine solche Krise, welche Konsequenzen gab es für BP? Das alles soll in der vorliegenden Arbeit erörtert werden – aus theoretischer Sicht und anhand des Beispiels der BP-Krise 2010. Es stellt sich also folgende Forschungsfrage:
„Wie entsteht und verläuft eine Krise mit welchen Auswirkungen in der Theorie und bei der Krise der Deepwater Horizon von BP im Golf von Mexico 2010?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Ein Überblick der BP-Krise 2010 im Golf von Mexico
- Krisenursachen, Krisenverlauf und Krisenauswirkungen
- Die Krisenursachen
- Krisenursachen aus theoretischer Perspektive
- Krisenursachen bei der BP-Krise
- Der Krisenverlauf
- Theoretische Ansätze und Krisenverlaufsmodelle
- Die Ad-hoc-Krise
- Der Verlauf der BP-Krise
- Auswirkungen der BP-Krise
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kommunikationskrise von BP im Golf von Mexico im Jahr 2010. Sie analysiert die Ursachen, den Verlauf und die Auswirkungen dieser Krise anhand theoretischer Ansätze und des konkreten Fallbeispiels. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Entstehung, den Verlauf und die Folgen von Kommunikationskrisen zu entwickeln und die spezifischen Herausforderungen, denen BP in dieser Situation gegenüberstand, zu beleuchten.
- Theoretische Ansätze zur Krisenkommunikation
- Analyse der Ursachen der BP-Krise
- Der Verlauf der BP-Krise und die Rolle der Kommunikation
- Auswirkungen der Krise auf BP und die öffentliche Wahrnehmung
- Lernpunkte und Implikationen für die Krisenkommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kommunikationskrisen ein und stellt die Relevanz des Fallbeispiels BP im Golf von Mexico heraus. Sie beleuchtet die Bedeutung von Krisenkommunikation für Unternehmen und die Herausforderungen, die mit der Bewältigung von Krisen verbunden sind. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das Kapitel "Begriffsdefinitionen" klärt wichtige Begriffe im Kontext der Krisenkommunikation, wie z.B. "Krise", "Krisenkommunikation" und "Reputation". Es liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse der BP-Krise.
Das Kapitel "Ein Überblick der BP-Krise 2010 im Golf von Mexico" bietet einen umfassenden Überblick über die Ereignisse, die zur BP-Krise führten. Es beschreibt die Ursachen, den Verlauf und die Auswirkungen der Ölkatastrophe im Golf von Mexico.
Das Kapitel "Die Krisenursachen" untersucht die Ursachen der BP-Krise aus theoretischer Perspektive und analysiert die spezifischen Faktoren, die zur Ölkatastrophe führten. Es beleuchtet die Rolle von Unternehmensfehlern, mangelnder Sicherheitskultur und der fehlenden Kommunikation.
Das Kapitel "Der Krisenverlauf" analysiert den Verlauf der BP-Krise anhand theoretischer Ansätze und Modelle der Krisenkommunikation. Es untersucht die Reaktion von BP auf die Krise und die Kommunikation des Unternehmens in den verschiedenen Phasen der Krise.
Das Kapitel "Auswirkungen der BP-Krise" beleuchtet die Folgen der Ölkatastrophe für BP und die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens. Es analysiert die Auswirkungen auf die Reputation, den Unternehmenswert und die Geschäftsaktivitäten von BP.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kommunikationskrise, die BP-Krise im Golf von Mexico, Krisenursachen, Krisenverlauf, Krisenkommunikation, Reputation, Image, Medienberichterstattung, Ölkatastrophe, Deepwater Horizon, Sicherheitskultur, Unternehmensfehler, öffentliche Wahrnehmung, Krisenmanagement, PR-Strategien und Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ursachen der BP-Krise im Golf von Mexiko?
Zu den Ursachen zählten technische Fehler bei der Deepwater Horizon, eine mangelhafte Sicherheitskultur im Unternehmen sowie Fehler in der frühen Kommunikation.
Wie verlief die Krisenkommunikation von BP?
Die Arbeit analysiert den Verlauf als "Ad-hoc-Krise" und untersucht, wie BP auf die Ereignisse reagierte und welche PR-Strategien in den verschiedenen Phasen angewandt wurden.
Welche Auswirkungen hatte die Ölkatastrophe auf die Reputation von BP?
Die Krise führte zu einem massiven Imageverlust, einer Verschlechterung der öffentlichen Wahrnehmung und erheblichen finanziellen Einbußen für das Unternehmen.
Was ist ein Krisenverlaufsmodell?
Ein theoretisches Modell, das beschreibt, wie Krisen typischerweise entstehen, eskalieren und abklingen, was Unternehmen hilft, ihre Kommunikation besser zu planen.
Welche Lernpunkte ergeben sich aus der BP-Krise für andere Unternehmen?
Wichtige Erkenntnisse sind die Notwendigkeit einer proaktiven Kommunikation, die Übernahme von Verantwortung und eine glaubwürdige Sicherheitskultur.
- Quote paper
- Cedric Fritsch (Author), 2014, Die Kommunikationskrise von BP im Golf von Mexico, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281008