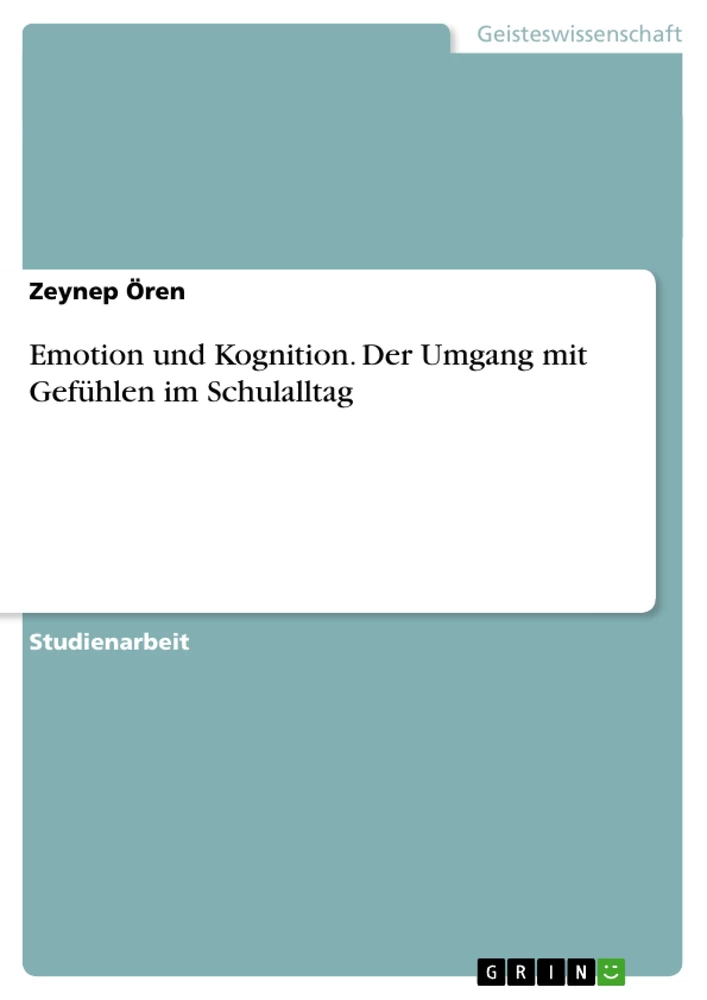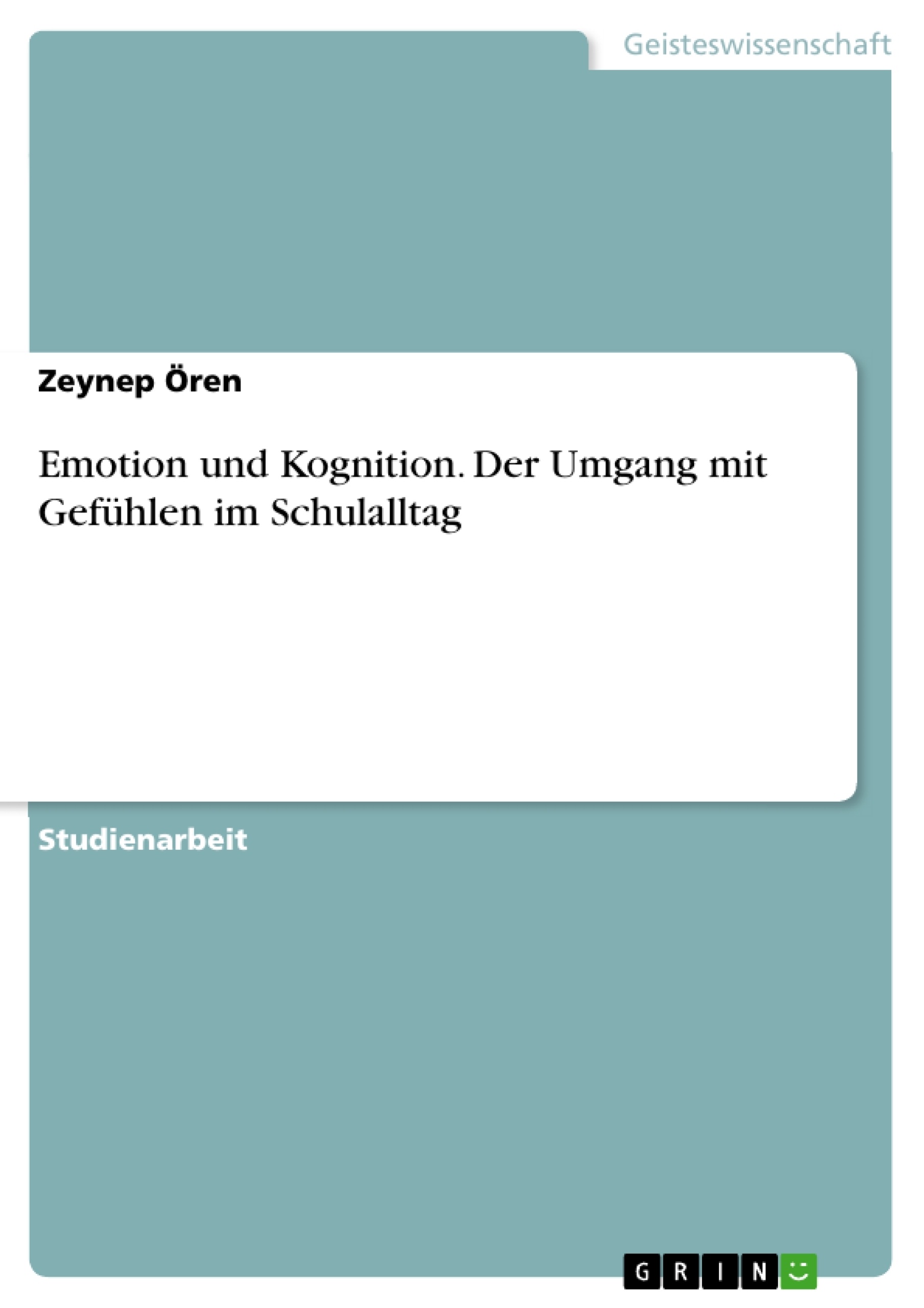Im Alltag sind Emotionen und Stimmungen allgegenwärtig und sie beeinflussen ständig unser Tun und Handeln. Die Emotionen sind ursprünglich und fundamental. Sie sind nahe an unserer inneren Wahrheit. Für Plato stand jedoch fest, dass Emotionen nichts anderes seien als „die Feinde des Denkens“ oder „die wilden Pferde, die durch den Verstand gezügelt werden müssen“ (Aschmann, B. 2005, S.33). Gefühle wurden aufgrund des „rationalistischen Menschenbilds“ in der Entscheidungsforschung lange Zeit vernachlässigt (vgl. Betsch & Funke & Plessner 2011, S.124). Bis heute ist die Debatte um das Verhältnis von Emotion und Kognition in der Wissenschaft stark umstritten. Angestoßen wurde diese Debatte durch einen Artikel aus dem Jahre 1980 von Zajonc „Feeling and Thinking: Preferences need no Inferences“, in dem er die Frage stellte, ob Emotionen tatsächlich das Resultat kognitiver Bewertungsprozesse darstellen (vgl. Aschmann, B. 2005, S.35).
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich dieser Frage und versucht als erstes zu definieren, was Emotionen und Stimmungen sind. Anschließend werden die negative und positive Stimmung voneinander unterschieden. Im nächsten Punkt wird das Verhältnis von Emotion und Gedächtnis näher erläutert. Darauffolgend wird auf die Wichtigkeit von Emotionen in der Schule eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Emotionen und Stimmungen?
- Positive und negative Stimmung
- Emotion und Gedächtnis
- Emotionen in der Schule
- Emotionen in Fehlersituationen
- Die Regulation von Emotionen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Kognitionen alleine ausreichen, um menschliches Verhalten zu erklären, oder ob Emotionen eine entscheidende Rolle spielen. Sie analysiert die Definitionen von Emotionen und Stimmungen, untersucht die Auswirkungen von positiven und negativen Stimmungen auf kognitive Prozesse und beleuchtet die Rolle von Emotionen im Gedächtnis. Darüber hinaus wird der Einfluss von Emotionen auf das Lernen in der Schule betrachtet.
- Definition und Abgrenzung von Emotionen und Stimmungen
- Einfluss von positiven und negativen Stimmungen auf kognitive Prozesse
- Zusammenhang zwischen Emotionen und Gedächtnis
- Rolle von Emotionen im schulischen Kontext
- Regulierung von Emotionen im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz von Emotionen für menschliches Verhalten dar. Sie beleuchtet die historische Debatte um das Verhältnis von Emotion und Kognition und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Emotionen und Stimmungen. Es werden verschiedene Definitionen aus der wissenschaftlichen Literatur vorgestellt und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Begriffen „Emotion“, „Stimmung“, „Gefühl“ und „Affekt“ beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Abgrenzung von Emotion und Stimmung, wobei die Merkmale der Stimmung wie unklare Ursache, längere Dauer und geringere Intensität hervorgehoben werden. Das Kapitel beleuchtet auch die multidimensionale Natur von Emotionen und zeigt anhand von Experimenten, dass Emotionen entstehen können, ohne dass die sie auslösenden Reize bewusst wahrgenommen werden.
Das dritte Kapitel untersucht die Auswirkungen von positiven und negativen Stimmungen auf kognitive Prozesse. Es wird gezeigt, dass negative Stimmungen eher zu einer analytischen Denkweise führen, während positive Stimmungen heuristisches Denken fördern. Das Kapitel beleuchtet auch die Auswirkungen von Stimmungen auf die Selbstaufmerksamkeit und das Abrufen von Gedächtnisinhalten.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Zusammenhang zwischen Emotionen und Gedächtnis. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Lernen unter dem Einfluss von Gefühlen oder in einem gefühlsneutralen Kontext besser ist. Das Kapitel beleuchtet die Forschungsergebnisse von Bower, die einen Zusammenhang zwischen emotionaler Befindlichkeit und dem Merken von Inhalten belegen. Es wird jedoch auch die umstrittene Frage diskutiert, ob emotional aufgeladene Situationen generell besser erinnert werden.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Emotionen in der Schule. Es werden die Auswirkungen von Emotionen in Fehlersituationen und die Bedeutung der Emotionsregulation im schulischen Kontext beleuchtet. Das Kapitel zeigt, wie Emotionen das Lernen beeinflussen können und wie wichtig es ist, dass Schüler lernen, ihre Emotionen zu regulieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Emotion, Kognition, Stimmung, Gedächtnis, Lernen, Schule, Fehlersituationen, Emotionsregulation, und das Verhältnis von Emotion und Kognition. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Emotionen für menschliches Verhalten und die Auswirkungen von Emotionen auf kognitive Prozesse, insbesondere im schulischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Emotion und Stimmung?
Emotionen sind intensiv und objektgerichtet, während Stimmungen oft länger andauern, weniger intensiv sind und keine klare Ursache haben.
Wie beeinflusst die Stimmung das Denken?
Negative Stimmungen fördern meist analytisches Denken, während positive Stimmungen eher zu kreativem oder heuristischem Denken führen.
Welche Rolle spielen Emotionen beim Lernen in der Schule?
Emotionen beeinflussen das Gedächtnis und die Motivation. Besonders in Fehlersituationen ist die Regulation von Gefühlen entscheidend für den Lernerfolg.
Sind Emotionen wirklich 'Feinde des Denkens'?
Entgegen Platos Ansicht zeigt die moderne Forschung, dass Emotionen und Kognitionen eng miteinander verknüpft sind und Emotionen für Entscheidungsprozesse notwendig sind.
Können Emotionen unbewusst entstehen?
Ja, Experimente belegen, dass Emotionen durch Reize ausgelöst werden können, die vom Individuum nicht bewusst wahrgenommen werden.
- Arbeit zitieren
- Zeynep Ören (Autor:in), 2013, Emotion und Kognition. Der Umgang mit Gefühlen im Schulalltag, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281055