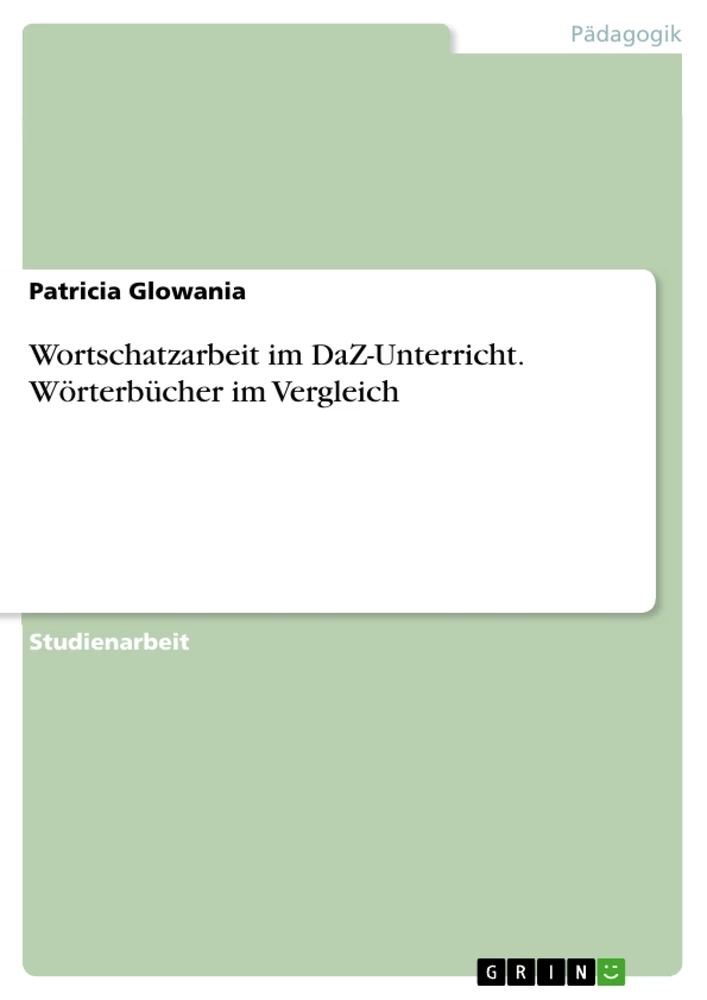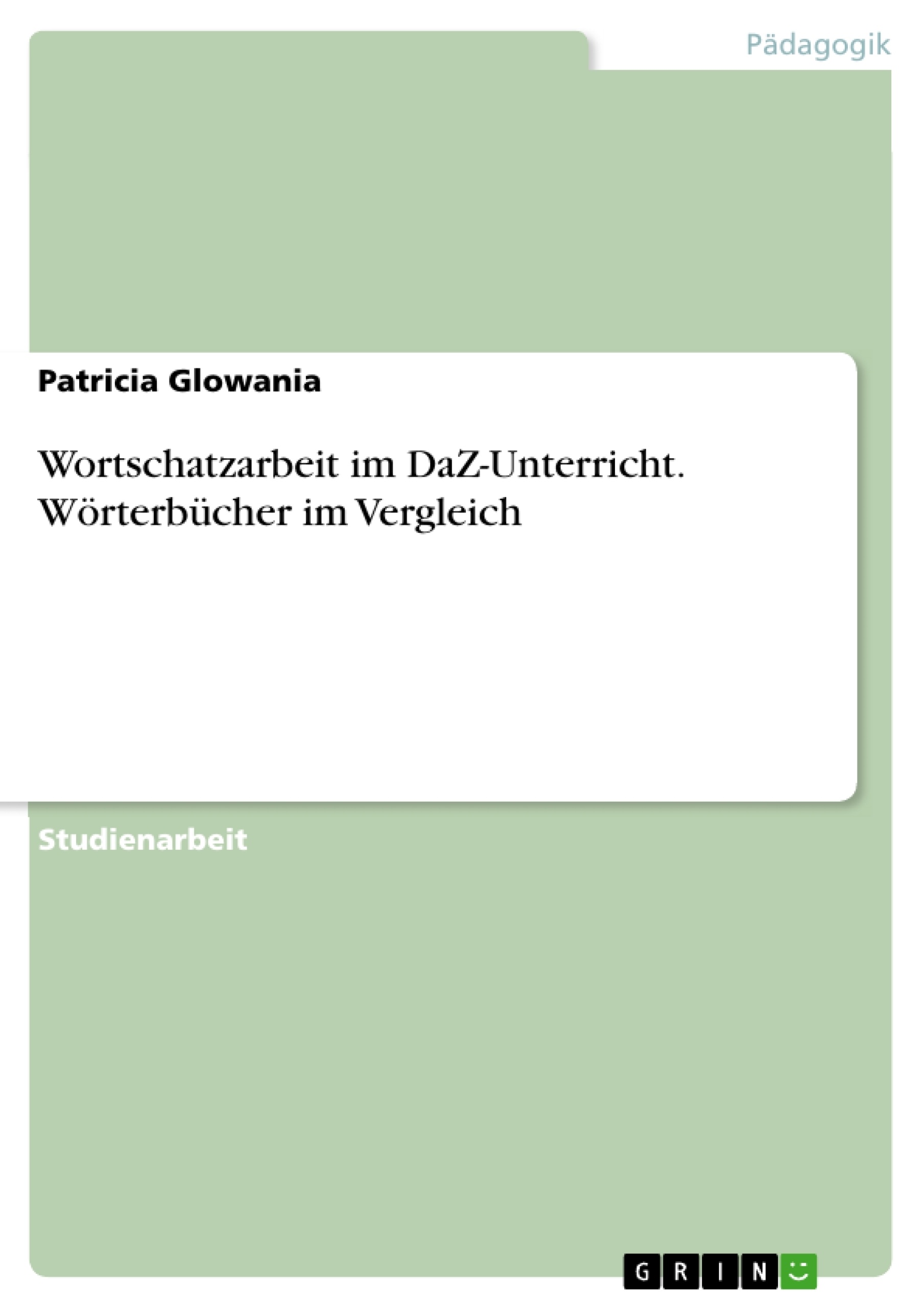Mit Titeln wie „Schlag auf, schau nach!“, „ABC-Detektiv“ oder einfach nur „Wörterbuch für die Grundschule“ werben Verlage um ihre potentielle Kunden: Die Eltern, welche das Wörterbuch kaufen und die Kinder, die mit dem Wörterbuch arbeiten und davon profitieren sollen. Die wohl schwierigste Aufgabe kommt dabei den Lehrern zu. Sie müssen entscheiden, welches Wörterbuch für ihre Schülerinnen und Schüler geeignet ist. Deutschlehrer schauen dabei wohl in erster Linie auf den Aufbau, die Übersichtlichkeit und die Informationen, welche zur Rechtschreibüberprüfung vorhanden sind. Im besten Fall hält das Wörterbuch noch die eine oder andere Information zu den Wortbedeutungen bereit und bietet anschauliche Beispiele an. Lehrkräfte von DaZ-Lernern haben es bei der Auswahl nicht weniger schwer. Sie müssen jedoch verstärkt auf die Worterklärungen, -bedeutungen und Anwendungsbeispiele achten. Auch Illustrationen spielen besonders im Primarbereich eine wichtige Rolle. Eine erste Sichtung ist dabei sicher ernüchternd: Die meisten Wörterbücher für die Grundschule sind in erster Linie zur Rechtschreibprüfung konzipiert. Schaut man sich in der Abteilung der Bildwörterbücher um, muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, wie geeignet diese für den Einsatz im DaZ-Unterricht sind.
Die folgende Arbeit will dafür einige Kriterien verdeutlichen, welche die Auswahl erleichtern können. Zunächst soll jedoch ein elementarer Überblick über den Bereich der Lexikographie gegeben werden. Neben ausgewählten Informationen zu den verschiedenen Wörterbuchtypen, wird eine kurze Zusammenfassung zum Aufbau von Wörterbucheinträgen gegeben. Es folgt eine Erläuterung der Lexikologie und damit einhergehend die Erklärung der Begriffe „Wort“, „Wortschatz“ und „Wortschatzarbeit“. Auch der Wortschatzerwerb wird sehr komprimiert zusammengefasst. Anschließend wird die Wortschatzarbeit und der Wörterbucheinsatz im DaZ-Unterricht erörtert. Dabei geht es um den Wortschatzaufbau in der Grundschule und im DaZ-Unterrichtsowieallgemeine Aspekte der Wörterbucharbeit im DaZ-Unterricht. Die DaZ-Rahmenrichtlinien des Landes Niedersachsen werden dabei mit aufgenommen und in Zusammenhang gebracht. In einem letzten Schritt werden allgemeine sowie spezielle Kriterien für DaZ-Wörterbücher aufgestellt, welche Grundlagenfür die anknüpfende Wörterbuchuntersuchung sind. In die Synopse der Wörterbuchuntersuchung wurden acht aktuelle (2009-2013), darunter zwei Bilderwörterbücher, aufge-nommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lexikographie – Wissenswertes rund um's Wörterbuch
- Lexikologie – Ein „Teilbereich“ der Lexikographie
- Wortschatzarbeit und Wörterbucheinsatz im DaZ-Unterricht
- Wörterbücher im Vergleich
- Kriterien
- Synopse
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auswahl geeigneter Wörterbücher für den DaZ-Unterricht in der Grundschule. Sie analysiert verschiedene Wörterbuchtypen und ihre Eignung für den Wortschatzerwerb und die Wortschatzarbeit von Deutsch als Zweitsprache-Lernern. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Wörterbüchern im DaZ-Unterricht und untersucht, welche Kriterien bei der Auswahl von DaZ-Wörterbüchern zu beachten sind.
- Lexikographie und Wörterbuchtypen
- Lexikologie und Wortschatzarbeit
- Wörterbucheinsatz im DaZ-Unterricht
- Kriterien für die Auswahl von DaZ-Wörterbüchern
- Wörterbuchuntersuchung und Synopse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Problematik der Wörterbuchauswahl im DaZ-Unterricht dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Anforderungen an Wörterbücher für Deutsch als Muttersprache- und Deutsch als Zweitsprache-Lerner.
Das Kapitel „Lexikographie – Wissenswertes rund um's Wörterbuch“ gibt einen Überblick über die Lexikographie als Wissenschaft von der Erstellung von Wörterbüchern. Es werden verschiedene Wörterbuchtypen vorgestellt und ihre Merkmale erläutert.
Das Kapitel „Lexikologie – Ein „Teilbereich“ der Lexikographie“ beschäftigt sich mit der Lexikologie als Teilbereich der Lexikographie. Es werden die Begriffe „Wort“, „Wortschatz“ und „Wortschatzarbeit“ erklärt und der Wortschatzerwerb im DaZ-Unterricht beleuchtet.
Das Kapitel „Wortschatzarbeit und Wörterbucheinsatz im DaZ-Unterricht“ erörtert die Bedeutung von Wortschatzarbeit im DaZ-Unterricht und die Rolle von Wörterbüchern dabei. Es werden die DaZ-Rahmenrichtlinien des Landes Niedersachsen in den Kontext der Wortschatzarbeit gestellt.
Das Kapitel „Wörterbücher im Vergleich“ stellt verschiedene Kriterien für die Auswahl von DaZ-Wörterbüchern auf und analysiert acht aktuelle Wörterbücher, darunter zwei Bilderwörterbücher. Die Synopse der Wörterbuchuntersuchung wird im Fazit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Lexikographie, Lexikologie, Wortschatzarbeit, Wörterbucheinsatz, DaZ-Unterricht, Grundschule, Wörterbuchtypen, Kriterien für die Auswahl von DaZ-Wörterbüchern, Bilderwörterbücher, Sprachwörterbücher, Synopse.
Häufig gestellte Fragen
Worauf müssen Lehrkräfte bei der Auswahl von DaZ-Wörterbüchern achten?
Besonders wichtig sind klare Worterklärungen, anschauliche Anwendungsbeispiele und Illustrationen, die das Verständnis der Wortbedeutungen unterstützen.
Was ist der Unterschied zwischen Lexikographie und Lexikologie?
Lexikographie ist die Wissenschaft und Praxis des Erstellens von Wörterbüchern, während Lexikologie die theoretische Erforschung des Wortschatzes einer Sprache ist.
Sind Bildwörterbücher für den DaZ-Unterricht geeignet?
Ja, Bildwörterbücher sind besonders im Primarbereich wertvoll, da sie visuelle Anker für neue Begriffe bieten, allerdings sollten sie auch grammatikalische Hilfen enthalten.
Warum reichen Standard-Grundschulwörterbücher oft nicht aus?
Viele Standardwerke sind primär auf die Rechtschreibprüfung für Muttersprachler ausgelegt und bieten zu wenige Erklärungen zur Wortbedeutung für DaZ-Lerner.
Welche Rolle spielen die DaZ-Rahmenrichtlinien?
Die Rahmenrichtlinien (z.B. aus Niedersachsen) geben Kriterien vor, wie der Wortschatzaufbau systematisch gestaltet werden sollte, was die Auswahl der Arbeitsmittel beeinflusst.
- Quote paper
- Patricia Glowania (Author), 2014, Wortschatzarbeit im DaZ-Unterricht. Wörterbücher im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281086