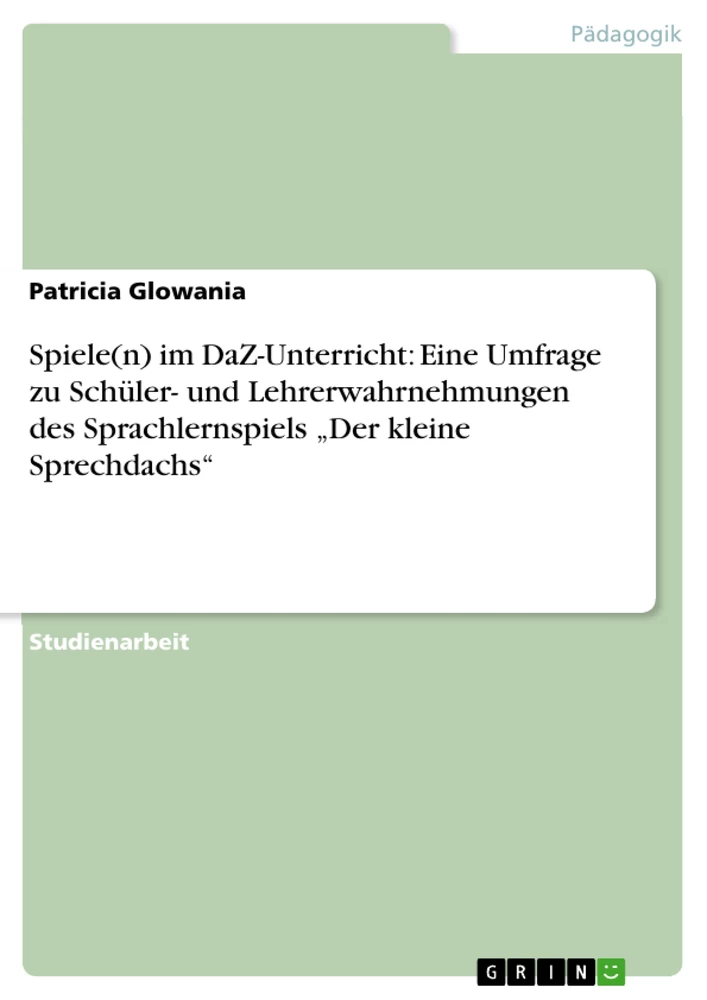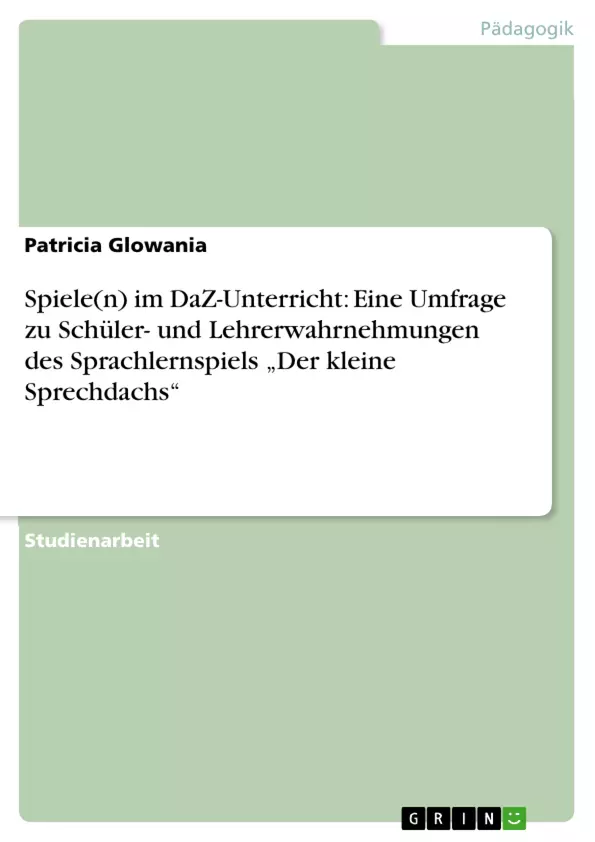Im Hinblick auf den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) erscheint es lohnenswert, das Spiel als einen möglichen Baustein in der Sprachvermittlung, –aneignung und Unterrichtspraxis zu betrachten. Zunächst soll eine Abgrenzung der Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“ erfolgen, wobei letzteres grundlegend für die weitere Auseinandersetzung sein soll. Anschließend soll eine Verknüpfung stattfinden: Welche Bedeutung haben Sprachlernspiele im DaZ-Unterricht? So sollen unter anderem Vorteile und mögliche Bedenken dargestellt werden. Es erfolgt dann eine Vorstellung des Sprachlernspiels „Der kleine Sprechdachs“, sowie die Vorstellung und Auswertung der durchgeführten Umfrage. Es soll herausgearbeitet werden, in wieweit die Bewertungen und Wahrnehmungen zu Spielen, speziell zu dem des „Der kleine Sprechdachs“ übereinstimmen und auseinandergehen.
Mögliche Kritik soll für eine Verbesserung und Optimierung des Spiels betrachtet werden. Am Ende dieser Arbeit sollte man sich als Leser jedoch über die Wichtigkeit des Einsatzes von Sprachlernspielen bewusst sein, um dann vielleicht auch andere davon zu überzeugen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spiel - Sprachspiel - Sprachlernspiel: Abgrenzung und Charakteristik
- Wieso? Weshalb? Warum? Zur Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht
- „Der kleine Sprechdachs“
- Spielbeschreibung
- „Der kleine Sprechdachs“ – Ein Sprachlernspiel?
- Vorstellung und Auswertung der Umfrage
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Sprachlernspielen im Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht (DaZ). Sie zielt darauf ab, die Vorteile und Herausforderungen des Einsatzes solcher Spiele aufzuzeigen und die Wirksamkeit eines konkreten Beispiels, „Der kleine Sprechdachs“, zu evaluieren.
- Abgrenzung der Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“
- Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht
- Analyse des Sprachlernspiels „Der kleine Sprechdachs“
- Auswertung einer durchgeführten Umfrage zum Spiel
- Bewertung der Wirksamkeit von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachlernspiele im DaZ-Unterricht ein. Sie betont die Bedeutung des Spiels als Lernmethode und kündigt die Abgrenzung der Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“ an. Weiterhin werden die Ziele der Arbeit dargelegt, welche die Untersuchung der Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht sowie die Analyse des konkreten Sprachlernspiels „Der kleine Sprechdachs“ umfasst. Die Auswertung einer durchgeführten Umfrage zum Spiel wird ebenfalls angekündigt. Die Einleitung legt den Fokus auf die Überzeugung des Lesers von der Wichtigkeit des Einsatzes von Sprachlernspielen.
Spiel - Sprachspiel - Sprachlernspiel: Abgrenzung und Charakteristik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“. Es wird die Schwierigkeit einer allgemein gültigen Definition des Begriffs „Spiel“ herausgestellt und verschiedene Aspekte und Charakteristika von Spielen beschrieben, wie Zweckfreiheit, Zielgerichtetheit, Inszenierung und die Einhaltung von Regeln. Der Unterschied zwischen „Sprachspiel“ im Sinne Wittgensteins und „Sprachlernspiel“ wird klargestellt, wobei letzteres zusätzlich sprachliche Lernziele beinhaltet. Das Kapitel führt Kriterien für effektive Sprachlernspiele an, die auf die Verknüpfung von Spiel- und Lernzielen abzielen, und die Sprachlernspiele von anderen Spieltypen abgrenzen.
Wieso? Weshalb? Warum? Zur Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht. Es werden häufige Bedenken gegen den Einsatz von Spielen im Unterricht erörtert, wie zum Beispiel der Zeitaufwand und die Befürchtung, dass Spielen nur zur Unterhaltung diene. Das Kapitel argumentiert jedoch, dass Emotionen beim Lernen eine wichtige Rolle spielen und dass soziale Lernkontexte die Informationsverarbeitung und den Lernerfolg verbessern. Es werden verschiedene Gründe für den Einsatz von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht genannt, unter anderem die Entsprechung zur kindlichen Erfahrungswelt und die Förderung von kommunikativen Fähigkeiten.
Schlüsselwörter
Sprachlernspiele, DaZ-Unterricht, Spieltheorie, Kommunikativer Ansatz, „Der kleine Sprechdachs“, Lernmethoden, Sprachvermittlung, Sprachaneignung, spielerisches Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachlernspiel "Der kleine Sprechdachs" im DaZ-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Sprachlernspielen im Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht (DaZ). Der Fokus liegt auf der Analyse der Vorteile und Herausforderungen des Einsatzes solcher Spiele und der Evaluierung des konkreten Sprachlernspiels „Der kleine Sprechdachs“.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung der Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“, die Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht, eine detaillierte Analyse des Spiels „Der kleine Sprechdachs“, die Auswertung einer durchgeführten Umfrage zu diesem Spiel und eine abschließende Bewertung der Wirksamkeit von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht.
Wie werden die Begriffe „Spiel“, „Sprachspiel“ und „Sprachlernspiel“ abgegrenzt?
Das Kapitel „Spiel - Sprachspiel - Sprachlernspiel: Abgrenzung und Charakteristik“ definiert und differenziert diese drei Begriffe. Es werden die Schwierigkeiten bei der Definition von „Spiel“ erörtert und verschiedene Aspekte wie Zweckfreiheit, Zielgerichtetheit, Inszenierung und Regelhaftigkeit beschrieben. Der Unterschied zwischen Wittgensteins „Sprachspiel“ und dem „Sprachlernspiel“ mit seinen zusätzlichen sprachlichen Lernzielen wird klargestellt. Es werden zudem Kriterien für effektive Sprachlernspiele vorgestellt.
Warum sind Sprachlernspiele im DaZ-Unterricht wichtig?
Das Kapitel „Wieso? Weshalb? Warum? Zur Bedeutung von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht“ diskutiert die Bedeutung von Sprachlernspielen. Es werden gängige Bedenken, wie Zeitaufwand und die Befürchtung der bloßen Unterhaltung, erörtert und widerlegt. Die Wichtigkeit von Emotionen beim Lernen und der Einfluss sozialer Lernkontexte auf die Informationsverarbeitung und den Lernerfolg werden hervorgehoben. Es werden verschiedene Gründe für den Einsatz von Sprachlernspielen im DaZ-Unterricht genannt, einschließlich der Ansprache der kindlichen Erfahrungswelt und der Förderung kommunikativer Fähigkeiten.
Wie wird das Spiel „Der kleine Sprechdachs“ analysiert?
Die Arbeit analysiert das Spiel „Der kleine Sprechdachs“ detailliert. Dies beinhaltet eine Spielbeschreibung, die Bewertung, ob es sich tatsächlich um ein Sprachlernspiel handelt, und die Vorstellung und Auswertung der durchgeführten Umfrage zu diesem Spiel.
Welche Ergebnisse liefert die Umfrage zum Spiel „Der kleine Sprechdachs“?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage zum Spiel „Der kleine Sprechdachs“. Diese Ergebnisse fließen in die Gesamtbewertung der Wirksamkeit des Spiels im DaZ-Unterricht ein.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen im Bereich Sprachlernspiele im DaZ-Unterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachlernspiele, DaZ-Unterricht, Spieltheorie, kommunikativer Ansatz, „Der kleine Sprechdachs“, Lernmethoden, Sprachvermittlung, Spracherwerb, spielerisches Lernen.
- Quote paper
- Patricia Glowania (Author), 2014, Spiele(n) im DaZ-Unterricht: Eine Umfrage zu Schüler- und Lehrerwahrnehmungen des Sprachlernspiels „Der kleine Sprechdachs“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281088