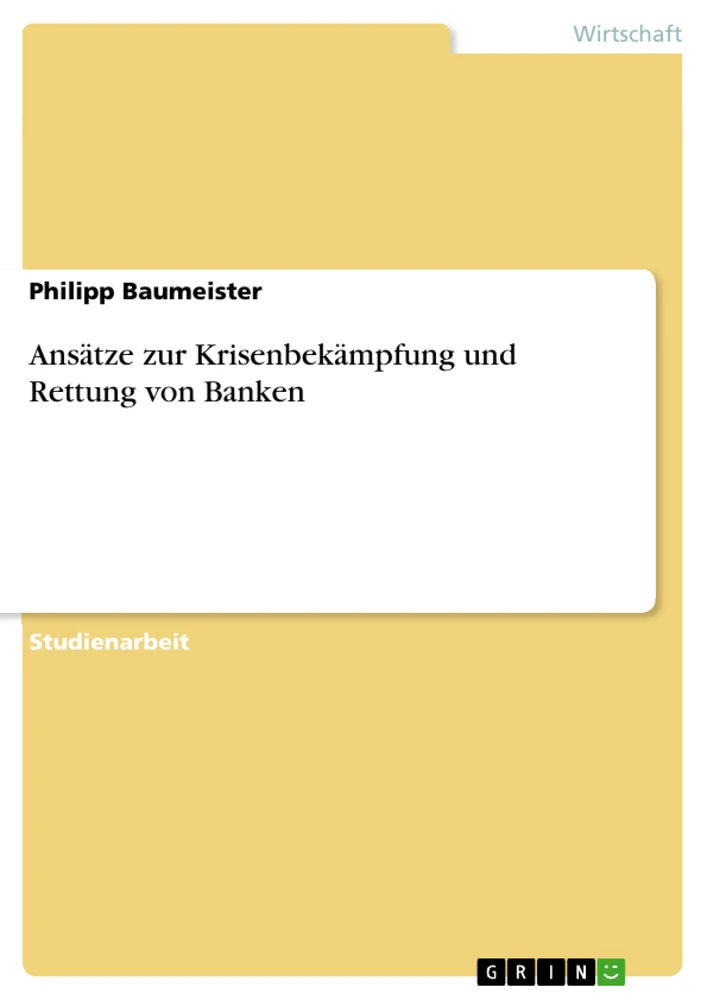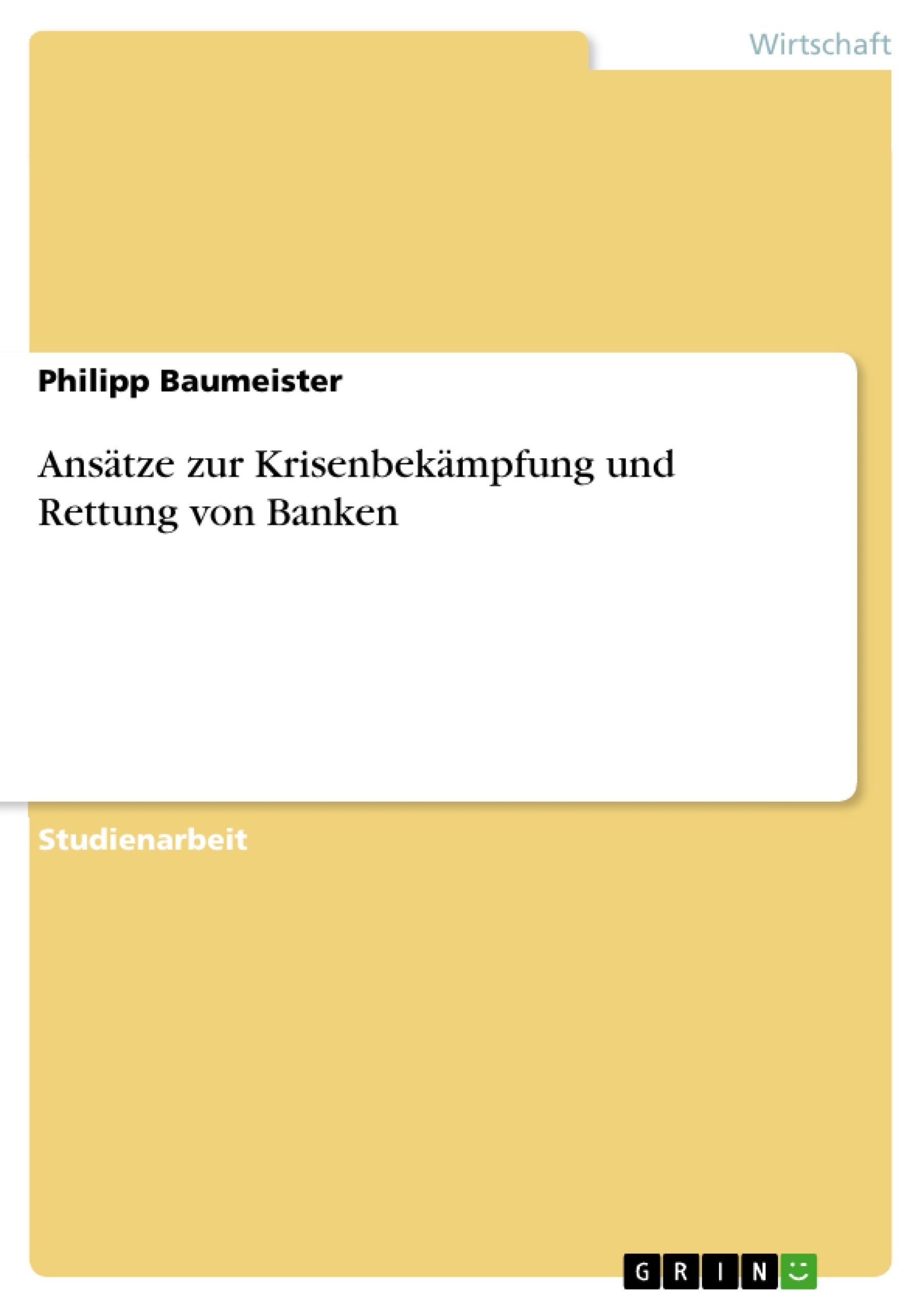Für die Finanz- und Realwirtschaft ist es von besonderer Bedeutung, dass ein funktionierendes Bankensystem zur Bereitstellung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs zur Verfügung steht. Es kommt jedoch vor, dass Banken aufgrund verschiedener Faktoren in strukturelle Schwierigkeiten geraten und nicht in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Eine Bankenkrise erfordert individuelle Ansätze zur Lösung, jedoch sollte eine Bankenrettung zwei übergestellte Ziele verfolgen: zum einen die Rettung der Bank im Hinblick auf die Minimierung der Kosten für alle Anspruchsgruppen, die an der Bank beteiligt sind, und zum anderen die Verhinderung von Ansteckungseffekten auf andere Bankinstitute.
Dabei sind die Subprimekrise und die Insolvenz der Lehman Brother Bank aus dem Jahr 2008 nur zwei von vielen Krisen, in denen sich eine Systematik zur Bankenrettung analysieren lassen kann. So kam es im Zuge der Weltwirtschaftskrise der frühen 30er Jahre in den USA zu weitreichenden Bankregulierungen, die den Grundstein für moderne Bankenrettungsstrategien gelegt haben. Die in den 80er Jahren aufgetretene Saving and Loans-Krise weist große Parallelen zu der heutigen Subprimekrise auf. Viele der vergebenen Kredite konnten von den Kunden nicht mehr zurückgezahlt werden und die Bankinstitute erlitten hohe Verluste.
Besonders aktuell ist die europäische Staats- und Bankenkrise, die im Jahr 2013 in Zypern zum ersten Mal die Beteiligung von Sparern im Rahmen eines Bail-In an der Bankenrettung erforderte und die Installation einer europäischen Bankenunion forcierte.
Im Rahmen der Aufarbeitung und Verhinderung von aktuellen und zukünftigen Bankenkrisen wurden unterschiedlichste Ansätze zur Bankenrettung diskutiert und angewandt. Ich möchte in dieser Arbeit versuchen, eine Analyse in Hinblick auf zwei verschiedene Ebenen zu ermöglichen. Einmal möchte ich die Unterschiede in der Herangehensweise verschiedener Nationen in Bezug auf ihren Umgang mit der Rettung von Banken herausarbeiten. Dabei sollen, sofern vorhanden, theoretische Modelle als Hilfestellung dienen. So kann der Bogen von konkreten Beispielfällen zu einer übergestellten Ebene gespannt werden, die dem Leser einen theoretisch fundierten Lösungsansatz bietet. Auf der anderen Seite soll der Entwicklungsprozess von Maßnahmen im Fokus stehen, um die Weiterentwicklung der einzelnen Maßnahmen im Zeitablauf erkennbar werden zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Problemstellung
- Die Funktion der Bank
- Bank Runs im Modell von Diamond und Dybvig
- Bank Runs in den 1930er Jahren
- Überblick: Subprimekrise, Zypernkrise, Argentinienkrise
- Bail-Out und Bail-In bei Banken
- Bail-Out: FMSG vs. EESA
- Bail-In in der Zypernkrise
- Bail-Out oder Bail-In: Der schmale Grat der Wirkungsweise
- Debt-Equity-Swaps
- Bankenunion: europäische Bankenunion vs. amerikanische Bankenunion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterseminararbeit befasst sich mit der Analyse verschiedener Ansätze zur Rettung von Banken in Krisensituationen. Dabei werden die Funktionsweise von Banken, die Ursachen für Bank Runs und die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten wie Bail-Out und Bail-In im Detail untersucht.
- Die Rolle von Banken in der Wirtschaft und die Entstehung von Bank Runs
- Der Vergleich von Bail-Out und Bail-In Strategien zur Bankenrettung
- Die Analyse verschiedener Krisenfälle und die Implikationen für die Bankenregulierung
- Die Bedeutung der Bankenunion für die Stabilität des Finanzsystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und beleuchtet die Funktion von Banken im Finanzsystem. Es werden die Ursachen für Bank Runs und die Notwendigkeit staatlicher Intervention im Krisenfall erläutert.
- Das zweite Kapitel analysiert das Modell von Diamond und Dybvig, welches die Entstehung von Bank Runs in einer theoretischen Umgebung erklärt. Außerdem werden historische Bank Runs der 1930er Jahre und aktuelle Beispiele wie die Subprimekrise, Zypernkrise und Argentinienkrise beleuchtet.
- Das dritte Kapitel untersucht die beiden wichtigsten Strategien zur Bankenrettung: Bail-Out und Bail-In. Es werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze sowie die konkrete Umsetzung in verschiedenen Krisenfällen analysiert. Die Kapitel diskutieren zudem die Bedeutung der Bankenunion für die Stabilität des Finanzsystems.
Schlüsselwörter
Bankenrettung, Bank Runs, Bail-Out, Bail-In, Finanzkrise, Bankenunion, Finanzmarktstabilität, Debt-Equity-Swap, Subprimekrise, Zypernkrise, Argentinienkrise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Bail-Out und Bail-In?
Bail-Out bezeichnet die Rettung einer Bank durch externe (staatliche) Mittel, während beim Bail-In Gläubiger und Sparer an den Kosten beteiligt werden.
Was ist ein „Bank Run“?
Ein Bank Run entsteht, wenn viele Kunden gleichzeitig ihre Einlagen abheben wollen, weil sie die Zahlungsfähigkeit der Bank bezweifeln.
Welche Rolle spielt die europäische Bankenunion?
Sie wurde infolge der Zypernkrise forciert, um die Finanzmarktstabilität in Europa durch einheitliche Aufsicht und Abwicklung zu sichern.
Was lehrt uns die Insolvenz von Lehman Brothers 2008?
Sie verdeutlichte die Gefahr von Ansteckungseffekten im globalen Finanzsystem und die Notwendigkeit moderner Rettungsstrategien.
Was besagt das Modell von Diamond und Dybvig?
Es bietet eine theoretische Erklärung dafür, warum Banken durch Fristentransformation anfällig für plötzliche Vertrauensverluste sind.
- Arbeit zitieren
- Philipp Baumeister (Autor:in), 2014, Ansätze zur Krisenbekämpfung und Rettung von Banken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281129